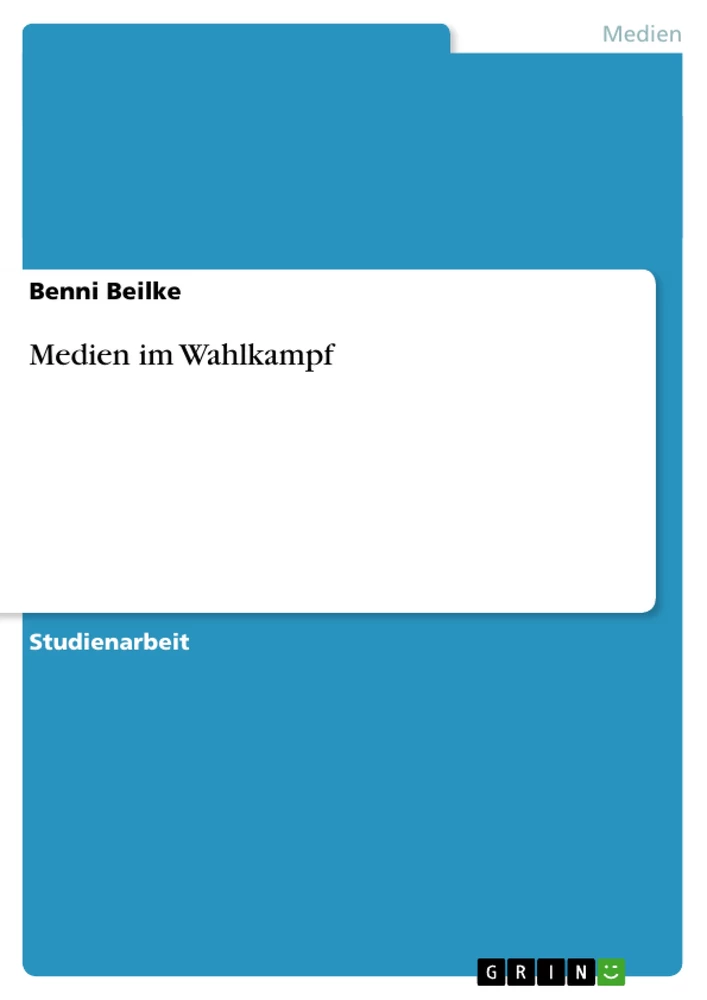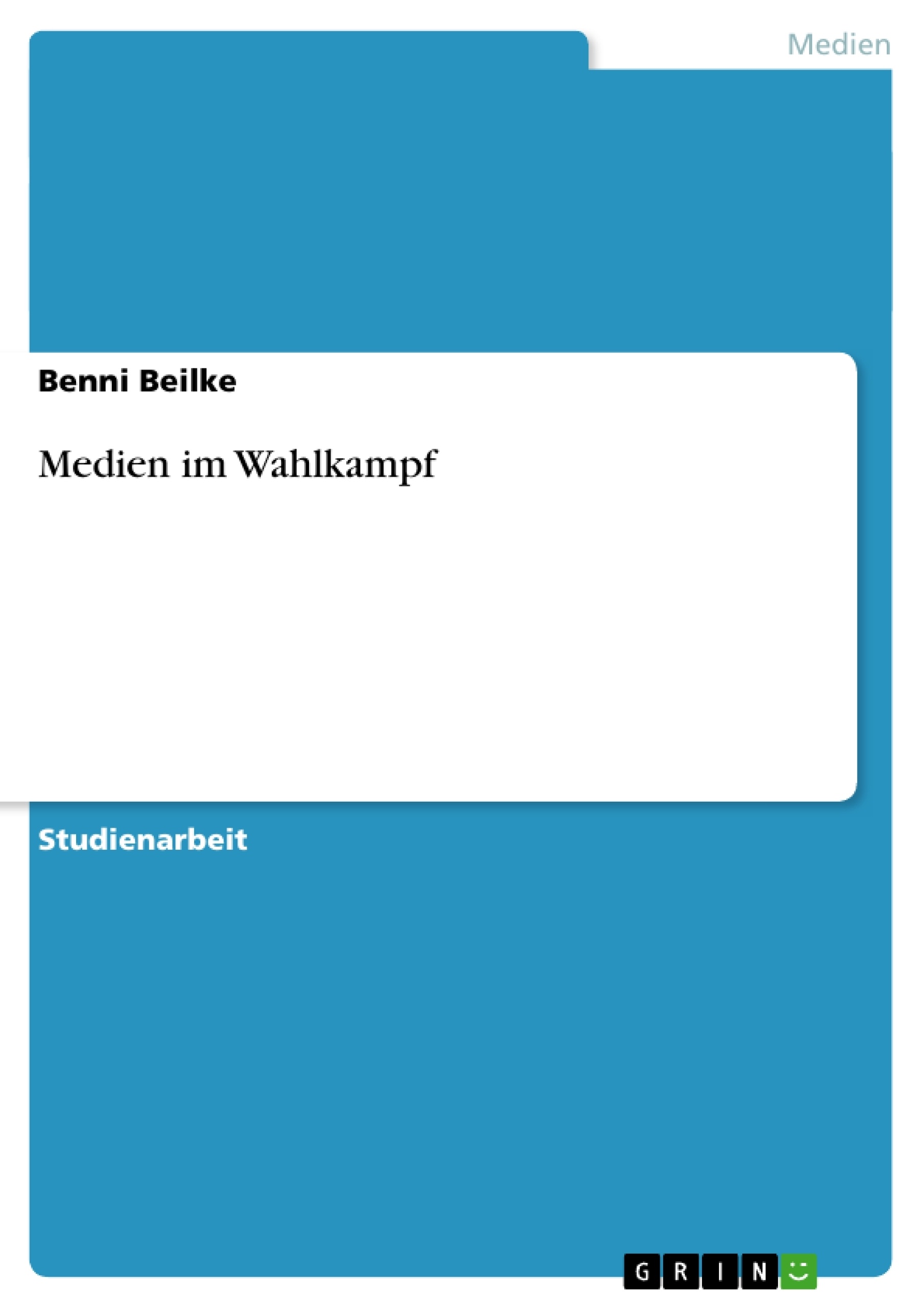1. Einleitende Bemerkung
,,Der Wahlerfolg ist zur einzigen Existenzberechtigung für Parteien geworden."1 Um demzufolge eine legitime Rolle in der Parteienlandschaft spielen zu können, muß es das höchste Anliegen ein jeder Partei sein, einen erfolgreichen Wahlkampf durchzuführen. Doch wie erreicht man am meisten Öffentlichkeit? Sicherlich kann die Antwort auf diese Frage nur `via Massenmedien` heißen.
Aber was macht die Berichterstattung der Medien im Wahlkampf nun so interessant?
Unterscheidet sie sich von der politischen Kommunikation während der Legislaturperiode? Bestimmt ist es das Bestreben der Politiker eine intensivere Nachrichtenpräsenz zu erreichen, je näher der Wahlabend rückt. Aber wie reagieren die Medien darauf? Haben die Medien eigene Interessen bzw. können Medien die politische Wirklichkeit verändern oder gar manipulieren? Wie sieht das Verhältnis zwischen Medien, Politik und Wähler aus? Wer ist von wem abhängig?
In den letzten Jahren konstatiert man in der Bundesrepublik Deutschland eine wachsende Politikverdrossenheit. Was sind die Gründe dafür? Werden politische Zusammenhänge zu kompliziert für den gemeinen Wähler? Ist die Amerikanisierung des Wahlkampfes eine richtige Reaktion darauf? Was bedeutet Amerikanisierung eigentlich?
Dieses sind die Fragen die ich mir zu Beginn dieser Arbeit gestellt habe und die ich im Folgenden beantworte. Zu Beginn dieser Arbeit wird kurz auf die Funktionen der Medien und des Wahlkampfes eingegangen. Danach werden drei Modelle vorgestellt, die versuchen eine Antwort auf die Frage, wer der eigentliche Urheber der politischen Agenda sei, zu finden. Im Anschluß daran wird die Abbildung des Wahlkampfes in den Medien thematisiert, um schließlich der Frage nachzugehen, ob, und wenn ja, inwieweit der deutsche Wahlkampf amerikanisiert ist.
2. Funktionen der Medien und des Wahlkampfes
In der Vergangenheit wurde Übereinstimmung in der Frage erzielt, welche Rolle die Medien, in besonderem Maße auch die Massenmedien, im Bezug auf Politik spielen sollen.2
In einer Massendemokratie, wie sie u.a. in der Bundesrepublik Deutschland existiert, ist es unmöglich, einen fortwährenden unmittelbaren Kontakt zwischen Politikern und Bürgern zu kreieren und zu erhalten. Deshalb ist es Aufgabe der Medien, dieses Loch zu schließen und Transparenz zu schaffen, um eine optionale Zugänglichkeit des Bürgers zum Politiker zu wahren. Laut Artikel 5 des Grundgesetzes ist diese exponierte Stellung der Medien rechtlich geschützt.
Vor allem im Wahlkampf wird den Massenmedien somit eine wichtige und durchaus schwierige Rolle zugesprochen.
In demokratisch regierten Ländern erhält das vorherrschende politische System durch Wahlen seine Legitimation. Vorbereitet werden diese Wahlen von den einzelnen politischen Gruppierungen durch Wahlkämpfe. Hierdurch soll der Bürger informiert und mobilisiert werden.3 Je näher die Wahl rückt, desto intensiver werden die Bemühungen der Parteien, um diesen Effekt zu erzielen. Da eine möglichst große Zahl an potentiellen Wählern erreicht werden soll, ist der Einsatz von Massenmedien der effektivste und logischste Schritt. Es wird generell zwischen drei Formen der Kommunikation zwischen Politik und Wahlpublikum unterschieden.
- Die nichtmediatisierte Form der Kommunikation
- Die teilmediatisierte Form der Kommunikation
- Die vollmediatisierte Form der Kommunikation4
Im Folgenden sollen diese drei unterschiedlichen Wege der Kommunikation genauer betrachtet werden.
Die älteste und wohl auch klassischste Form der Wahlwerbung verkörpert die nichtmediatisierte Kommunikation. Hierbei wird den Medien nur eine passive Rolle zuteil, d.h. sie werden nur als Träger der Information benutzt, ohne selbst aktiv die Aussage kommentieren zu können. ,,Dazu gehören die Werbespots im Fernsehen und im Radio, Anzeigen und Beilagen in Zeitungen und Zeitschriften sowie Wahlplakate."5
Eine bedingte Form der Einflußnahme eröffnet sich den Medien bei der teilmediatisierten Form der Kommunikation. In Interviews, Talkshows, Debatten, oder ähnlichen Foren hat der Politiker zwar die Möglichkeit seine Vorstellungen zu politischen Themen zu erläutern, durch gezielte Fragestellungen seitens des Diskussionsleiters kann dieser jedoch die Themen und die Gesprächsrichtung bestimmen und somit den Diskussionspartner in seiner werbenden Intention beeinträchtigen.
Die geringste Möglichkeit Einfluß zu nehmen bietet sich den politischen Akteuren bei der vollmediatisierten Form der Kommunikation. Berichte, Reportagen und Dokumentationen befähigen die Medien Inhalte durch Selektion und Interpretation selbst zu bestimmen. Diese Art von Journalismus setzt die Medien in eine der Politik übergeordnete Rolle und bemächtigt sie, dem Rezipienten eigene politische Vorstellungen und Meinungen zu suggerieren.
Obwohl das Agenda Setting zumeist in der Hand der Medien liegt, können auch die Politiker durch gezielte Themenauswahl Einfluß auf die Themenagenda ausüben. Sobald es nämlich eine politische Partei geschafft hat ihre Wahlkampfthemen der Öffentlichkeit zu vermitteln besteht ein Informationsbedarf den die Medien befriedigen müssen. Nun können die politischen Vorstellungen scheinbar neutral vermittelt werden, ohne offensichtliche Werbung zu betreiben.6 Durch diesen Umwälzungseffekt wird bei den potentiellen Wählern eine höhere Seriosität und Glaubwürdigkeit erzielt.
3. Wechselspiel Medien - Politik - Wähler
Auf welchem Weg gela ngt aber eine politische Partei in die Medien, bzw. wie schafft sie es ihre eigene Themenagenda dort zu manifestieren?
Das folgende Schaubild soll den theoretischen Ablauf der Beziehungsmöglichkeiten zwischen Wählern, Medien und den Parteien darstellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die `Public Agenda`, also das politische Themenbewußtsein der Bevölkerung steht hierbei in Abhängigkeit von der `Media Agenda`, also den Themenprioritäten der Medien. Diese wiederum ergibt sich aus der Selektion der `Political Agenda`, also der Themensetzung der politischen Akteure.7 Folglich stehen alle drei Gruppen in enger Verbindung zu einander und wirken quasi in Symbiose auf die Wirklichkeit ein.
Die Frage nach dem Urheber der politischen Agenda ist dadurch aber noch nicht geklärt.
Hierzu hat von Alemann drei Modelle entworfen, die im Folgenden besprochen werden:
1. Das bottom-up-Modell
2. Das top-down-Modell
3. Das Mediokratie -Modell8
3.1 Das bottom-up-Modell
Das bottom-up-Modell basiert auf dem ideologischen Grundgedanken der Demokratie: Alle Macht geht vom Volk aus. Wie die Abbildung zeigt, bestimmt hierbei das Publikum die politische Agenda. Die Medien werden dazu benutzt, um die Politik indirekt zu erreichen.
Das Publikum reflektiert also die Wirklichkeit, die von der Politik geschaffen wird. Daraus entstehen wiederum Erwartungen des Publikums an die Politik. Der Kreislauf beginnt von neuem.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da dieses Modell wie bereits erwähnt auf einer Ideologie beruht, kommt es über die graue Theorie nicht hinaus. Von Alemann selbst stellt fest, daß sich die Wirklichkeit verändert hat. Durch professionelle PR beeinflussen die Parteien die Medien, welche selbst ihre eigene Agenda der Politik und den Bürgern aufdrängen und somit versuchen sich die Politik zu unterwerfen.9
3.2 Das top-down-Modell
Das top-down-Modell ist auf einem anderen Ansatz begründet. Es geht von einer Hierarchie aus, die von oben, d.h. von den Politikern ausgeht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Indem die politischen Akteure Politik betreiben, also z.B. Gesetze verabschieden, Abkommen aushandeln, oder die Wirtschaft subventionieren, erschaffen sie eine politische Agenda, die von den Medien aufgenommen und verarbeitet werden muß, da sie von dieser Informationsquelle abhängig sind. Diese Agenda wird von den Medien dann wiederum an die Öffentlichkeit weitervermittelt.
3.3 Das Mediokratie-Modell
Aus einem wiederum anderen Blickwinkel wird das Zusammenspiel von Politik, Medien und Wählern im Mediokratie -Modell beleuchtet. Hierbei spielen nämlich die Medien die Hauptrolle. Sie beobachten die reale Welt, erfassen diese und leiten diese Information an die anderen beiden Gruppen weiter. Da Politische Zusammenhänge dem `normalen` Bürger oftmals zu komplex und schwierig erscheinen würden simplifizieren die Medien diese und kreieren somit selbst ihre eigene Wirklichkeit. Entsprechend ihrer Informationslage versuchen nun die Politiker ihrerseits Einfluß auf die reale Welt zu nehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Spinnt man den Faden ein bißchen weiter, so verschmelzen bald die Grenzen zwischen Medien und Politik. Betrachtet man die Medienwelt Berlusconis in Italien, so erscheint einem diese Theorie gar nicht mehr so weltfremd, wie sie anfänglich klingen mag.10
4. Die Beziehung zwischen Medien und Politik
Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Frage gestellt wurde wer wen instrumentalisiert, werden nun zwei unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze vorgestellt, die das Verhältnis von Über- und Unterordnung zwischen Massenmedien und Politik erklären.
4.1 Die Dependenzthese
Die Verfechter der Dependenzthese behaupten, daß die Politik von den Massenmedien abhängig sei. Sie ,, ... weisen der Autonomie und Funktionssicherung politischer Institutionen einen hohe n Rang zu ...(und)... erwarten von den Massenmedien eine dienende Rolle gegenüber Parlament, Regierung und Verwaltung ..."11. Mittlerweile jedoch hätten sich die Rollen verändert, die Massenmedien nehmen demzufolge eine der Politik übergeordnete Rolle ein.
Wurde im Absolutismus noch eine Politik völliger Geheimhaltung betrieben, so entdeckte man im 19. Jahrhundert bereits die Medien als Übermittlungsorgan. Laut Schulz hat sich die Politik der parlamentarischen Demokratien des 20. Jahrhunderts nicht nur in eine Abhängigkeit von den Medien hineinmanövriert, sondern sogar zu Machtverlagerungen zu ihren Ungunsten beigetragen12.
4.2 Die Instrumentalisierungsthese
Genau gegensätzlich verläuft die Argumentation der Befürworter der Instrumentalisierungsthese. Sie meinen eine Abhängigkeit der Massenmedien von der Politik festgestellt zu haben. Die Autonomie der Massenmedien sei essentiell wichtig, da sie die Funktion haben, ,, ... aktiv die Interessen der Bevölkerung (zu) artikulieren, ... Machtpositionen (zu) kritisieren und kontrollieren, ... die Bürger umfassend (zu) informieren und damit die Voraussetzungen für eine rationale politische Meinungs- und Willensbildung (zu) schaffen."13
Da aber die politischen Akteure durch geschickte PR eventuelle Leistungsdefizite kompensieren wollen, um so eine gewisse Massenloyalität zu erzeugen, kreieren sie somit einen zunehmenden Autonomieverlust der Massenmedien14. Demzufolge nimmt das politische System eine den Medien übergeordnete Rolle ein.
5. Der Wahlkampf in den Medien
Die Beziehungen zwischen Medien und Politik wurden und werden immer noch kontrovers diskutiert, eine von der Allgemeinheit akzeptierte These konnte bisher jedoch nicht gefunden werden. Wie aber sieht die eigentliche Rolle der Medien im Wahlkampf aus? Diese Frage soll im Folgenden beantwortet werden.
Da die Zeitung als Informationsmedium immer mehr in den Hintergrund rückt, wächst die Anzahl derer, die sich hauptsächlich über das Fernsehen politisch informieren immer mehr an. Zudem erlangt das Fernsehen immer höhere Verbreitung und Glaubwürdigkeit. Bereits 1980 spricht Noelle -Neumann von einer ,,Fernsehdemokratie"15, was die Macht des Fernsehens im Wahlkampf hervorragend widerspiegelt.
5.1 Der Stellenwert des Wahlkampfes in der Berichterstattung
Spricht man von der Berichterstattung der Medien im Wahlkampf, so muß festgestellt werden, daß der Themenkomplex Wahl zunächst nur von sekundärem Interesse ist. 1990 behandelten ihn gerade mal 4% der tagesaktuellen Fernsehberichterstattung.16
Als Beispiel für die Unterschiedlichkeit von Untersuchungsmethoden kann das Ergebnis von Semetko und Schönbach herangezogen werden, die 11% für die Fernsehberichterstattung angeben17. Einen ähnlich niedrigen Prozentsatz ermitteln Krüger und Zapf-Schramm, die für die Fernsehnachrichten 1998 einen Anteil des Wahlbezuges auf die Gesamtnachrichtendauer von nur 16,3% anführen.18
Deutlich höher liegt der Anteil der Wahlberichterstattung bei den Printmedien, da der Leser, anders als der Zuschauer, nicht auf schnelles Konsumieren getrimmt ist, sondern seine Informationen nach eigenen Präferenzen auswählen kann.
5.2 Faktor Zeit
1/3 aller Wahlberechtigten entscheiden sich spontan, kurz vor der Wahl, welcher Partei sie ihre Stimme geben.19 Da diese Wählertypen offensichtlich keine festgefahrene politische Grundgesinnung haben, sind sie wohl am zugänglichsten für die Manipulation durch die Medien.
Deshalb versuchen die Parteien gegen Ende des Wahlkampfes ihre Medienpräsenz zu steigern und genau dann die höchste Intensität aller Wahlkampfbemühungen zu erreichen. Es bleibt jedoch die Frage, ob diese Zunahme der Wahlkampfaktivitäten auch in der Berichterstattung der Massenmedien feststellbar ist .
Man erkennt schnell, daß das Ausmaß der Wahlkampfbeiträge keinesfalls parallel zu dem Ausmaß der Wahlkampfintensivierung seitens der Parteien läuft:
Bei der Kommunalwahl 1990 in Leipzig, so Lutz, stieg die Zeitungsberichterstattung nicht in dem Maße an wie der Wahlkampf an Umfang zunahm.20 Ein ähnliches Bild zeichnet Kindelmann für die Bundestagswahl 1990: Die beiden Kanzlerkandidaten erreichen ihre häufigste Erwähnung in den Printmedien fünf Monate vor der Wahl.21
Offensichtlich scheinen Wahlen also keinen besonders hohen Nachrichtenwert zu haben. Welche Aspekte eines Wahlkampfes werden nun aber von den Medien beleuchtet? Was ist der Inhalt der Wahlberichterstattung und wie kann man Konsumenten damit fesseln?
6. Amerikanisierung des deutschen Wahlkampfes?
Die wachsende Politikverdrossenheit der Öffentlichkeit spiegelt sich in den sinkenden Wahlbeteiligungen wider. Die politischen Akteure schaffen es immer weniger die Wähler zu mobilisieren. Wie kann man dem entgegenwirken?
Eine mögliche Antwort darauf scheint die Amerikanisierung des Wahlkampfes zu sein. Im Hinblick auf Wahlen wird dieser Begriff als Personalisierung, Mediatisierung und Professionalisierung des Wahlkampfes verstanden.22
6.1 Die Personalisierung des Wahlkampfes
Personalisierung bedeutet die zunehmende Ausrichtung des Wahlkampfes an Personen. Diese stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung, da sie Ideen und Programme ihrer Parteien verkörpern, und politische Botschaften transportieren. Der politische Prozeß ist dann stark personalisiert, wenn der Politiker weitgehend unabhängig von der Partei erscheint.
Ein typisches Beispiel hierfür ist der Wahlkampf der SPD bei der Bundestagswahl 1998, den Gerhard Schröder weniger durch überzeugende politische Argumente als vielmehr durch Persönlichkeit bestritt. Alle Vorwürfe, Sachthemen träten zugunsten einer größeren Selbstdarstellung der Kandidaten in den Hintergrund, versuchen die Verantwortlichen mit der Erklärung zu entkräften, daß die Partei eine kandidatenzentrierte Wahlkampfstrategie verfolge.23
Da die Parteienbindung in der Bevölkerung immer mehr verschwindet, gewinnt die Ausrichtung an Personen immer mehr an Bedeutung. Dem Wähler fällt es einfach leichter, sich mit Personen zu identifizieren als mit komplexen und abstrakten Parteiprogrammen. Scheinbare persönliche Integrität, oder schlichtweg Professionalität im Umgang mit Medien wird oftmals mit politischer Kompetenz gleichgesetzt. Vinson und Paletz beklagen den Rückgang von Streitfragen zugunsten von Gesichtern und stellen eine zunehmende Entpolitisierung der Politik fest.24
Kepplinger u.a. untersuchten Nachrichtensendungen mit Beiträgen zur Bundestagswahl 1990 und konnten hierbei aufzeigen, daß der Charakter der beiden Spitzenkandidaten Kohl und Lafontaine viermal so oft Gegenstand der Berichterstattung war als ihre politische Kompetenz.25 Auch 1994 waren die Personen ,,... das zentrale Element der Medienberichterstattung ...".26
Nicht nur der Zuschauer hat bei dieser Form des Wahlkampfes weniger Denkarbeit zu leisten. Auch für die Medien ist es einfacher Streitfragen plakativ auf Personen zu übertragen als diese zu erklären bzw. erklären zu lassen.
6.2 Die Mediatisierung
Unter Mediatisierung im Zusammenhang mit Wahlberichterstattung versteht man die Orientierung der politischen Akteure an den Medien. Um von deren Berichterstattung berücksichtigt zu werden richten sie ihre Aktionen nach den Gesetzmäßigkeiten der Medien: Spannung, Kürze, Verständlichkeit und Unterhaltsamkeit.
Vor allem in jüngster Vergangenheit hat dies dazu geführt emotionale Aspekte in den Vordergrund des Wahlkampfes zu rücken. 1998 wurden 69% Parteienpolitik und Wahlkampfführung von den Nachrichten mit Wahlbezug thematisiert,27 wobei Informationen über Wahlkampfveranstaltungen, also keine politischen Sachthemen im Vordergrund standen. In den USA berichteten die Medien 1988 primär nicht über die politischen Thesen eines Kandidaten, sondern darüber, wie groß der Vorsprung des einen gegenüber dem anderen war.28 Obwohl der politische Wert eines solchen Beitrages gleich Null ist, drängt sich eine Parallele zu deutschen Berichterstattungen - siehe Sonntagsfrage - auf.
Besonders RTL stilisierte den Bundestagswahlkampf 1998 zum ,,horse race" hoch, in dem sich die beiden Spitzenkandidaten Kohl und Schröder ein Kopf an Kopf Rennen lieferte n29. Auf diese Art und Weise konnte jedoch der Kanzlerbonus kompensiert werden.30
6.3 Der Kanzlerbonus
Der Amtsinhaber, der Bundeskanzler, hat bei der Mediatisierung stets einen Vorsprung, da er - ganz im Sinne des Top-down-Modells - stets einen Aktionsvorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern hat. Demnach scheint die höhere Häufigkeit in den Medien nur Produkt des höheren Nachrichtenwertes zu sein. Für die Bundestagswahl 1990 konstatieren Schönbach und Semetko einen Regierungsbonus in allen Medien.31
In den Nachrichten scheint also die Regierungspartei ungleich öfter vertreten zu sein. Bei der getrennt zu betrachtenden Wahlkampfberichterstattung jedoch finden die konkurrierenden Parteien ungefähr häufige Erwähnungen, was zu der Schlußfolgerung führt, daß für die Berichterstattung im Wahlkampf andere Selektionskriterien gelten müssen als für politische Berichterstattung im Allgemeinen.32
In den letzten Jahren hat die negative Berichterstattung immer mehr Zuspruch erhalten, wie Caspari u.a. feststellen.33 Da offenbar negative Informationen größere Wirkung beim Konsumenten hervorrufen, bedienen sic h vermehrt auch die politischen Akteure selbst dieser Methode (vgl. `Rote-Socken-Kampagne´ der CDU/CSU). Allerdings bleibt festzustellen, daß die Nähe des Wahlabends und die negative Berichterstattung bzw. Propaganda nicht miteinander korrelieren.34
Dennoch muß sich ein Politiker heutzutage gut verkaufen können, ob er nun Bundeskanzler ist oder nicht. Kohl z.B. hat sich 1998 nicht mehr einem Fernsehduell der Spitzenkandidaten gestellt, wie es in den USA schon obligatorisch ist und in Deutschland wohl bald auch sein wird.
Da die Medientauglichkeit den Politikern aber nicht in die Wiege gelegt wurde müssen sie sich professioneller Hilfe bedienen.
6.4 Die Professionalisierung
Als Folge der Orientierung an den Medien wächst der Bedarf an Beratern, deren Aufgabe es ist, die Vermarktung der Politik zu betreiben. Diese verwandeln die Politik in eine Art `virtual reality`, indem sie Pseudoereignisse oder mediatisierte Ereignisse kreieren.
,,Pseudoereignisse sind Ereignisse, die nicht stattfinden würden, wenn es keine Massenmedien gäbe, die darüber berichten, z.B. Pressekonferenzen und -stellungnahmen, aber auch Demonstrationen und Kundgebungen."35
,,Mediatisierte Ereignisse sind kommunikationsstrategisch überformte und eingerichtete Ereignisse, der materiellen Politik, denen Medienaufmerksamkeit gewiß ist, z.B. Auslandsreisen."36
Sicherlich bieten solcherlei Aktionen der Öffentlichkeit keinerlei objektiven Zugang zur wirklichen Politik, doch ermöglichen sie eine Kommunikation zwischen Wählern und Politikern.
Gerade in diesem Bereich scheinen also die Grenzen zwischen Politik und Journalismus mehr und mehr zu verschwimmen.
Schulz bringt die Phänomene der Amerikanisierung des Wahlkampfes auf den Punkt:37
- Personalisierung der Kampagne
- Wettstreit zwischen den Kandidaten
- Angriffswahlkampf
- Professionalisierung
- Marketing-Ansatz
- Ereignis- und Themenmanagement
7. Abschließende Bemerkung
Es wurden drei Modelle vorgestellt, die theoretisch angeben, welche gesellschaftlichen Gruppen die politische Agenda bestimmen. Desweiteren wurde ausgearbeitet, daß es für jedes der drei Modelle Belege gibt. In Europa scheint sich jedoch eine andere Theorie, das sogenannte Interdependenzmodell, herauszukristallisieren, welches die Trennung zwischen Journalismus und Politik nicht mehr so einfach erlaubt.
Ebenfalls bedenklich scheint die Amerikanisierung des Wahlkampfes zu sein. Handelt es sich hierbei um populistische Verflachung oder notwendige Simplifizierung politischer Komplexität? Ist das gemessene Ausmaß überhaupt gravierend?
Wie dem auch sei. Ich bin fest davon überzeugt, faß es in nächster Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland, schon alleine wegen der Mediendichte keine politische Elite geben wird. Auf dem Internet, das in dieser Arbeit keine Erwähnung findet, lagern auch große Hoffnungen, da dieses nahezu zensurfrei überall benutzbar ist. Auch die Parteien beginnen, sich verstärkt dieses Mediums zu bedienen.
8. Literatur / Quellen
[...]
1 M.Friedrichsen, ,,Im Zweifel für den Angeklagten", in: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid (Hg.), Wahlen und Wahlkampf in den Medien, Opladen 1996, S.46
2 vgl.: Elisabeth Noelle -Neumann, W. Schulz, J. Wilke (Hg.), Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation, Frankfurt/Main 1994, S.246ff
3 vgl.:Ulrich Sarcinelli ,,Wahlkampf", in:Uwe Andersen, Wichard Woyke (Hg.), Handbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1995, S.628
4 vgl.: Christina Holtz-Bacha, ,,Massenmedien und Wahlen. Zum Stand der deutschen Forschung - Befunde und Desiderate", in: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid (Hg.),Wahlen und Wahlkampf in Medien, Opladen 1996, S.14
5 Christina Holtz-Bacha, ,,Massenmedien und Wahlen. Zum Stand der deutschen Forschung - Befunde und Desiderate", in: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid (Hg.),Wahlen und Wahlkampf in Medien, Opladen 1996, S.14
6 vgl.: Christina Holtz-Bacha, ,,Massenmedien und Wahlen - Zum Stand der deutschen Forschung - Befunde und Desiderata", in: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee-Kaid (Hg.), Wahlen und Wahlkampf in den Medien, Opladen 1996, S.18
7 vgl. Hans-Dieter Klingemann, Max Kaase (Hg.), Wahlen und Wähler, Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1987, Opladen 1990, S.580
8 vgl. Ulrich von Alemann, ,,Die politischen Parteien, die Medien und das Publikum", in: http://www.fernuni-hagen.de/law/forum/alemann.html, 18.12.1999,19.25 Uhr
9 vgl. Ulrich von Alemann, ,,Die politischen Parteien, die Medien und das Publikum", in: http://www.fernuni-hagen.de/law/forum/alemann.html,18.12.1999,19.25 Uhr
10 vgl.:Birgit Rauen, ,,Berlusconi: Wahlkampf mit den eigenen Medien", in: Media Pespektiven 7/94, S.349-361
11 Winfried Schulz, Politische Kommunikation, Opladen 1997, S.24
12 vgl.:Winfried Schulz, Politische Kommunikation, Opladen 1997, S.25
13 Winfried Schulz, Politische Kommunikation, Opladen 1997, S.25
14 vgl.:Winfried Schulz, Politische Kommunikation, Opladen 1997, S.25
15 vgl.: Elisabeth Noelle -Neumann, Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie, Freiburg/Würzburg 1980
16 vgl.: Barbara Pfetsch u.a., Projekt" Kandidatenimages im Bundestagswahlkampf 1990" - Eine inhaltsanalytische Auswertung der tagesaktuellen Fernsehberichterstattung, Mannheim 1992. S.4 (ZUMA-Arbeitsbericht Nr. T92/12)
17 vgl.: Klaus Schönbach, Holli Semetko, ,,Medienberichterstattung und Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf 1990", in: Media Perspektiven 7/94, S.328
18 vgl.: Udo Krüger, Thomas Zapf-Schramm, ,,Fernsehwahlkampf 1998 in Nachrichten und politischen Informationssendungen", in: Media Perspektiven 5/99, S.223
19 vgl.: ARD/ZDF-Trend nach Camille Zubayr, Heinz Gerhard, ,,Wahlberichterstattung und Politikbild aus Sicht der Fernsehzuschauer", in: Media Perspektiven 5/99, S.223
20 vgl.:Brigitta Lutz, ,,Der Wahlkampf zur ersten freien Kommunalwahl in Leipzig 1990", in: Christine Holtz-Bacha, Die Massenmedien im Wahlkampf, Opladen 1993, S.90
21 vgl.: Klaus Kindelmann, Kanzlerkandidaten in den Medien, Opladen 1994, S.70-73
22 vgl.: Karl-Rudolf Korte, Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1999, S.107
23 vgl.: Hartmann von der Tann, Klaus Bresser, ,,Wahlberichterstattung 1998 bei ARD und ZDF -Ein Rückblick", in: Media Perspektiven 5/99, S.249
24 vgl.: David Paletz, Danielle Vinson, ,,Mediatisierung von Wahlkampagnen - Zur Rolle der amerikanischen Medien bei Wahlen", in: Media Perspektiven 7/1994, S.362-368
25 vgl.: Hans Kepplinger u.a., ,,Helmut Kohl und Oskar Lafontaine im Fernsehen", in: Christine Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid (Hg.), Die Massenmedien im Wahlkampf - Untersuchungen aus dem Wahljahr 1990, Opladen 1993, S.151
26 Hans Kepplinger, Markus Rettich, ,,Publizistische Schlagseiten", in Holtz-Bacha, Kaid (1996), S.85
27 vgl.: Udo Krüger, Thomas Zapf-Schramm (1999), S.224f
28 vgl.: David Paletz, Danielle Vinson (1994), S.363
29 vgl.: Krüger, Zapf-Schramm, (1999), S.228
30 vgl.: Krüger, Zapf-Schramm, (1999), S.235
31 vgl.: Schönbach, Semetko (1994), S.329
32 vgl.: Krüger, Zapf-Schramm (1999), S.225
33 vgl.: Marina Caspari u.a., ,,Bewertung politischer Akteure in Fernsehnachrichten", in: Media Perspektiven 5/1999, S.272
34 vgl.: Caspari u.a. (1999), S.273
35 M. Friedrichsen, ,,Im Zweifel für den Angeklagten", in: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid (Hg.), Wahlen und Wahlkampf in den Medien, Opladen 1996, S.49
36 M. Friedrichsen, ,,Im Zweifel für den Angeklagten", in: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid (Hg.), Wahlen und Wahlkampf in den Medien, Opladen 1996, S.49
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Medien im Wahlkampf, insbesondere im Hinblick auf Politikverdrossenheit, die Amerikanisierung des Wahlkampfs und das Verhältnis zwischen Medien, Politik und Wählern in Deutschland.
Welche Funktionen haben Medien und Wahlkampf laut der Arbeit?
Medien sollen in einer Demokratie Transparenz schaffen und den Kontakt zwischen Politikern und Bürgern ermöglichen. Wahlkämpfe dienen dazu, Bürger zu informieren und zu mobilisieren.
Welche Formen der Kommunikation zwischen Politik und Wahlpublikum werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen nichtmediatisierter, teilmediatisierter und vollmediatisierter Kommunikation.
Welche Modelle zur Bestimmung des Urhebers der politischen Agenda werden vorgestellt?
Es werden das Bottom-up-Modell, das Top-down-Modell und das Mediokratie-Modell vorgestellt.
Was besagt das Bottom-up-Modell?
Das Bottom-up-Modell geht davon aus, dass die politische Agenda vom Publikum bestimmt wird, welches die Medien nutzt, um die Politik zu beeinflussen.
Was besagt das Top-down-Modell?
Das Top-down-Modell geht von einer Hierarchie aus, in der die politische Agenda von den Politikern vorgegeben wird, die die Medien nutzen, um die Öffentlichkeit zu erreichen.
Was besagt das Mediokratie-Modell?
Das Mediokratie-Modell sieht die Medien als Hauptakteure, die die Realität beobachten, vereinfachen und an Politik und Wähler weitergeben.
Welche Thesen zur Beziehung zwischen Medien und Politik werden vorgestellt?
Es werden die Dependenzthese und die Instrumentalisierungsthese vorgestellt.
Was besagt die Dependenzthese?
Die Dependenzthese besagt, dass die Politik von den Medien abhängig ist.
Was besagt die Instrumentalisierungsthese?
Die Instrumentalisierungsthese besagt, dass die Medien von der Politik abhängig sind und von ihr instrumentalisiert werden.
Welchen Stellenwert hat der Wahlkampf in der Medienberichterstattung?
Der Wahlkampf ist zunächst nur von sekundärem Interesse und nimmt nur einen geringen Teil der tagesaktuellen Berichterstattung ein, besonders im Fernsehen.
Was bedeutet Amerikanisierung des deutschen Wahlkampfes?
Amerikanisierung des Wahlkampfes wird als Personalisierung, Mediatisierung und Professionalisierung des Wahlkampfes verstanden.
Was bedeutet Personalisierung des Wahlkampfes?
Personalisierung bedeutet die zunehmende Ausrichtung des Wahlkampfes an Personen, die im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen.
Was bedeutet Mediatisierung des Wahlkampfes?
Mediatisierung bedeutet die Orientierung der politischen Akteure an den Medien, um von deren Berichterstattung berücksichtigt zu werden.
Was bedeutet Professionalisierung des Wahlkampfes?
Professionalisierung bedeutet den zunehmenden Bedarf an Beratern, die die Vermarktung der Politik betreiben und Pseudoereignisse kreieren.
Was sind Pseudoereignisse?
Pseudoereignisse sind Ereignisse, die nicht stattfinden würden, wenn es keine Massenmedien gäbe, die darüber berichten, wie z.B. Pressekonferenzen und Demonstrationen.
Was sind mediatisierte Ereignisse?
Mediatisierte Ereignisse sind kommunikationsstrategisch überformte und eingerichtete Ereignisse, denen Medienaufmerksamkeit gewiss ist, wie z.B. Auslandsreisen.
Welche Elemente der Amerikanisierung des Wahlkampfes werden genannt?
Personalisierung der Kampagne, Wettstreit zwischen den Kandidaten, Angriffswahlkampf, Professionalisierung, Marketing-Ansatz, Ereignis- und Themenmanagement.
- Quote paper
- Benni Beilke (Author), 2001, Medien im Wahlkampf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106516