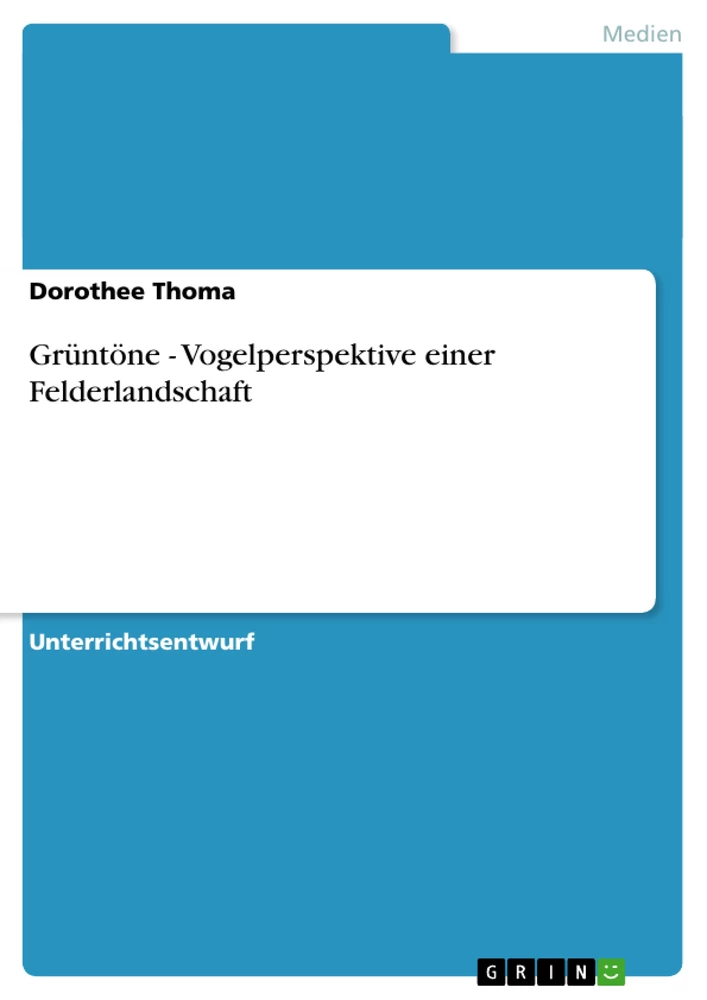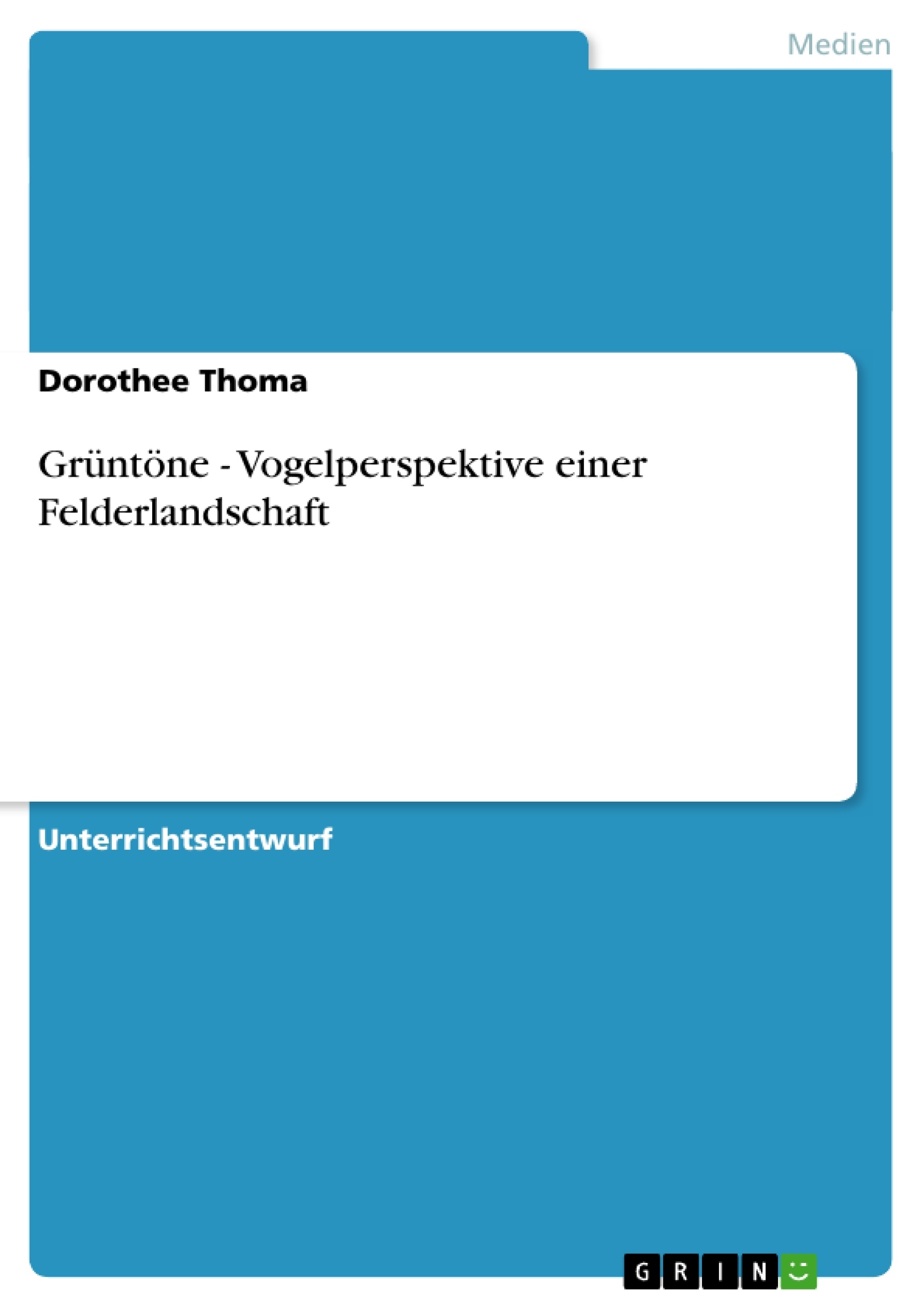Stell dir vor, du schwebst über einer Landschaft, ein Kaleidoskop aus Grüntönen breitet sich unter dir aus. Was wäre, wenn du diese Szene nicht nur betrachtest, sondern sie mit deinen eigenen Händen erschaffen könntest? Dieser umfassende Leitfaden für eine Kunststunde in der Grundschule (Klasse 4b) nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Farben, insbesondere in die faszinierende Vielfalt von Grün. Von der Analyse der Klassensituation und der spezifischen Voraussetzungen der Schüler bis hin zur detaillierten Sach- und didaktischen Analyse bietet dieses Buch eine fundierte Grundlage für einen kreativen und lehrreichen Unterricht. Erfahre, wie du Schüler für das Mischen von Farben begeistern kannst, indem du ihre Vorerfahrungen aktivierst und ihnen die Möglichkeit gibst, durch eigenes Experimentieren die Geheimnisse der Farbmischung zu entschlüsseln. Die methodische Analyse zeigt, wie du das Thema Felderlandschaft aus der Vogelperspektive nutzen kannst, um das Interesse der Kinder zu wecken und einen Bezug zu ihrer eigenen Erfahrungswelt herzustellen. Detaillierte Lernziele helfen dir, den Lernerfolg der Schüler zu überprüfen, während eine umfassende Liste von Medien und Arbeitsmitteln sowie ein Verlaufsplan die Umsetzung der Stunde erleichtern. Lass dich inspirieren und entdecke, wie du mit einfachen Mitteln und einer durchdachten Planung eine unvergessliche Kunsterfahrung für deine Schüler schaffst. Dieses Buch ist mehr als nur eine Unterrichtsvorbereitung; es ist eine Einladung, die Welt der Farben gemeinsam mit deinen Schülern neu zu entdecken und ihre Kreativität zu entfesseln. Der Fokus liegt auf dem praktischen Erleben und der Vermittlung von Wissen über Farbtheorie, Farbharmonie und Maltechniken, um die künstlerischen Fähigkeiten der Kinder zu fördern und ihre Wahrnehmung für die Schönheit der Natur zu schärfen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung des bildnerischen Denkens und der Entwicklung individueller Ausdrucksmöglichkeiten. Die Einbeziehung von Fotos und Beispielen aus der Kunstgeschichte rundet das Angebot ab und inspiriert zu eigenen kreativen Projekten.
Inhaltsverzeichnis
1. Analyse der Unterrichtsbedingungen
1.1 Situation der Klasse
1.2 Spezielle Voraussetzungen
2. Sachanalyse
3. Didaktische Analyse
4. Methodische Analyse
5. Lernziele
6. Medien und Arbeitsmittel
7. Verlaufsplan
8. Anlagen
8.1 Eigenes Bild
8.2 Foto: Faszination Kaiserstuhl: Oberrottweil
9. Literaturangaben
1. Analyse der Unterrichtsbedingungen:
1.1. Situation der Klasse:
In der Klasse 4b sind insgesamt 20 Schüler. Das Klima der Schüler untereinander ist, soweit ich es aus meinen bisherigen Beobachtungen beurteilen kann, gut. Die Mädchen und die Jun- gen sitzen im größten Teil getrennt voneinander, d.h. es gibt reine Jungen- und Mädchenrei- hen.
Das künstlerische und kreative Niveau der Klasse ist ins gesamt gesehen durchschnittlich. Die Mitarbeit der Mädchen ist wesentlich größer als die der Jungen.
Die Klasse kann man als sehr angenehm bezeichnen, da sie sich im Unterricht gut benimmt und auch versucht produktiv mitzuarbeiten. Bei den Schülern lässt sich Freude am Malen und Basteln erkennen. Sie haben einen relativ unbefangenen und spontanen Zugang zum Fach Kunst, probieren aus, sind begeisterungsfähig und befinden sich noch nicht in der Phase, in der die eigenen Werke sehr stark der eigenen Kritik, der Kritik der Gleichaltrigen und dem Vergleich "echter" Kunstwerke ausgesetzt sind. Bewertungen der Mitschüler wurden bisher immer als Anregung aufgenommen.
Trotz der allgemeinen Begeisterung beim Malen beobachtete ich im bisherigen Verlauf der Unterrichtseinheit, dass drei Schüler konkrete Anregungen und verstärkte Hilfestellungen brauchten, was sich vor allem auf das Motiv bezog, nicht so sehr auf den Umgang mit den Farben.
1.2. Spezielle Voraussetzungen
In den vorausgegangenen Stunden haben die Schüler Erfahrungen mit Primär- und Sekundär- farben gemacht, haben sich mit dem Mischen theoretisch und praktisch auseinandergesetzt (gerade auch beim "Regenbogen"). Sie kennen die Grundfarben und haben beim Regenbogen bereits die Farbe Grün aus Gelb und Blau gemischt, allerdings nur als einen Farbton.
Ich gehe davon aus, dass die Schüler ihr diesbezügliches Vorwissen reaktivieren können. Neu wird für die Schüler die Erfahrung, möglichst viele Grüntöne selbst mischen zu können und die Farbbestandteile der verschiedenen Grüntöne zunächst zu vermuten, wobei sie ihre Ver- mutungen durch die praktische Auseinandersetzung mit den Farben bestätigt sehen können.
Da die Schüler keine einheitlichen Schulmalfarben besitzen, werden aufgrund der unter- schiedlichen Ausgangsgrundfarben bereits verschiedene Grüntöne entstehen, auch wenn das Mischungsverhältnis bei allen Schülern gleich wäre.
Da kein wirklich zeichnerisches Motiv Gegenstand der Stunde ist, vermute ich, dass alle Schüler ein Erfolgserlebnis bei der Gestaltung ihrer Felderlandschaft haben werden.
2. Sachanalyse:
Farbe
Farben sind die unterschiedlichen Wellenlängen des sichtbaren Lichtes, die das Auge wahr- nimmt. Am Beispiel des Regenbogens kann man das ganze Farbspektrum gut verdeutlichen: Das Licht bricht sich in den Wassertropfen wie in einem Prisma und wird in die Spektralfar- ben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett zerlegt. Aus den drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau kann man alle Farben mischen. Darauf beruht der Vierfarbendruck in der Drucktechnik (die vierte Farbe ist Schwarz). Dadurch, dass die Lichtstrahlen bis auf eine Wellenlänge von einem Gegenstand absorbiert werden, erscheint es uns farbig. Ein grüner Gegenstand reflektiert zum Beispiel nur Licht im Wellenbereich grün, während das übrige Licht nicht zurückgeworfen wird. Es gibt auch Farben, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, zum Beispiel Ultraviolett und Infrarot. Alle Lichtstrahlen (und damit auch Farben) sind elektromagnetische Wellen. Farben sind bestimmt durch die Merkmale:
- Farbton
Durch das Mischen der Primärfarben erhält man alle anderen bunten Farben. Der Farbton (auch Farbrichtung oder Farbqualität genannt) ändert sich beim Herstellen von Mischfarben je nach Farbanteil der Primärfarben. So gibt Gelb und Blau Grün, wobei es eher ein Gelbgrün wird wenn der Gelbanteil stark überwiegt oder andernfalls eher ein Blaugrün.
- Helligkeit (Trübung)
Pawlik unterscheidet reinbunte Farben (als höchst intensive bunte Farben mit der größten Leuchtkraft) von den gedämpften (getrübten) Farben (Intensitätsminderung durch eine durch eine quantitative Veränderung in Richtung unbunter Farben durch Mischung mit Grau oder der Komplementärfarbe oder auch durch Aufhellung (Helltrübung) mit Weiß oder Dunkeltrü- bung mit Schwarz).
- Intensität
Sättigung, die veränderbar durch Mischung oder Verdünnung mit Wasser ist.
Grün
Blau und Gelb (die dunkelste und die hellste reinbunte Farbe) mischen sich zu grün. Somit ist Grün am ehesten mit dem Grau (Mischung der hellsten und dunkelsten unbunten Farbe) vergleichbar, da sie beide extreme Strahlen (langwellige und kurzwellige) ausgleichen. Grün besitzt einen mittleren Helligkeitsgrad, nach Pawlik wirkt es leicht kalt, da es zwischen der kältesten Farbe und Gelb (nicht die wärmste Farbe) steht. Farben können Empfindungen auslösen. Psychisch wirkt grün, als Hauptfarbe des vegetativen Lebens, entspannend. Bereits Goethe formulierte in seiner Farbenlehre, dass Grün dem Auge „reale Befriedigung“ schaffe, wenn Gelb und Blau im Gleichgewicht stünden.
3. Didaktische Analyse
Das Fach Bildende Kunst will das Kind befähigen, sich mit den vielfältigen bildnerischen Erscheinungsformen der vorgefundenen und von Menschen gestalteten Umwelt auseinander zusetzen. Diese werden insbesondere in den Gestaltungsweisen und Formen der Kunst erfahrbar. Grundlegendes Bildungsziel des Faches Bildende Kunst ist die Erziehung zu bildnerischem Denken, bei dem das Kind seine ihm eigenen Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Wirkungsmöglichkeiten entdecken kann. Sie werden durch Kunst- und Werkbetrachtung sowie entsprechende Wahrnehmungsübungen vertieft.
Farbe ist ein Urphänomen in der kindlichen Erlebniswelt. Kinder erfahren die Farbigkeit ihrer Umwelt auf verschiedenste Weise: als Farbe von Gegenständen, in ihrer symbolischen Bedeu- tung, in ihrem subjektiven Ausdruckscharakter und in ihrer Raumwirkung. In der 4.Klasse im Arbeitsbereich „Farbe“ lernen die Kinder das Anwenden verschiedener Maltechniken sowie den experimentellen Umgang mit farbigen Materialien und Objekten. Die Kinder setzen ab- sichtsvoll Farben ein, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Sie erfahren, dass durch eine Veränderung der Farbe eine Veränderung der Wirkung eintritt. Dabei entwickeln sie ein zu- nehmendes Interesse für Farbbewegung und differenzierte Farbverläufe. In der Unterrichts- einheit „Wahrnehmen und gezieltes Herstellen eines fein differenzierten Farbspektrums“ lernen die Kinder den Einfluss von Nachbarfarben, Farbbeschränkung, Farbton und Farbklang kennen. Sie lernen ausdehnen, sättigen und konstruieren von Farben, mischen, malen und collagieren mit verschiedenen Materialien.
Durch die tägliche Konfrontation mit unendlich vielen Farbtönen in ihrer Umwelt, aber auch durch teilweise breite Farbpaletten in den Farbkästen der Kinder, durch "fertige" Farben, erfahren Kinder nichts über die Herstellung von Farben. Sie sind gezwungen, Farben selbst zu mischen (durch das Reduzieren der Farben auf die Grundfarben, sowie Weiß und Schwarz) erfahren sie in der Regel eine große Faszination, dass sie selbst Farben herstellen und verändern können, ein größeres Spektrum an Farbtönen zur Verfügung haben und sie nehmen Farbtöne in ihrer Umwelt differenzierter wahr.
4. Methodische Analyse
Ich vermute, dass die Auswahl des Themas „ Felderlandschaft“ auf Interesse stößt, da viele Kinder ihre eigenen Erfahrungen mit dem „Blick aus einem Flugzeug“ bereits gemacht haben. Der Bezug zur Erfahrungswelt der Kinder ist gegeben, da viele von ihnen schon mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind, dort aus dem Fenster geschaut haben, und eine Felder- landschaft von oben gesehen haben. Es gibt sicherlich auch Kinder, die das noch nicht erlebt haben, jedoch eine Vorstellung haben, wie so etwas aussieht. Die Kinder, welche schon diese speziellen Erfahrungen gesammelt haben berichten dann kurz darüber. Kinder lernen von Kindern. Im übrigen habe ich auch ein Luftbild einer Felderlandschaft (Faszination Kaiser- stuhl: Oberrottweil) dabei, welches ich vor Beginn der praktischen Arbeit kurz zeigen werde.
In der Stunde wird das ästhetische Problem des Mischens bzw. Trübens von Grüntönen kom- biniert mit dem Tätigkeitsbereich des Malens mit Deckfarben. Der Aufbau der Stunde unter- teilt sich in die Einführung und Themenstellung, den Umgang mit den Farben und den Aus- tausch der Erfahrungen. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Farbe Grün sind konkrete Gegenstände in verschiedenen Grüntönen, die die Schüler an diesem Tag mitbringen sollen (und zu denen sie somit einen näheren Bezug haben). In einem Unterrichtsgespräch in der Einführungsphase sitzen die Schüler im Kreis, damit sie die Gegenstände in die Mitte (auf ein Tuch) legen können und bei der Demonstration des Vorgehens eine gute Sicht haben. Die Schüler sollen diese Gegenstände nach der Farbe ordnen. Es wird sich das Problem stellen, nach welchen Kriterien sich die grünen Gegenstände ordnen lassen. Es werden sich nicht alle Gegenstände linear nach Helligkeit ordnen lassen durch unterschiedliche Farbanteile z.b. von Weiß oder Gelb (Tönung, Trübung). Das Ziel dieses Gespräches ist es, dass die Schüler Ver- mutungen äußern, aus welchen Farben sich die verschiedenen Grüntöne zusammensetzen.
Erst nach dieser Auseinandersetzung mit verschiedenen Grüntönen gebe ich eine thematische Orientierung (Malen einer Felderlandschaft aus der Vogelperspektive). Ich zeige bewusst ein Beispiel einer Felderlandschaft „von oben“, da es mir nicht so sehr auf das gestalterische Prinzip der Felderlandschaft ankommt, sondern hauptsächlich auf das Mischen der verschie- denen Grüntöne.
Vor der eigenen praktischen Arbeit halte ich es für notwendig, dass das Vorgehen kurz de- monstriert wird, um auf einzelne Aspekte, wie z. B. Mischen (Mengen, Palette, Pinsel), Auf- tragen möglichst vieler Farbtöne auf das Papier, hinzuweisen und sie visuell zu verdeutlichen. Aus Zeitgründen habe ich die Palette mit den vier Farben bereits vorbereitet. Die Gegenstände bleiben während der praktischen Phase auf dem Tuch liegen, damit die Tische für die Arbeit frei sind.
In der praktischen Phase sollen die Kinder, die Mischungen selbst entdecken und erproben mit Farben experimentieren und möglichst viele Grüntöne herstellen, durch Tun lernen. In der Auswertungsphase sollen die Schüler über eigene Erfahrungen berichten, vor allem ob sich die Vermutungen vom Stundenbeginn über die Farbanteile der Grüntöne bestätigt haben.
5. Lernziele
Richtziele:
Die Schüler können grüne Gegenstände nach Helligkeit oder Tönung ordnen, mit Wasserfarben selbst verschiedene Grüntöne herstellen, indem sie die Primärfarben Gelb und Blau in unterschiedlichem Verhältnis mischen und (mit Schwarz oder Weiß) trüben und kennen Farbbestandteile unterschiedlicher Grüntöne.
Grob- und Feinziele:
- Die Schüler können verschiedene Grüntöne differenziert wahrnehmen
- Die Schüler erkennen die Probleme, verschiedene Grüntöne nach einem Kriterium (z.b. Helligkeit, Tönung) zu ordnen, indem sie grüne Gegenstände nach der Farbe sor- tieren
- Die Schüler können aus den Primärfarben Gelb und Blau sowie durch Trübung ver- schiedene Grüntöne herstellen
- Die Schüler erkennen, dass sich durch das Ineinanderfließen der Grüntöne an den Ü- bergängen neue Grüntöne von selbst ergeben (Nass-in-Nass-Technik)
- Die Schüler können Farbanteile der verschiedenen Grüntöne benennen.
6. Medien und Arbeitsmittel
- eigene grüne Gegenstände der Kinder
- weißes Tuch
- Foto von einer Felderlandschaft „Faszination Kaiserstuhl: Oberrottweil“
- weißes DIN A3 Papier
- Schulmalfarben (flüssig): Gelb, Blau, Weiß, Schwarz
- Misch-Palette
- Pinsel
- Wasserbehälter
- weiße Kärtchen (zur Differenzierung)
7. Verlaufsplan
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. Anlagen
8.1. Eigenes Bild (liegt bei)
8.2. Foto: Faszination Kaiserstuhl (liegt bei)
9.Literaturliste
Bildungsplan für Kultur und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.): Bildungsplan für die Grund- schule Aissen-Crewett, Meike: Kunstunterricht in der Grundschule. Braunschweig 1992. Klettenheimer, Ingrid: Themenbuch für die Grundschulpraxis. Dietzenbach 1992. Pawlik, Johannes: Theorie der Farbe. Köln 1979.
Schneider, F.: Jugend-Lexikon A- [bis] Z. München 1987 Internet
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Analyse eines Unterrichtsentwurfs für den Kunstunterricht in der Grundschule, speziell zum Thema "Farbe" und der Herstellung von Grüntönen. Es beinhaltet eine Analyse der Unterrichtsbedingungen, eine Sachanalyse, eine didaktische Analyse, eine methodische Analyse, Lernziele, Medien und Arbeitsmittel, einen Verlaufsplan und eine Literaturliste.
Was beinhaltet die Analyse der Unterrichtsbedingungen?
Die Analyse der Unterrichtsbedingungen beschreibt die Situation der Klasse, einschließlich der Anzahl der Schüler, des sozialen Klimas, des künstlerischen Niveaus und der Mitarbeit. Sie geht auch auf spezielle Voraussetzungen der Schüler bezüglich ihres Vorwissens über Farben und das Mischen ein.
Was ist der Inhalt der Sachanalyse?
Die Sachanalyse erklärt die Grundlagen der Farbenlehre, insbesondere die Entstehung von Farben, die Bedeutung von Primär- und Sekundärfarben sowie die Eigenschaften von Farben wie Farbton, Helligkeit und Intensität. Sie fokussiert sich speziell auf die Farbe Grün und ihre Eigenschaften.
Was wird in der didaktischen Analyse behandelt?
Die didaktische Analyse erläutert die übergeordneten Bildungsziele des Fachs Bildende Kunst und die Bedeutung des Umgangs mit Farbe in der kindlichen Entwicklung. Sie beschreibt, wie Kinder im Arbeitsbereich "Farbe" verschiedene Maltechniken erlernen und einen experimentellen Umgang mit farbigen Materialien und Objekten entwickeln.
Was wird in der methodischen Analyse besprochen?
Die methodische Analyse beschreibt die konkrete Umsetzung des Unterrichtsentwurfs, einschließlich der Auswahl des Themas "Felderlandschaft", der Einbeziehung der Erfahrungswelt der Kinder, des Ablaufs der Stunde (Einführung, Umgang mit Farben, Austausch der Erfahrungen) und der eingesetzten Methoden (Unterrichtsgespräch, Demonstration, praktische Arbeit).
Welche Lernziele werden formuliert?
Es werden Richtziele, Grob- und Feinziele formuliert. Die Schüler sollen grüne Gegenstände nach Helligkeit oder Tönung ordnen können, mit Wasserfarben selbst verschiedene Grüntöne herstellen, indem sie die Primärfarben Gelb und Blau in unterschiedlichem Verhältnis mischen und (mit Schwarz oder Weiß) trüben, sowie die Farbbestandteile unterschiedlicher Grüntöne kennen.
Welche Medien und Arbeitsmittel werden verwendet?
Zu den verwendeten Medien und Arbeitsmitteln gehören u.a. eigene grüne Gegenstände der Kinder, ein weißes Tuch, ein Foto von einer Felderlandschaft, weißes DIN A3 Papier, Schulmalfarben (flüssig): Gelb, Blau, Weiß, Schwarz, eine Misch-Palette, Pinsel, Wasserbehälter und weiße Kärtchen.
Was beinhaltet der Verlaufsplan?
Der Verlaufsplan (nicht im Detail wiedergegeben, da er als Abbildung vorliegt) skizziert den zeitlichen Ablauf der Unterrichtsstunde und die einzelnen Phasen (Einführung, Arbeitsphase, Auswertung) mit den jeweiligen Aktivitäten.
Welche Literatur wird angegeben?
Es wird eine Liste von Fachbüchern und anderen Quellen (Bildungsplan, Lexika, Internetquellen) angegeben, die für die Erstellung des Unterrichtsentwurfs verwendet wurden.
- Quote paper
- Dorothee Thoma (Author), 2002, Grüntöne - Vogelperspektive einer Felderlandschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106460