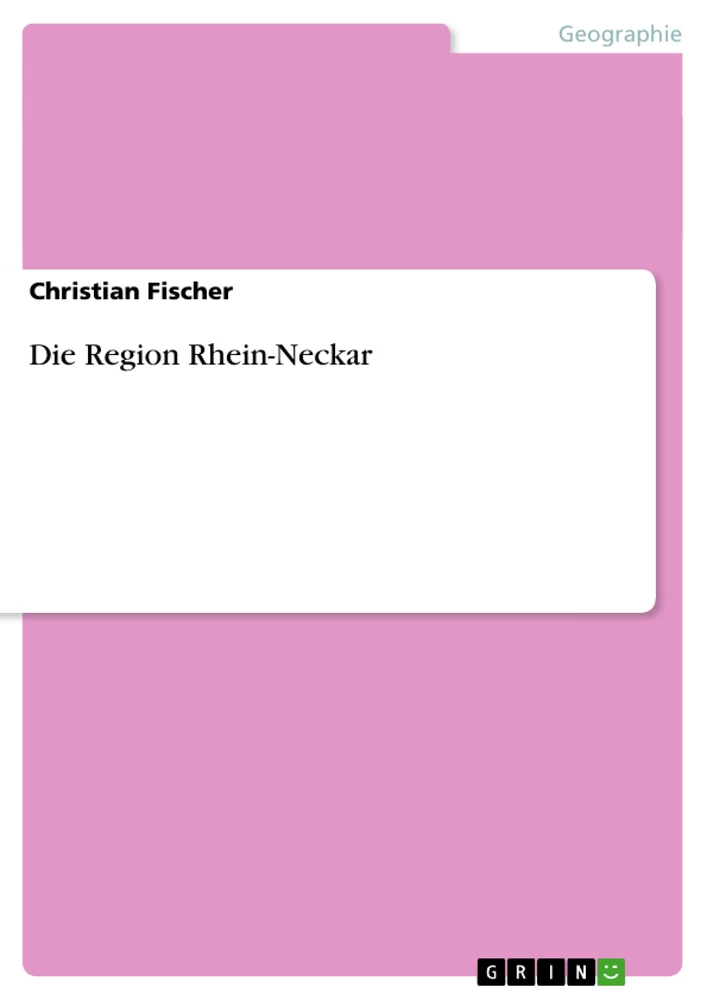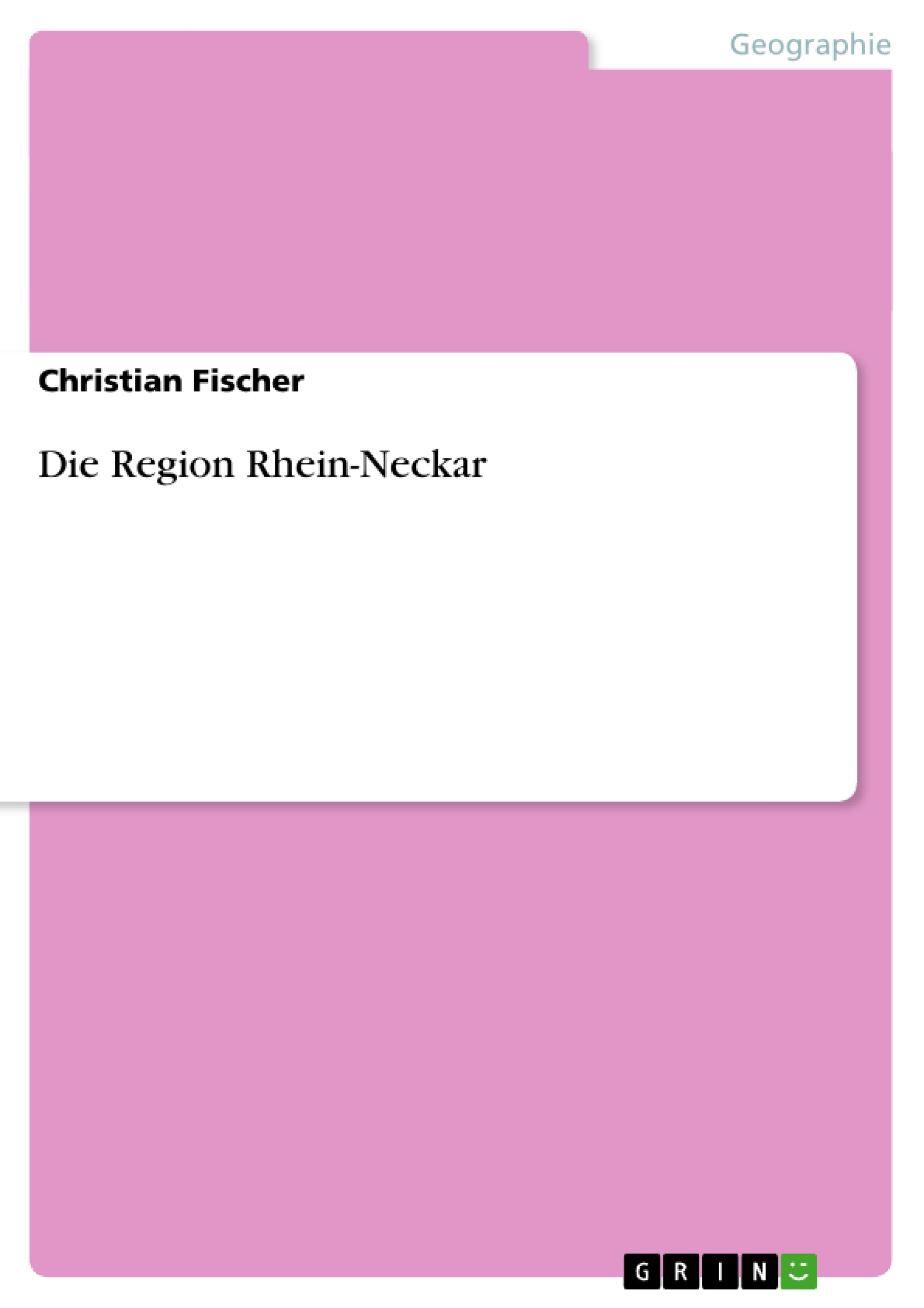1. Die Region Rhein-Neckar
Die Region Rhein-Neckar liegt im Oberrheingraben mit der Mündung des Neckars in den Rhein als ungefährer Mittelpunkt. Im Norden grenzt das Ballungsgebiet Rhein-Main und im Süden der Karlsruher Raum an. Flankiert wird die Region von den Naturparken Odenwald im Osten und Pfälzerwald im Westen (siehe Abb. 1). Diese Region ist gekennzeichnet durch seine polyzentrische Struktur mit drei fast gleichgewichtigen Kernstädten (Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg), sowie einer Reihe von Mittelzentren, wie etwa Worms, Frankenthal, Speyer auf der linken Rheinseite und Heppenheim, Weinheim, Schwetzingen, Wiesloch, Sinsheim, Eberbach auf der rechten Rheinseite (siehe auch: Karte im Aushang).
Der Raumordnungsverband Rhein-Neckar (kurz: Raumordnungsverband) umfasst eine Fläche von 3.324,64 km² und hat 1.907.766 Einwohnern. Weitere Strukturdaten können der Tabelle 1 im Anhang entnommen werde. [Raumordnungsverband Rhein-Neckar, 2000, S.1ff]
Abb.1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Karte der Region Rhein-Neckar [aus Internetquelle 1]
Verschiedenste administrative Grenzen zerschneiden das Gebiet des
Raumordnungsverbandes, darunter elf Stadt- und Landkreise, drei Regierungsbezirke, drei Länder, zahlreiche Gemeinden und unterschiedlichste Behördenzuständigkeiten (siehe auch Abb.3 im Anhang). [Fürst; Müller; Schefold, 1994, S.65]
2. Vorgeschichte und Gründung des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar
Um die Entwicklung des Raumordnungsverbandes darzustellen, ist ein Blick weit in die Geschichte notwendig. So umfasst das Gebiet des Raumordnungsverbandes historisch gesehen das Kerngebiet der alten Kurpfalz, mit einer 600jährigen Geschichte, die durch die napoleonischen Kriege und die darauffolgende Neuordnung durch den Wiener Kongresses von 1814/15 mit der Auflösung der Kurpfalz beendet wurde. Seitdem wird die ehemalige Kurpfalz von Ländergrenzen durchschnitten. [Batt, 1994, S. 39f]
Diese Situation änderte sich auch nicht nach den 1. Weltkrieg und der Ländergliederung durch die Weimarer Verfassung. Bereits in dieser Zeit gab es Diskussionen über die Zusammenarbeit in den entstandenen Ballungsräumen. Besonders die Landesgrenze zwischen Ludwigshafen und Mannheim wurde als hinderlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Region gesehen. Sämtliche Initiativen zur Schaffung überkommunaler Strukturen konnten jedoch aufgrund disparater Länder- und Parteiinteressen nicht verwirklicht werden.
Auch nach der Neuordnung der Länder nach dem 2. Weltkrieg blieb der Ballungsraum Rhein- Neckar in seiner Drei-Länder-Lage. Jedoch konnte bereits 1951 mit der Gründung der ,,Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar GmbH" (KAG) 1951 eine erste Lösung auf kommunaler Ebene unter Beteiligung der Städte Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, der Landkreise Ludwigshafen und Heidelberg und der Stadt Viernheim gefunden werden. Interessanter Weise wurde hier bereits eine privatwirtschaftliche (GmbH) Lösung gewählt.
Aus der KAG entstand am 30.4.1970 durch einen Staatsvertrag der Länder Baden- Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz der ,,Raumordnungsverband Rhein-Neckar". [Raumordnungsverband Rhein-Neckar , 1995, S.5ff]
3. Innere Struktur und Aufgaben des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar
Bei dem Raumordnungsverband handelt es sich um einen Zweckverband, der nach dem baden-württembergischen Zweckverbandsrecht gereget ist. Für die inhaltliche Arbeit gilt das Raumordnungsgesetz sowie die Landesplanungsgesetze der beteiligten Länder. Hauptaufgabe ist die Aufstellung und Fortschreibung eines verbindlichen Raumordnungsplanes als Rahmen für die Regionalplanung in den dreibeteiligten Regionen, sowie dessen Durchsetzung und Vertretung nach innen und außen.
Die Regionalplanung ist dabei zweistufig organisiert, der Raumordnungsverband erstellt einen verbindlichen Rahmenplan, die eigentlichen Regionalplanung übernehmen nach den jeweiligen Landesregeln die landesgebundenen Verbänden Regionalverband Unterer Neckar und Planungsgemeinschaft Rheinpfalz. Organisatorisch wird dies erleichtert, da sowohl der Regionalverband Unterer Neckar und die Planungsgemeinschaft Rheinpfalz ihre Verwaltungs- und Planungsaufgaben durch den Raumordnungsverband erledigen lassen.
Zusätzlich ist der Verbandsdirektor des Raumordnungsverbandes zugleich in Personalunion Direktor dieser beiden Verbände. Die etwas unübersichtliche Struktur wird an dem Organigramm (Abb. 2 und Abb. 4+5 im Anhang) deutlich. [Fürst; Müller; Schefold, 1994, S.65f]
Abb. 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Organigramm des Raumordnungsverbandes Rhein Neckar (aus Raumordnungsverband)
Da die Mitglieder des Raumordnungsverbandes nur Verbände (Ausnahme Kreis Bergstraße) sind, erfolgt die politische Kontrolle und Beschlussfassung nur mittelbar durch die beiden Unterverbä nde. Diese Entsenden insgesamt 66 Mitglieder in die Verbandsversammlung, die nach den jeweiligen Kommunalwahlen neu besetzt werden.
Die Anzahl der jeweils zu entsendenden Mitglieder richtet sich nach der Einwohnerzahl. Die Verbandsversammlung wählt einen Verwaltungsrat und einen Planungsausschuss sowie den Verbandsvorsitzenden. Die Verwaltung wird von einem hauptamtlichen Verbandsdirektor geführt (siehe Abb. 2). [Gemeinsame Landesplanung Bremen/ Niedersachsen, 1994, S.71]
Eine Schiedsfunktion übernimmt eine eigens eingerichtete Raumordnungskommission, die sich aus den Leitern der obersten Landesplanung der drei Länder zusammensetzt.
Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage auf die drei Verbandsmitglieder, die sich jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraft der Gemeinden richtet. Die zusätzlichen Kosten für die Übernahme der Verwaltungsaufgaben für den Regionalverband Unterer Neckar und die Planungsgemeinschaft Rheinpfalz werden von diesen übernommen. [Raumordnungsverband Rhein-Neckar , 1995, S.18]
Der Raumordnungsverband hat zur Zeit rd. 35 Mitarbeiter. [Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen, 1994, S.70]
Weitere Planungsaufgaben sind:
- das einheitliche regional Gesamtverkehrssystem
- einheitliche Maßstäbe für die Funktionsbestimmung zentraler Orte
- die Abgrenzung von Siedlungsräumen und zu schützenden Freiräumen
- Vorrangbereiche für regional bedeutsame Raumnutzung der Schutz der Rheinauenlandschaft und sonstiger markanter Landschaftsformen
- Standorte und Trassen für gesamträumlich bedeutsame Projekte (Hochwasser- Rückhalträume, Schnellbahntrasse Paris-Mannheim)
- Standortsicherung für regionale Ver- und Entsorgungssysteme · Wirtschaftsförderung und Standortmarketing
- Regionalmanagement [Raumordnungsverband Rhein-Neckar, 2000, S.7f und Raumordnungsverband Rhein-Neckar , 1995, S.16]
Diese Aufgaben werde zum Teil von eigens gegründeten oder mitgegründeten Zweckverbänden und Vereinen übernommen, die im nächsten Punkt vorgestellt werden.
4. Weitere regionale Kooperationen
Zweckverband Abfallwirtschaft Rhein-Neckar (ZARN) / Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (GML)
Seid 1985 besteht der Zweckverband Abfallwirtschaft Rhein-Neckar und umfast die Städte Mannheim und Heidelberg, sowie den Rhein-Neckar-Kreis. Der Raumordnungsverband leistet dabei Planungs- und Verwaltungshilfe, indem die Geschäftsstelle der ZARN dort angesiedelt wurde. In der GML haben sich die Städte Worms, Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer sowie die Landkreise Ludwigshafen und Bad Dürkheim zusammen- geschlossen. [Internetquelle 2 ] Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Dieser Verband wurde 1984 gegründet, Vorläufer war die 1973 gegründete Nahverkehrsgemeinschaft Rhein-Neckar. Dieser Zweckverband organisiert und plant einen Verbund von 17 Nahverkehrsunternehmen mit einem verknüpften Strecken- und Liniennetz, abgestimmten Fahrplan und Betrieb, sowie einheitlichem Tarifsystem.
Auch hier findet die organisatorische Verknüpfung über eine Personalunion der Verbandsdirektoren und die Übernahme der Geschäftsstellentätigkeit statt. Mittlerweile ist das Gebiet des VRN über das eigentliche Gebiet des Raumordnungsverbandes hinausgewachsen (siehe Karte Aushang). [Raumordnungsverband Rhein-Neckar , 1995, S.19ff] Arbeitskreis Rhein -Neckar-Dreieck e.V.
Der Arbeitskreis wurde 1989 gegr ündet und ist ein gutes Beispiel für public -private- partnership. Die Aufgabe des Vereins sind u.a. Imagepflege, Standortmarketing, Verkehrsplanung, Gewerbeflächenbereitstellung und -recycling. Er wird von den Kommunen, den Kammern, dem Raumordnungsverband und der Wirtschaft gemeinsam getragen, insgesamt 67 Mitglieder und sein Gebiet ist ebenfalls größer als das des Raumordnungsverbandes (Abb. 6 im Anhang). Auch hier werden Personal und Räumlichkeiten von dem Raumordungsverband zur Verfügung gestellt, die Geschäftführung übernimmt ein von der BASF abgestellte Arbeitskraft. 1992 hatte der Verein über 1 Millionen DM für seine Arbeit zur Verfügung. [Batt, 1994, S.39-65]
5. Stärken / Schwächen und zukünftige Entwicklung
Schwächen:
- hohe Gremienzahl, die jedoch durch die einheitliche Koordinierung des Raumordnungsverbandes relativiert wird.
- drei Ländergrenzen mit unterschiedlich starker Betroffenheit der Länder (insbesondere Hessen)
- sehr starke Stellung der Verbandsdirektors durch die verschiedenen Personalunionen und damit Abhängig von den handelnden Personen (Stärke oder Schwäche?)
- durch den Staatsvertrag dreier Länder hohe Hürde für Erweiterung und Satzungsänderungen
Stärken:
- Konzentration vieler Aufgaben auf eine Geschäftsstelle (Minimierung des Koordinationsaufwandes)
- Gute Personal und finanzielle Ausstattung, die einen hohen Professionalisierungsgrad garantiert
- leichte Erweiterbarkeit der Organisation, Modularer Aufbau
- kontinuie rliche Arbeit durch einen nur mittelbaren politischen Einfluss [Fürst; Müller; Schefold, 1994, S. 73ff]
In Zukunft wird der Raumordnungsverband sicherlich seine Starke Rolle in der Region behalten und sowohl regional, als auch sachlich Ausbauen. So wird bereits jetzt der NeckarOdenwald-Kreis als ,,als-ob" Mitglied behandelt, auch wenn die vertragliche Integration noch an der hohen Hürde des Staatsvertrages scheitert. Auch weitere sachliche Aufgaben werden hinzukommen, so ist bereits die Ausweitung der Vereinsarbeit durch den Arbeitskreis RheinNeckar-Dreieck e.V. geplant.
Insgesamt ist der Raumordnungsverband Rhein-Neckar ein sehr gutes Beispiel für eine enge regionale Kooperation, die eher auf personeller Überschneidung als auf festen Strukturen beruht und daher die Hoheitsrechte der Länder unangetastet, insgesamt aber eine Regionalplanung aus einem Guss entstehen lässt.
Literatur
- Batt, Helge -Lothar (1994): Kooperative regionale Industriepolitik: prozessuales und
institutionelles Regieren am Beispiel von fünf regionalen Entwicklungsgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main
- Fürst, D.; Müller, B.; Schefold, D. (1994): Gemeinsame Landesplanung
Bremen/Niedersachen. Weiterentwicklung der gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachen. Nr. 2-94. Hannover, Bremen
- Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen (1994): Gemeinsame Landesplanung
Bremen/Niedersachen. Regionale Entwicklungsstrategien. Dokumentation des Workshops am
26.April 1993. Nr.3-94. Hannover, Bremen
- Raumordnungsverband Rhein-Neckar (1995): Der Raumordnungsverband Rhein-Neckar. Mannheim
- Raumordnungsverband Rhein-Neckar (2000): 30 Jahre Raumordnungsverband Rhein- Neckar. Regionalentwicklung im Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz. Schriftenreihe des Raumordnungsverbandes Rhein Neckar, Heft 17. Mannheim
Internetquellen:
1. http://www.region-rhein-neckar-dreieck.de/region/region.html (5.2.2002)
2. http://www.region-rhein-neckar-dreieck.de/abfall/abfall_r.html (5.2.2002)
3. http://www.region-rhein-neckar-dreieck.de/fakten/beschaeftigte.html (5.2.2002)
4. http://www.region-rhein-neckar-dreieck.de/wir/raumordnung_r.html (5.2.2002)
5. http://www.region-rhein-neckar-dreieck.de/fakten/wirtschaftskraft.html (5.2.2002)
6. http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB/ (5.2.2002)
7. http://www.hsl.de/Abt-p/kreiszahlen/hkr_bev%F6lkerung.htm (5.2.2002)
8. http://www.statistik.rlp.de/bevoelkerung/bevbodennutz.html (5.2.2002)
Anhang
Abbildung Titel: aus Internetquelle 1
Tab.1: Strukturdaten des Raumordnungsverbandes Rhein Neckar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ROV- Gebiet 154 1.907.766 3.324,64 651.049 49.126**
insgesamt
-in DM ** Bundesgebiet (alt): 44.988
Quellen:
Internetangebot des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar, sowie der Statistischen Landesämter Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vom 5. Februar 2002. Internetquellen 3-8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3
Kommunale Gliederung des Raumordnungsverbandes [aus Raumordnungsverband Rhein-Neckar,1995, S.23]
Abb. 4
Organigramm der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz
[ aus Raumordnungsverband Rhein-Neckar ,1995, Beilage]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5
Organigramm des Regionalverbands Unterer Neckar
[aus Raumordnungsverband Rhein-Neckar ,1995, Beilage]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6
Regionales Umfeld des Raumordnungsverbandes
Frequently Asked Questions
What is the Rhein-Neckar region?
The Rhein-Neckar region is located in the Upper Rhine Plain, centered around the confluence of the Neckar and Rhine rivers. It is bordered by the Rhine-Main metropolitan area to the north and the Karlsruhe region to the south. The Odenwald and Palatinate Forest nature parks flank the region to the east and west, respectively. The region is characterized by a polycentric structure with three core cities (Mannheim, Ludwigshafen, and Heidelberg) and several medium-sized centers.
What is the Raumordnungsverband Rhein-Neckar?
The Raumordnungsverband Rhein-Neckar (Regional Planning Association Rhein-Neckar) is a regional planning association that covers an area of 3,324.64 km² and has 1,907,766 inhabitants. It is responsible for regional planning and coordination in the Rhein-Neckar region.
What were the historical origins of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar?
The area of the Raumordnungsverband historically encompassed the core area of the old Electoral Palatinate (Kurpfalz), a region with 600 years of history that was dissolved during the Napoleonic Wars and the subsequent reorganization by the Congress of Vienna in 1814/15. Since then, the former Kurpfalz has been divided by state borders.
When was the Raumordnungsverband Rhein-Neckar established?
The Raumordnungsverband Rhein-Neckar was established on April 30, 1970, through a state treaty between the states of Baden-Württemberg, Hesse, and Rhineland-Palatinate. It evolved from the "Kommunale Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar GmbH" (KAG), founded in 1951.
What are the main tasks of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar?
The main tasks of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar include: developing and updating a binding regional development plan, implementing and representing the plan internally and externally, ensuring a uniform regional transportation system, establishing standards for the functional classification of central places, defining settlement areas and protected open spaces, prioritizing areas for regionally significant land use, protecting the Rhine meadow landscape and other prominent landscape features, securing locations and routes for supra-regional projects, promoting economic development and location marketing, and regional management.
How is regional planning organized in the Rhein-Neckar region?
Regional planning is organized in two stages. The Raumordnungsverband creates a binding framework plan, and the actual regional planning is carried out by the state-affiliated associations Regionalverband Unterer Neckar and Planungsgemeinschaft Rheinpfalz, according to the respective state regulations.
What other regional cooperations exist in the Rhein-Neckar region?
Several other regional cooperations exist, including the Zweckverband Abfallwirtschaft Rhein-Neckar (ZARN) / Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (GML) for waste management, the Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) for public transportation, and the Arbeitskreis Rhein-Neckar-Dreieck e.V. for image cultivation, location marketing, traffic planning, and providing and recycling commercial space.
What are the strengths of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar?
The strengths of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar include: concentrating many tasks in one office (minimizing coordination effort), good staffing and financial resources (guaranteeing a high degree of professionalization), easy expandability of the organization (modular structure), and continuous work through only indirect political influence.
What are the weaknesses of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar?
The weaknesses of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar include: a high number of committees (although this is relativized by the unified coordination of the Raumordnungsverband), three state borders with varying degrees of involvement of the states (especially Hesse), a very strong position of the association director through the various personal unions (strength or weakness?), and high hurdles for expansion and statute amendments due to the state treaty of three states.
What is the future development of the Raumordnungsverband Rhein-Neckar?
In the future, the Raumordnungsverband will likely maintain its strong role in the region and expand both regionally and functionally. Further tasks will be added, such as expanding the work of the Arbeitskreis Rhein-Neckar-Dreieck e.V.
- Quote paper
- Christian Fischer (Author), 2002, Die Region Rhein-Neckar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106450