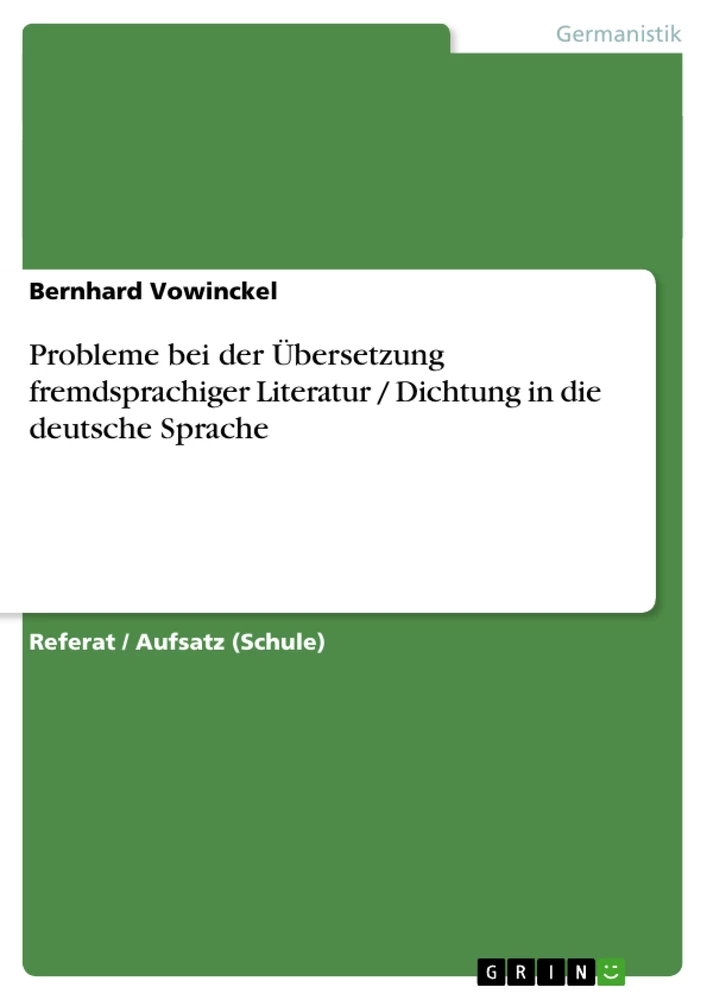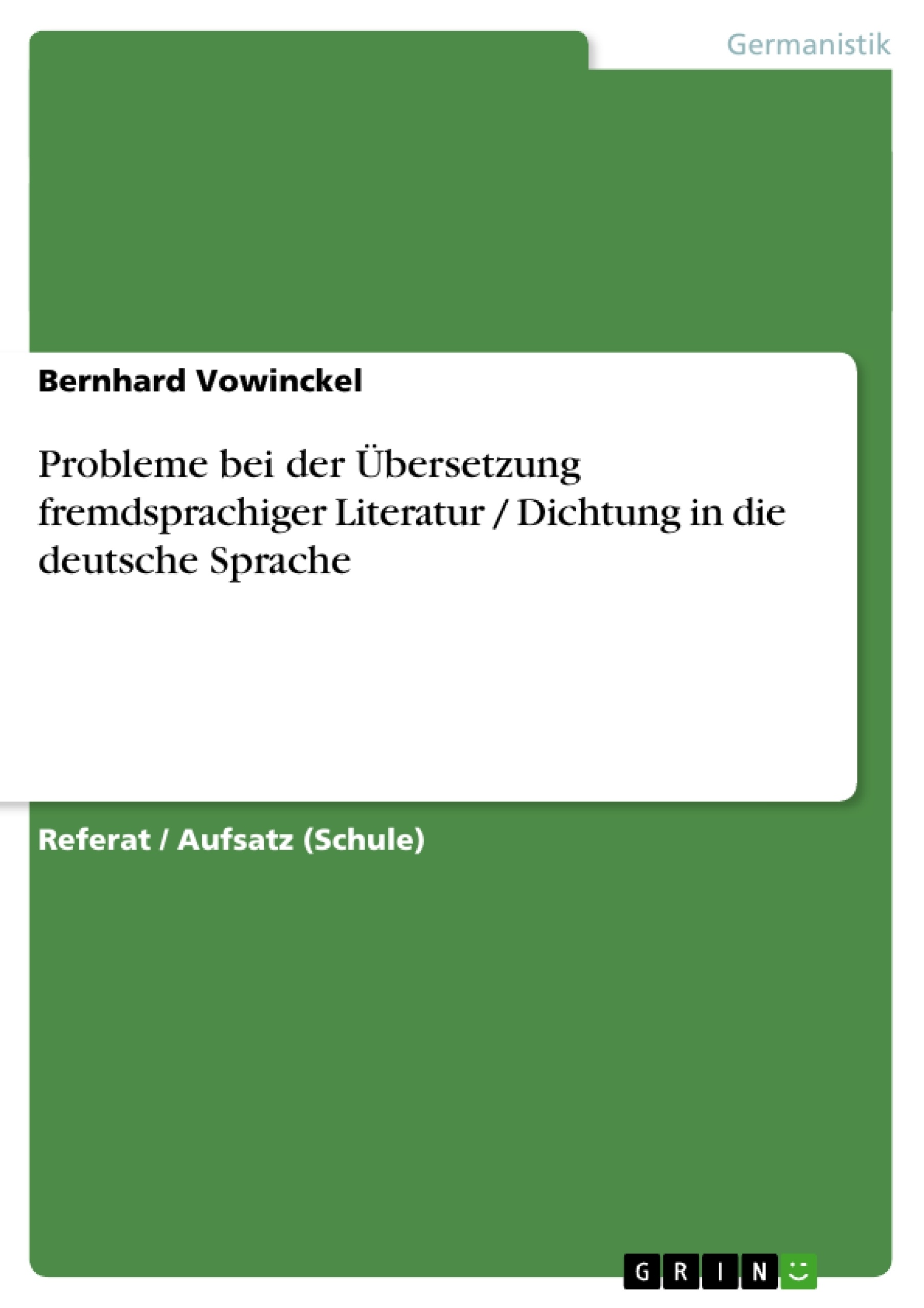Stellen Sie sich vor, Sie tauchen ein in die Welt Shakespeares, aber irgendetwas ist anders. Irgendetwas fehlt. Ist es der Zauber der Originalsprache, der auf der Strecke bleibt, wenn wir uns auf Übersetzungen verlassen? Diese Frage steht im Zentrum einer faszinierenden Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und der Kunst der literarischen Übersetzung, insbesondere am Beispiel von Shakespeares zeitlosen Werken. Die Analyse beleuchtet die vielschichtigen Probleme, die sich bei der Übertragung von Stil, Verskunst, Sprachwitz und kulturellen Nuancen stellen, und untersucht, wie Übersetzer im Laufe der Jahrhunderte versucht haben, diese Klippen zu umschiffen. Von den ersten, eher prosaischen Annäherungen bis hin zu den poetischen Meisterleistungen Schlegels und den modernen, interpretationsfreudigeren Ansätzen Erich Frieds wird ein Spannungsfeld zwischen Werktreue und künstlerischer Freiheit erkundet. Es geht um mehr als nur die korrekte Wiedergabe von Worten; es geht um die Bewahrung des Geistes, des Tons und der Wirkung, die Shakespeare selbst beabsichtigte. Das Buch wirft ein Licht auf die unvermeidlichen Kompromisse, die jeder Übersetzer eingehen muss, und zeigt, wie subjektive Entscheidungen, sprachhistorische Veränderungen und sogar der Zeitgeist die Interpretation und Rezeption eines literarischen Meisterwerks beeinflussen können. Es ist eine Einladung, die oft übersehene Kunst der Übersetzung neu zu bewerten und die Leistungen derer zu würdigen, die uns den Zugang zu fremdsprachigen Welten ermöglichen, ohne dabei die Fallstricke und Tücken dieses anspruchsvollen Handwerks auszublenden. Eine unverzichtbare Lektüre für Literaturwissenschaftler, Shakespeare-Liebhaber und alle, die sich für die feinen Unterschiede und die kreative Kraft der Sprache interessieren, sowie für die Übersetzung von Dramen, Lyrik und Weltliteratur. Entdecken Sie die verborgenen Facetten der Shakespeare Übersetzung und die Kunst, sprachliche und kulturelle Brücken zu bauen. Tauchen Sie ein in die Welt der Literaturanalyse und erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Sprachwissenschaft und Übersetzungstheorie.
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG
2. DEFINITION: ÜBERSETZUNG
3. DARSTELLUNG DER PROBLEME
3.1 Anforderungen an die Fähigkeiten des Übersetzers
3.2 Bewahrung des Original - Stils
3.3 Bewahrung der Verstechnik
3.4 Sprachhistorische Probleme
3.5 Traditionsproblematik des Übersetzens
4. PROBLEMLÖSUNGEN
4.1 Schlegels Übersetzungskonzeption
4.2 Frieds Übersetzungskonzeption
5. ZUSAMMENFASSUNG
6. LITERATURVERZEICHNIS
Anhang 1: Original und Übersetzungsbeispiele aus: Was Ihr Wollt
1. Einleitung und Aufgabenstellung
Aufgrund des neuen Lehrplanes für das Schuljahr 2000/2001 besteht die Möglichkeit, im Deutschunterricht Übersetzungen fremdsprachiger Literatur zu behandeln. Unser Deutschkurs hat sich für die Komödie „Was Ihr Wollt“ von William Shakespeare entschieden.
Da man im Deutschunterricht eine deutschsprachige Übersetzung des Literaturstückes benutzt und nicht den Originaltext zur Verfügung hat, muss man sich bewusst machen, dass die Analyse und Interpretation des Textes Probleme birgt, die ohne Vergleich des Originaltextes mit der Übersetzung nicht unmittelbar erkennbar sind. Eine deutsche Version eines fremdsprachigen Textes spiegelt nicht nur den Stil des Autors wieder, sondern sie enthält zusätzlich Interpretationen von einem Zweiten, dem Übersetzer. Dass dabei Differenzen zwischen der Übersetzung und dem Original entstehen können sieht man allein schon daran, wie stark verschiedene, aus unterschiedlichen Zeitepochen stammende Übersetzungen eines bestimmten Textes voneinander abweichen können (siehe Anhang 1).
Im folgenden soll dargestellt werden, welche Probleme bei Übersetzungen von fremdsprachiger Literatur allgemein, insbesondere von Shakespeares Werken auftreten, und wie einzelne Autoren und Übersetzer diese Probleme gelöst haben.
2. Definition: Übersetzung
Übersetzen, oder genauer gesagt das literarische Übersetzen ist „...das Nocheinmalschaffen eines Wortkunstwerkes in und aus einem andern Sprachmaterial...“ (siehe 5./ Hans Albrecht Kock: Gedenkschrift Ernst Sander S.47).
Dieser Vorgang an sich ist sehr differenziert und wird in mehreren Stufen vollzogen.
Die erste Stufe des Übersetzens kann als rein technisches Verfahren angesehen werden. Eine Übersetzung dieser Art kommt dem einfachen Dekodieren sehr nahe, und hat nur das eine Ziel, den wörtlichen Sinn des Textes zu erhalten. Viele Übersetzungen dieser Art, die im Original eigentlich in Versen geschrieben sind, werden nur als Prosatexte verfasst. Bei diesem Verfahren wird jedoch der Stil des Autors, eventuelle Wortspiele, Reime, usw.
völlig vernachlässigt. Die ersten Shakespeare - Übersetzungen von Eschenburg waren in Prosa.
Die zweite erweiterte Form des Übersetzens ist der Versuch, nicht nur die Bedeutung der einzelnen Wörter, sondern auch den Stil und die Stimmung, die der Original-Text erzeugt, zu erhalten. Dafür muss man den Original - Text zuerst sinnumfassend, d.h. den Sinn mit der Absicht des Autors, eine bestimmte Wirkung zu erreichen, verstehen, damit man hinterher bei der Rekonstruktion des Textes die beabsichtigte Wirkung der einzelnen stilistischen Elemente richtig einbauen und wirken lassen kann.
Die dritte Stufe, die bei Übersetzungen eine wichtige Rolle spielt, kommt eher unfreiwillig dazu, ist aber beim Übersetzen nicht zu vermeiden. Sie ist in der Fortentwicklung der Sprache des Übersetzers begründet. Da Sprache sich ständig verändert, ist eine 200 Jahre alte Übersetzung sehr häufig nicht mehr so passend wie eine modernere, jüngere Übersetzung. Oder wie der Übersetzungswissenschaftler Kloepfer sagt: „...Sie (die Übersetzung) ist nie abgeschlossen...“ (siehe 1./Friedmar Apel: Literarische Übersetzung S.7)
Goethe hat die drei Stufen des Übersetzens folgendermaßen zusammengefasst: Die erste Stufe ist die Prosaübersetzung, die zweite ist der Versuch, sich in die damaligen ausländischen Umstände mit eigenen Worten wiederzugeben, und der dritte höchste und letzte Zustand, „wo man die Übersetzung dem Original identisch machen möchte...“ (siehe 5. /S.49) Eine gute Übersetzung muss also all diesen Ansprüchen genügen. Sie muss sowohl den Inhalt und die Form wiedergeben und die vom fremdsprachigen Autor beabsichtigte Wirkung erzielen, als auch die entsprechend neueste und angemessenste Sprache dieser Zeit, d. h. die aktuelle Sprachform des Übersetzers benutzen. Dabei soll die Übersetzung auf keinen Fall ein neues Werk sein, denn es genügt nicht, den zu übersetzenden Text im besten Deutsch neu zu dichten. Bei einer Übersetzung muss immer deutlich bleiben, dass es sich auch um eine solche handelt (Siehe 5./S.60). Stil, Inhalt und Wirkung müssen erkennen lassen, dass ein Werk eines anders sprachigen Autors/Dichters in die zur Zeit der Übersetzung aktuelle deutsche Sprachform übertragen wurde.
3. Darstellung der Probleme
3.1 Anforderungen an die Fähigkeiten des Übersetzers
Aus der Definition des Übersetzens ergeben sich die wesentlichen Probleme.
Der Übersetzer selbst bildet das Bindeglied zwischen dem Leser und dem fremdsprachigen Autor. Dabei steht er vor der Aufgabe, dass er mit anderen „Werkzeugen“, also einer anderen Sprache dasselbe, oder zumindest so etwas ähnliches wie der Original-Autor „ausrichten“ oder schaffen soll (siehe 3. /Peter Gebhardt: Schlegels Shakespeare Übersetzung S. 98) Der Übersetzer ist dafür verantwortlich, dass Stil, Ton, Stimmung und der Inhalt entsprechend erfasst und reproduziert werden. Deswegen muss er nicht nur die entsprechende Fremdsprache tiefgreifend beherrschen, sondern vor allem auch die eigene Sprache, insbesondere das literarische Deutsch, um „...in der eigenen Sprache den Stil zu finden, den das Original und sein Autor in ihrer Sprache verkörpern...“ (siehe 5./S.49).
3.2 Bewahrung des Original - Stils
Der Übersetzer, vor allem bei shakespeareschen Texten, befindet sich ständig auf einer Gradwanderung zwischen freier und wörtlicher Übersetzung, denn die vielen Assoziationen, die facettenreichen Bilder, die Wortspiele, Reime und idiomatischen Ausdrücke sind sehr oft kaum wörtlich zu übersetzen. In solchen Fällen muss der Übersetzer dann auf die entsprechenden deutschen Wortspiele etc. zurückgreifen. Dabei muss er sich jedoch ständig davor hüten, Shakespeares Stil zu verändern, denn ebenso wie eine wörtliche Übersetzung dem Sinn schaden kann, kann auch eine freiere Übersetzung dem Stil schaden. Sie kann Interpretationsmöglichkeiten verändern oder vielleicht sogar zerstören. Kurz gesagt, genau der Stil, welcher Shakespeare auszeichnet, nämlich seine Assoziationen, seine facettenreichen Bilder, seine Wortspiele, Reime und idiomatischen Ausdrücke, macht es sehr schwer, seine Werke ins Deutsche zu übersetzen.
3.3 Bewahrung der Verstechnik
Die Verstechnik und die häufigen Reime in Shakespeares Dramen bilden wahrscheinlich eines der größten Probleme. Zum einen sind diese beiden Elemente unverzichtbar im Bezug auf den Stil und die Stimmungswirkung, auf der anderen Seite ist das Reimschema einer anderen Sprache schwer in das Deutsche hinein zu pressen. Dies liegt in erster Linie an den vielen Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Sprache. Das Englische hat im Vergleich zum Deutschen viele einsilbige Wörter. Dies und die Dominanz der männlichen Endungen im Blankvers verleihen dem Englischen jambischen Metrum eine andere Funktion als dem Jambus in der deutschen Sprache. Darüber hinaus gibt es auch noch grammatikalische Unterschiede, wie zum Beispiel die von Shakespeare gern benutzte Partizipial - Konstruktion, die seine Sprache so präzise erscheinen lässt, für die es aber im Deutschen keine gleichwertige Alternative mit ähnlichem grammatischem Charakter gibt.
Diese Unterschiede mögen klein sein, aber letztendlich sind diese Besonderheiten im Englischen die Attribute, die Shakespeare auszeichnen. Deswegen ist es auch hier wichtig, dass der Übersetzer im Deutschen wieder den Stil seiner Sprache sucht, der dem Stil Shakespeares wohl am nächsten kommen könnte. Dabei ist es vor allem die Aufgabe des Übersetzers, verstechnische Stilmittel wie Metrum, Reimschema, Strophenform, usw. so zu wählen, dass sie die ursprünglich beabsichtigte Wirkung der Phonetik, des Musikalischen usw., und damit die beabsichtigten Stimmungen wiedergeben.
3.4 Sprachhistorische Probleme
Ein weiteres Problem des Übersetzens liegt in der Entwicklung der deutschen Sprache. Die neuhochdeutsche Sprache ist nämlich im Vergleich zu anderen Sprachen wie z.B. der französischen oder englischen, noch recht jung. Zu der Zeit, in der Shakespeare geboren wurde (um 1564), war das Neuhochdeutsche gerade erst erfunden worden. Das erste neuhochdeutsche Werk, das in Deutschland jemals veröffentlicht wurde, war nämlich die Bibelübersetzung Luthers um 1521. Vorher war Deutschland ein Land, in dem viele Dialekte und keine einheitlichen Sprache gesprochen wurde. Auch die Bibelübersetzung Luthers war zwar in einer allgemein verständlichen Sprache geschrieben, aber es war trotzdem zu jener Zeit eine Art Kunstsprache, die vom Volk in dieser Form gar nicht gesprochen wurde. Die deutsche Schriftsprache begann sich zu der Zeit also gerade erst zu entwickeln.
In England hingegen war zu dieser Zeit das Elisabethanische Zeitalter in vollster Blüte und die englische Sprache bereits hoch kultiviert.
Gerade weil das Neuhochdeutsche so jung ist, verändert es sich sehr schnell. Dementsprechend veralten auch die übersetzerischen Leistungen, die in der deutschen Sprache getätigt werden, schneller. Viele Shakespeare- Übersetzungen, die bereits ein paar hundert Jahre alt sind, klingen heutzutage äußerst unzulänglich. Im Prinzip müssten alle fünfzig Jahre neue Übersetzungen geschrieben werden, um die Veränderungen, die sich mit der Zeit in der deutschen Sprache entwickelt haben, zu verarbeiten.
Da die englische Sprache zu Shakespeares Zeit viel höher entwickelt war als die deutsche Sprache, waren die ersten Versuche, Shakespeares Werke zu übersetzen, dementsprechend mangelhaft. Die ersten Übersetzungs-Pioniere, wie Eschenenburg, Wieland und Elbert (ca. 1762- 1766), waren den Problemen ausgesetzt, dass sie zum einen eine Sprache entschlüsseln wollten, die im Vergleich zu ihrer eigenen Sprache sehr weit entwickelt war, und dass sie zum anderen diese Sprache in eine Sprache transferieren wollten, die es noch gar nicht mit dieser fremden Sprache aufnehmen konnte.
Diese ersten Übersetzungen waren weitestgehend in Prosa, aber es fehlten immer noch Teile der Originaltexte, da sie teilweise im Deutschen noch gar nicht wiedergegeben werden konnten. Auch ließ Wieland, der Shakespeare als jemanden verstand, der „...alle Schönheiten und Mängel der wilden Natur hat...“ (siehe 6./ Ina Schabert: Shakespeare Handbuch S.836), deswegen Textstellen aus, weil sie nach seiner Meinung schrecklich klangen. Er wollte vielleicht damit dem Genie Shakespeare gerechter werden.
Ein weiteres großes Problem ist darin begründet, dass Shakespeares Werke sehr wahrscheinlich in der heute bekannten Form ursprünglich nicht aufgeführt wurden. Shakespeare selber hat seine Werke nämlich nie aufgeschrieben und publiziert, sondern nur auf der Bühne aufgeführt. Die ersten geschriebenen Werke Shakespeares wurden erst knapp zwanzig Jahre nach seinem Tod in der „First Folio“ - Ausgabe von 1623 veröffentlicht. Es ist deshalb zu vermuten, dass diese Texte schon lückenhaft oder verändert oder einfach nur fehlerhaft sind und nicht das reine Wort Shakespeares wiedergeben.
Ein heutiger Übersetzer hat dieses Problem in noch größerer Form. Er muss sich nicht nur mit diesem Problem der unvollständigen Texte auseinander 5 setzen sondern sich auch im Elisabethanischen Zeitalter auskennen, was mit wachsender zeitlicher Distanz immer schwieriger wird, und er muss nicht zuletzt eine Sprache übersetzen, die mehr als 400 Jahre alt ist, die sich in dieser Zeit ebenfalls weiter entwickelt hat und in der Form, in der die Texte vorliegen, heute nicht mehr gesprochen wird.
3.5 Traditionsproblematik des Übersetzens
Weitere große Probleme ergeben sich daraus, dass die Tradition, Shakespeare zu übersetzen, eine sehr große und hoch kultivierte ist. Diese große Tradition hat dazu geführt, dass eine allzu „...empirische Beweisführung...“ (Siehe 6./S. 834) entstand.
Dies wird allein schon deutlich daran, dass jeder, der Shakespeare übersetzen will, sich hinterher an Schlegel oder Tieck messen lassen muss. Sie waren nämlich die ersten, die eine allgemein akzeptierte Shakespeare-Übersetzung sämtlicher Werke schafften. Diese Übersetzung ist so gut, dass sie auch heute noch die Standards setzt.
Selbst berühmte, moderne Übersetzer wie Erich Fried bauen ihre Übersetzungen auf der von Schlegel oder Tieck auf. Da deren Übersetzungen aber aus der Romantik, also aus den Jahren 1800 bis 1830 stammen und eher die Gedanken jener Zeit widerspiegeln als eine allgemeingültige Übersetzung Shakespeare darzustellen, ergibt sich daraus das Problem, dass der Horizont der modernen Übersetzer immer noch in gewissem Sinne häufig dem der Romantik entspricht.
4. Problemlösungen
4.1 Schlegels Übersetzungskonzeption
Auch August Wilhelm Schlegel (1767-1845) war sich all dieser Problemen bewusst, aber er war einer der ersten deutschen großen Übersetzer, der allgemein akzeptierte Lösungsansätze für diese Probleme fand. Schlegel war es nämlich, der es als erster deutscher Übersetzer schaffte, sämtliche Werke Shakespeares in Versen zu übersetzen.
Obwohl auch Schlegel nach perfekten Übersetzungen strebte, waren sie jedoch nie sein Endziel, da er diese als eine Utopie ansah, die ein nicht zu erreichendes Ideal war. Das Original hatte für ihn eher den Charakter eines 6 „Urbildes“, das nicht original getreu nachgebildet werden kann, sondern vielmehr im Deutschen neu geschaffen werden kann (Siehe 3./S. 18). Unter diesem Aspekt gesehen wäre die vollkommene, dem Original gleiche Übersetzung gar nicht möglich, da die Übersetzung nach Schlegel nur eine Analogie, eine „Verdeutschung“ des Originals sein kann.
Diese Theorie hatte Schlegel von seinem Lehrer Gottfried August Bürger übernommen, der Schlegel während seiner Universitätszeit ab 1786 die Prinzipien des Übersetzens lehrte. Bereits in den Jahren 1788/89 arbeiteten Schlegel und Bürger zusammen an einer ersten Übersetzung von Shakespeares „Midsummer-Night´s Dream“. Bürgers Auffassung ging sogar soweit, Übersetzungen so zu formulieren, dass sie der breiten Masse gefielen. Für ihn war der Erfolg einer Übersetzung an der Resonanz des Publikums zu erkennen.
Dies war jedoch nicht Schlegels Absicht. Da Schlegel Shakespeare für vollkommen und fehlerfrei hielt, war für ihn der Begriff der Korrektheit der Übersetzung viel wichtiger, als die bloße Verständlichkeit. Damit meinte er nicht nur die äußere wortgetreue Übersetzung, sondern auch eine Innere Korrektheit, die sich bemüht, die Ideen, Gefühle, und Empfindungen zu erfassen und in den Stil des Textes mit einzubeziehen. Um dieser Forderung der Vereinigung von innerem und äußerem Inhalt zu erfüllen, distanzierte sich Schlegel konsequent von der prosaischen Übersetzungsform, denn Schlegel war der Meinung, dass die innere und die äußere Form zusammen erst den eigentlichen Inhalt eines shakespearschen Werkes bilden. Deswegen wählte er für seine Zwecke die poetische Übersetzungsform, bei der Reime, Metrik, Rhythmus usw. weitestgehend eingehalten werden sollen.
Dabei gibt es natürlich wieder Einschränkungen, die einfach in den Unterschieden der beiden Sprachen begründet liegen. Eine gewisse Freiheit muss sich jeder Übersetzer leisten können, denn trotz aller Genauigkeit geht es Schlegel immer noch um eine Analogie des Originals. Schlegel war, wie auch seinem Lehrer Bürger, die „poetische Veredlung Shakespeares“ (Siehe 3./S.16) sehr wichtig. Wenn etwas wortgetreu übersetzt im Deutschen einfach nicht schön klang, war es die Pflicht des Übersetzers, diese Unebenheit in der Sprache zu glätten, damit der Sprachstil im Sinne Shakespeares blieb. Auch die Erhaltung eines Reimes schien Schlegel sehr wichtig. Hier plädierte er für eine 7 freiere, aber immer noch dem Sinn entsprechende Übersetzung, um die Wirkung des Reimes zu erhalten.
Vor ein ähnliches Problem stellten Schlegel Szenen, die zu seiner Zeit als anstößig empfunden wurden oder die unübersetzbare Wortspiele enthielten. Zum Teil ließ er diese einfach aus, obwohl er dabei auch hier stets Rücksicht auf den Inhalt nahm.
Einen Vorteil beim Übersetzen vom Englischen ins Deutsche sieht Schlegel jedoch in der Ähnlichkeit des Wesens der Deutschen und der Engländer. Mit dieser These rechtfertigt Schlegel sein Prinzip, dass Shakespeare sozusagen auch ein deutscher Dichter hätte sein können, und dass deswegen eine Übersetzung Shakespeares wie eine „Dichtung eines deutschen Autors klingen muss, um eine deutsche Analogie des Originals, eine „Verdeutschung“ des Originals (Siehe 3./S. 96) zu schaffen. Daraus resultiert Schlegels Verfahren, das altertümliche Englisch, welches in Shakespeares Werken gesprochen wird, in das entsprechende altertümliche Deutsch zu übersetzen. Dies hat den Vorteil, dass die Übersetzung vor überflüssigen Modernisierungen bewahrt wird.
Trotz all dieser Vorteile, die Schlegel in der Wesensverwandheit der beiden Sprachen sah, blieb für ihn die „vollkommene Übersetzung“ nur ein „richtungsweisendes Prinzip“, dessen beste Leistung nur eine „Annäherung“ an das Original sein kann, denn eine gewisse Sprachbarriere bleibt immer noch vorhanden.
Deswegen ist das Verfahren das Übersetzens in erster Linie ein „Formproblem“. „Die Aufgabe des Übersetzers besteht darin, die fremde Sprachform der deutschen anzunähern und umgekehrt die deutsche Sprachform der fremden anzunähern.“ (Siehe 3./S.99).
Durch seinen „Treuegrundsatz“ (Siehe 3./S. 100) und die dadurch resultierende Erfassung nicht nur von oberflächlichen Merkmalen, sondern auch von inneren Merkmalen, wie z.B. die Wirkung von Reimen usw., schaffte Schlegel als erster deutscher Übersetzer, Shakespeares Werke durchgehend in Versen zu übersetzen, und die Einheit von Form und Inhalt zu realisieren. Schlegel hat zu seiner Zeit ohne Zweifel viel für die Wissenschaft der Übersetzung getan. Jedoch hinterließ er zusammen mit Ludwig Tieck (1773- 1853), der Schlegels Unternehmen der Shakespeare Übersetzung fortsetzte, 8 eine große Hypothek für zukünftige Übersetzer. Denn diese Übersetzungen galten lange Zeit als unübertrefflich. Mittlerweile sind sie jedoch nahezu 200 Jahre alt, und deswegen veraltet. Rudolf Schaller klagt in einer Theaterschrift zu einem shakespearschen Stück, das 1973 Münster aufgeführt wurde, dass „die Fachleute schon seit Jahrzehnten mit ihren (den Schlegel-Tieckschen) Mängeln zu kämpfen haben.“ (Siehe 7./ S. 2) Auch Ernst Sander stellt unbefriedigt fest: „Wir besitzen, dank ihrer (Schlegel und Tieck]) zwar einen deutschen Shakespeare, aber keinen shakespeareschen Shakespeare“ (Siehe 5./ S. 60).
4.2 Frieds Übersetzungskonzeption
Erich Fried, einer der bedeutendsten Übersetzer des 20. Jahrhunderts, sieht sich mit denselben Problemen konfrontiert. Für ihn ist eine Übersetzung wie für Schlegel auch eine „Dichtung im Sinn des Originals“, jedoch teilt er nicht grundsätzlich Schlegels Grundsatz der „Poetischen Veredlung“. Hauptkritik- punkte Frieds sind dabei die Stellen, bei denen Schlegel, um „Unschönheiten“ zu beseitigen, den Text änderte, wie zum Beispiel bei ständigen Wiederholungen. Fried sieht in diesen Wiederholungen nämlich eine wichtige Funktion, ein Stilmittel Shakespeares, welches Schlegel dadurch zerstört. „Immer wieder und wieder versucht Schlegel Wiederholungen und ´Häßlichkeiten` zu vermeiden.“ (Siehe 2./Bloch: Shakespeare König Lear / S. 6).
Frieds Absicht hingegen war es, Shakespeares Figuren so klingen zu lassen, wie Shakespeare sie auch klingen lassen wollte. Wenn z.B. Spiel eine Figur in Frieds Augen „häßlich“ klingen sollte, oder Obszönitäten zu dem Charakter dieser Figur gehören, so ließ Fried sie auch dementsprechend in der deutschen Übersetzung wirken. Genauso war es wichtig für Fried, Stellen, an denen der Text im Original einfach gehalten ist, auch im Deutschen einfach und klar zu übersetzen.
Zu entscheiden, wo jetzt genau diese Stellen zu finden sind, mag zwar reine Interpretationssache des Übersetzers sein, aber dessen war sich Fried bewusst. Denn auch für Fried enthält eine Übersetzung eine „Philosophie und Interpretation des Übersetzers.“ (Siehe 2./ S.4).
Auf keinen Fall jedoch lehnt Fried die schlegelsche Übersetzung ab, auch will er
Schlegel nicht einfach nur „modernisieren“, denn schließlich sind „Assoziationen zu Shakespeare im Deutschen von Schlegel mitgeprägt“ worden. Fried postuliert nur, dass neue, aktuellere Übersetzungen von Nöten sind, denn „Sprachstil und Originaltreue stellen heute völlig andere Anforderungen“ (Siehe 2./ S.9).
5. Zusammenfassung
Bei der Bearbeitung deutschsprachiger Übersetzungen von fremdsprachiger Literatur/Dichtung sind Abwandlungen des Originaltextes zu berücksichtigen, die im Übersetzungsprozess begründet sind. Die Problematik des Übersetzens wurde am Beispiel Shakespeare aufgezeigt.
Bei einer Übersetzung muss immer deutlich bleiben, dass es sich auch um eine solche handelt. Stil, Inhalt und Wirkung müssen erkennen lassen, dass ein Werk eines anders sprachigen Autors/Dichters in die zur Zeit der Übersetzung aktuelle deutsche Sprachform übertragen wurde.
Diese Anforderung an Übersetzungen wirft vielseitige Probleme auf. Sie verlangt dem Übersetzer nicht nur große Sicherheit in der Beherrschung der Originalsprache des Textes und seiner eigenen, der Übersetzungssprache ab, sondern sie setzt auch ein starkes Einfühlungsvermögen in die Stimmungsbildung und Aussagefähigkeit von Stilformen und Verstechnik voraus. Ferner hat der Übersetzer Unterschiede in der Entwicklung und Form der beiden Sprachen auszugleichen und geschichtliche Hintergründe so zu berücksichtigen, dass die Aussagen und Stimmungen des Originals erhalten bleiben, auch wenn sich der zur Zeit der Übersetzung vorherrschende Zeitgeist vom Zeitgeist der Handlung des Originals unterscheidet.
Am Beispiel verschiedener Shakespeare-Übersetzer wurden Übersetzungs- konzeptionen aufgezeigt, woraus abzuleiten ist, dass es so gut wie unmöglich ist, ein allgemeingültiges Schema oder Regelwerk für Übersetzungen zu finden, denn man wird immer wieder Textstellen finden, bei denen subjektive Entscheidungen erforderlich sind. Eine ideale Übersetzung, die wirklich die Absichten Shakespeares widerspiegelt, ist deswegen trotz aller Bemühungen um Anpassung und Treue gegenüber dem Original ohne Interpretationen und Abwandlungen des Übersetzers nicht möglich, da der Übersetzer dem Original nicht objektiv gegenüberstehen kann, da „Konventionen, Rücksichten auf eine beabsichtigte Wirkung, auf Wünsche und Erwartungen des Publikums (und) auf vorhandene Regeln“ (siehe 3. /S. 91) den Übersetzer immer bewusst oder unbewusst beeinflussen.
6. Literaturverzeichnis
1. Apel, Friedmar: Literarische Übersetzung; Sammlung Metzler, Band 206, Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, Stuttgart, 1983
2. Bloch Erben, Felix: Shakespeare König Lear; Begleitheft zur Inszenierung Shakespeares von Herbert König; Verlag für Film Funk, Berlin, 1990
3. Gebhardt, Peter: A.W. Schlegels Shakespeare-Übersetzung; Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970
4. http://web.uvic.ca/shakespeare/Annex/DraftTxt/TN/TN_Fscenes/TN_F1.1 .html
5. Koch, Hans-Albrecht (Hrsg): Sprachkunst und Übersetzung; Gedenkschrift Ernst Sander; Verlag Peter Lang AG, Bern, 1983
6. Schabert, Ina: Shakespeare Handbuch; Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1972
7. Schaller, Rudolf: Theaterschrift zu einem shakespearschen Stück; Münster,1973
Häufig gestellte Fragen zu Shakespeare-Übersetzungen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Analyse von Problemen und Lösungen bei der Übersetzung fremdsprachiger Literatur, insbesondere der Werke William Shakespeares, ins Deutsche. Er untersucht die Herausforderungen, vor denen Übersetzer stehen, und wie verschiedene Übersetzer, wie August Wilhelm Schlegel und Erich Fried, diese Probleme angegangen sind.
Welche Probleme werden bei der Übersetzung von Shakespeare-Werken ins Deutsche behandelt?
Der Text behandelt eine Vielzahl von Problemen, darunter:
- Die hohen Anforderungen an die Fähigkeiten des Übersetzers (Sprachkenntnisse, literarisches Deutsch).
- Die Bewahrung des Originalstils Shakespeares (Assoziationen, Wortspiele, Reime, idiomatische Ausdrücke).
- Die Bewahrung der Verstechnik (Metrum, Reimschema).
- Sprachhistorische Probleme (jüngere Entwicklung des Neuhochdeutschen im Vergleich zum Elisabethanischen Englisch).
- Die Traditionsproblematik des Übersetzens (Einfluss früherer Übersetzungen, insbesondere Schlegels).
Welche Lösungsansätze werden vorgestellt?
Der Text stellt die Übersetzungskonzeptionen von August Wilhelm Schlegel und Erich Fried vor:
- Schlegel: Betonung der poetischen Übersetzung, Analogie des Originals, Bewahrung der Reimschemata, Akzeptanz gewisser Freiheiten zur Erhaltung des Stils, Übersetzung des altertümlichen Englisch ins entsprechende altertümliche Deutsch.
- Fried: Dichtung im Sinn des Originals, aber Kritik an Schlegels "poetischer Veredlung", Beibehaltung von Wiederholungen und "Hässlichkeiten" als Stilmittel Shakespeares, Figuren so klingen lassen, wie Shakespeare sie gewollt hat.
Welche Anforderungen werden an eine gute Übersetzung gestellt?
Eine gute Übersetzung muss sowohl den Inhalt als auch die Form des Originals wiedergeben und die vom fremdsprachigen Autor beabsichtigte Wirkung erzielen. Sie muss außerdem die aktuellste und angemessenste Sprache der Zeit verwenden, d.h. die aktuelle Sprachform des Übersetzers. Dabei soll die Übersetzung jedoch kein neues Werk sein, sondern immer als solche erkennbar bleiben.
Warum sind ältere Shakespeare-Übersetzungen oft veraltet?
Das Neuhochdeutsche ist im Vergleich zu anderen Sprachen relativ jung und verändert sich daher schnell. Dementsprechend veralten auch die übersetzerischen Leistungen, die in der deutschen Sprache getätigt werden, schneller. Viele Shakespeare-Übersetzungen, die bereits ein paar hundert Jahre alt sind, klingen heutzutage unzulänglich.
Wer waren wichtige frühe Shakespeare-Übersetzer?
Zu den frühen Übersetzungs-Pionieren gehören Eschenburg, Wieland und Elbert. Später leisteten August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck einen wesentlichen Beitrag, indem sie eine allgemein akzeptierte Übersetzung sämtlicher Werke Shakespeares schufen.
Welche Rolle spielt der Übersetzer selbst?
Der Übersetzer bildet das Bindeglied zwischen dem Leser und dem fremdsprachigen Autor. Er muss den Stil, Ton, die Stimmung und den Inhalt entsprechend erfassen und reproduzieren. Deswegen muss er nicht nur die entsprechende Fremdsprache tiefgreifend beherrschen, sondern vor allem auch die eigene Sprache, insbesondere das literarische Deutsch.
Was ist die Hauptaussage des Textes?
Der Text argumentiert, dass bei der Bearbeitung deutschsprachiger Übersetzungen von fremdsprachiger Literatur/Dichtung Abwandlungen des Originaltextes zu berücksichtigen sind, die im Übersetzungsprozess begründet sind. Eine ideale Übersetzung, die wirklich die Absichten Shakespeares widerspiegelt, ist deswegen trotz aller Bemühungen um Anpassung und Treue gegenüber dem Original ohne Interpretationen und Abwandlungen des Übersetzers nicht möglich.
Welche Art von Texten wurden zur Analyse verwendet?
Übersetzungen von Shakespeares Werken wurden analysiert, insbesondere "Was Ihr Wollt" (Twelfth Night).
Wo finde ich die zitierte Literatur?
Ein detailliertes Literaturverzeichnis ist am Ende des Textes angefügt.
- Quote paper
- Bernhard Vowinckel (Author), 2001, Probleme bei der Übersetzung fremdsprachiger Literatur / Dichtung in die deutsche Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106426