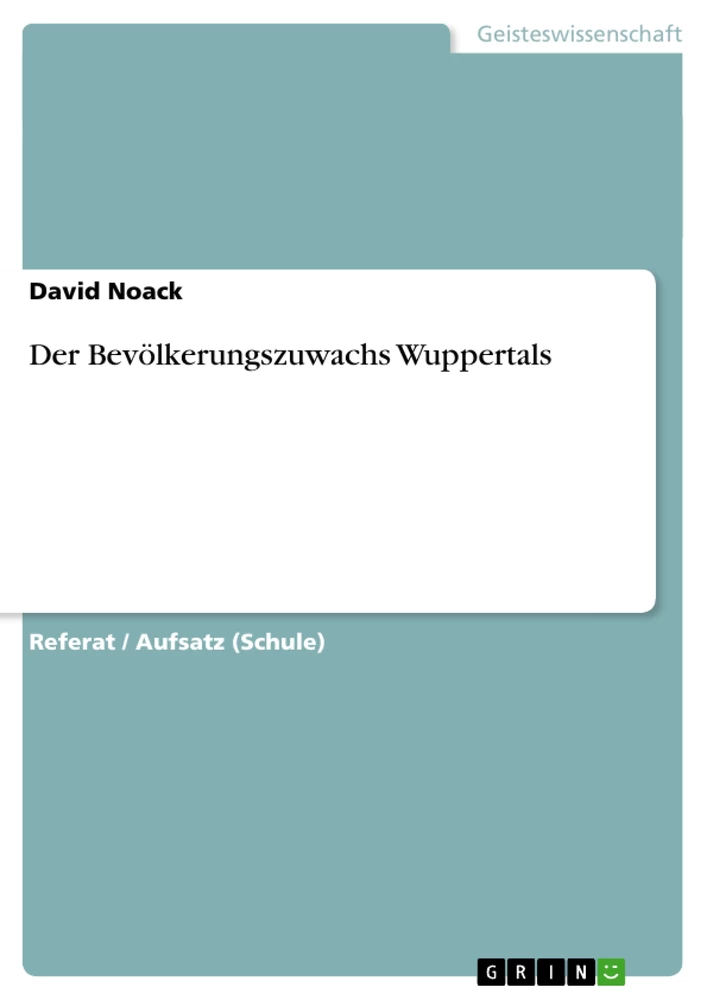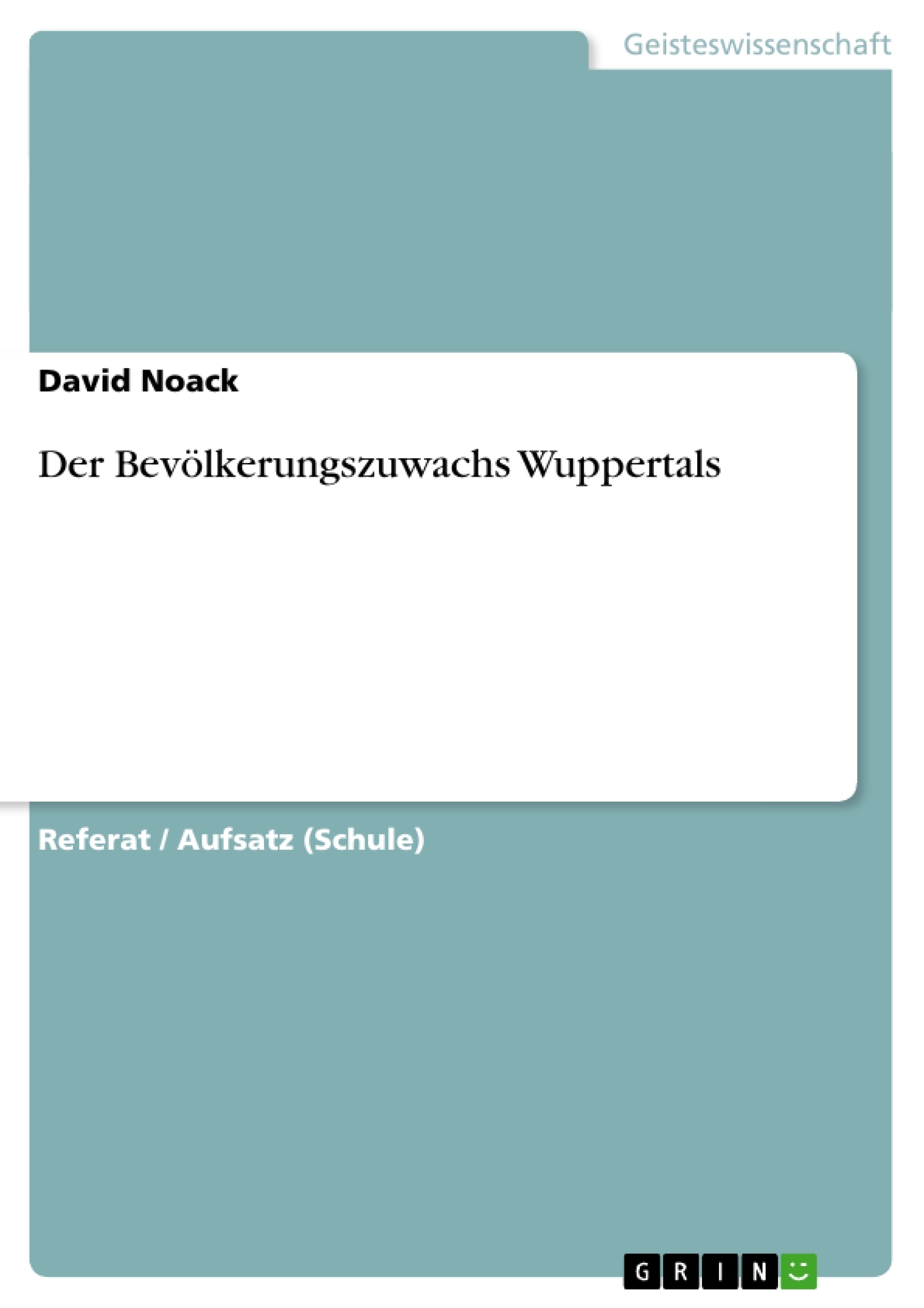Was trieb ganze Generationen an, ihre Heimat zu verlassen und in eine aufstrebende Industriestadt zu ziehen? Diese Frage steht im Zentrum einer fesselnden Reise durch die Bevölkerungsgeschichte Wuppertals, von den bescheidenen Anfängen im 16. Jahrhundert bis zum pulsierenden urbanen Zentrum des 20. Jahrhunderts. Erleben Sie, wie sich kleine Ackerbürgergemeinden wie Barmen und Elberfeld in atemberaubendem Tempo zu dynamischen Großstädten wandelten, angetrieben von einer beispiellosen Zuwanderungswelle. Entdecken Sie die Schicksale derer, die aus dem Bergischen Land, den Niederlanden, Frankreich und fernen Regionen kamen, angelockt von Arbeitsplätzen und religiöser Freiheit. Verfolgen Sie die Ursachen der Landflucht am Beispiel Waldecks, wo ganze Dörfer entvölkert wurden, um in den Fabriken und Werkstätten Wuppertals ein neues Leben zu beginnen. Analysieren Sie die demografischen Veränderungen, die Wuppertal zu einer der größten Städte im Deutschen Reich machten, und erfahren Sie, wie Geburtenüberschuss und Wanderungsgewinn die Bevölkerungsentwicklung beeinflussten. Tauchen Sie ein in die Welt der Tagelöhner, Landarbeiter, Beamten und Unternehmer, die das soziale und kulturelle Leben der Stadt prägten. Erkunden Sie die Einflüsse der Zuwanderer auf Religion, Traditionen und Arbeitsmoral. Dieses Buch bietet nicht nur eine umfassende Analyse der Bevölkerungsbewegung, sondern zeichnet auch ein lebendiges Bild vom Wandel einer Region und dem Schicksal der Menschen, die sie gestalteten. Es ist eine Geschichte von Aufbruch, Anpassung und dem unaufhaltsamen Drang nach einem besseren Leben im Herzen des aufstrebenden Wuppertals. Eine lesenswerte Lektüre für alle, die sich für Regionalgeschichte, Migrationsforschung und die spannende Entwicklung einer deutschen Industriestadt interessieren. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Zuwanderung, die Rolle der Industrie und die sozialen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der die Geschichte Wuppertals und seiner Menschen verstehen will. Lassen Sie sich entführen in eine Zeit des Wandels und der Hoffnung, die das Gesicht einer ganzen Region für immer veränderte.
Inhalt
1. Einleitung
2. Zuwanderungen vom 16. bis 18. Jahrhundert
2.1 Zuwanderer aus der Umgebung
2.1.1 Zuzüge aus dem Bergischen
2.2.2 Ronsdorf, Zuzüge aus religiösen Gründen
2.2 Zuwanderer aus Nah- und Fernwanderungsbreichen (bis 1800)
2.2.1 Städtische und kirchliche Beamte
2.2.2 Tagelöhner und Landarbeiter
3. Die Bevölkerungsentwicklung im 19. Jahrhundert David Noack
3.1 Aussagen der Bevölkerungsstatistik
3.1.1 Darstellung der Bevölkerungsexplosion in den Wuppertaler Gebieten
3.1.2 Ursachen der Bevölkerungsexplosion
3.2 Zuwanderungen im 19. Jahrhundert
3.2.1 Übersicht der Herkunftsgebiete
3.2.2 Hintergründe der Landflucht am Beispiel Waldecks
4. Bevölkerungsbewegung im 20. Jahrhundert David Noack
1. Einleitung
Seit der Zeit seines ersten gewerblichen Wachstums war Wuppertal Ziel von Zuwanderungen aus verschiedensten Gebieten. Als im 19. Jahrhundert ein regelrechter Zuwanderungsboom einsetzte, verloren Barmen und Elberfeld ihr kleinstädtisches Gesicht und wuchsen zu einer Industriegroßstadt zusammen, die 1880 die sechstgrößte Stadt im Deutschen Reich war. Die Menschenzahl des Wuppertals hatte sich im Lauf von hundert Jahren verzehnfacht. Unsere Arbeit wurde von folgenden Fragen geleitet:
Welche Vorgeschichte hatte der enorme Bevölkerungszuwachs?
Welche Ursachen hatte die Bevölkerungsexplosion im 19. Jahrhundert? Warum und woher kamen diese vielen Menschen?
2. Zuwanderungen vom 16. bis 18. Jahrhundert
2.1 Zuwanderer aus der Umgebung
Wegen der vielen freien Arbeitsplätzen kamen immer mehr Zuwanderer vom Land nach Barmen und Elberfeld, so dass sich die beiden Kleinstädte zu industrialisierten Großstädten entwickelten. Schon im 16.Jahrhundert begann die Zuwanderung nach Barmen und Elberfeld. Viele Zuwanderer heirateten sich mit einem gewissen Startkapital in eine Unternehmerfamilie ein und hatten somit einen kleinen Anteil an dem Unternehmen des Schwiegervaters. Oft schlossen sie sich auch den jeweiligen Gemeinden an, in denen sie natürlich auch getraut wurden.
2.1.1 Zuzüge aus dem Bergischen
Der höchste Anteil der Zuwanderer aus dem 16. Jahrhundert stammte aus dem Bergischen Land. Um 1600 zog unter anderem Kaspar Frowein (Sohn des Lenneper Bürgermeisters) nach Elberfeld und heiratete Gertrud Rittershaus, die Tochter des damaligen Bürgermeisters von Elberfeld. 1627 wurde sogar ein Zuwanderer, nämlich Peter Lüttringhausen, zum Elberfelder Bürgermeister gewählt. Im späten 18. Jahr- hundert wanderten auch viele Fabrikanten (Vorwerk) nach Wuppertal ein und bildeten eine neue Unternehmerschicht, die erst 1808 von anderen Unternehmen aufgeholt wurde.
2.2.2 Ronsdorf, Zuzüge aus religiösen Gründen
Ein Sonderfall des heutigen Wuppertals war Ronsdorf, in dem sich 1737 einige Elberfelder Familien, unter der Führung von Elias Eller, in dem damaligen Lüttringhauser Gebiet Erbschlö niederließen. Elias Eller wuchs im religiösen Elternhaus auf und hatte einen ungewöhnlichen Unternehmungsdrang, so dass er schließlich 1741 die reformierte Gemeinde gründete. Es zogen aber nicht nur Familien aus Elberfeld nach Ronsdorf, sondern es sind auch Zuzüge aus Barmen-Gemarke, Cronenberg, Düsseldorf, Hagen, Homberg, Hückeswagen, Mettmann, Neviges, Radevormwald, Schwelm und Solingen bekannt. Ende des 18. Jahrhunderts wuchs auch die Zahl der Zuzüge aus reformierten Gemeinden des Siegerlandes, des Wittgensteiner Landes und des oberbergischen Homburgs.
2.2 Zuwanderer aus Nah- und Fernwanderungsbereichen (bis 1800)
Es gab auch viele Zuwanderungen aus Frankreich und den Niederlanden, wobei man nicht genau weiß, weswegen so viele Franzosen eingewandert sind. Durch die vielen eingewanderten Franzosen ergab sich allerdings eine bessere industrielle Verbindung zwischen Wuppertal und Frankreich. Niederlande war mit Belgien eines der besten Exportgebiete für die Erzeugnisse des Wuppertaler Garngewerbes gewesen.
Als nun die Religionsverfolgung in den Niederlanden wütete, beschlossen die Bedrängten bei ihren Geschäftsfreunden in Wuppertal Zuflucht zu suchen. Es sollen auch noch Zuzüge aus Köln dazugekommen sein, für die man allerdings keine genauen Gründe gefunden hat.
2.2.1 Städtische und kirchliche Beamte
Einen geringen Prozentsatz der Zuwanderer hatten Beamte von Staat, Stadt und Kirche. Die Nachkommen dieser Beamten stiegen öfters in die wirtschaftlich führenden Schichten auf. Zu diesen Beamten zählten auch berühmte Persönlichkeiten wie Wilhelm von Pylsum und Heinrich Kamp.
2.2.2 Tagelöhner und Landarbeiter
Im 18. Jahrhundert nahm die Zuwanderung von Tagelöhnern und Landarbeitern zu, die dann namenlos in der wachsenden Anzahl dieser Zuwanderer versanken. Meist sehr ärmlich lebend und ohne eigenen Besitz betrieben die Tagelöhner und Landarbeiter, mit gemieteten Geräten, ihre Lohnarbeit. Zuwanderergruppen gab es im 18. Jahrhundert nur sehr selten, und zudem lassen sie sich auch nur bruchstückhaft erkennen. Erst im 19. Jahrhundert erschienen zahlreiche Zuwanderergruppen wie die der Waldecker, Homburger, Schwarzenberger, Sauerländer und Hessen.
3. Die Bevölkerungsentwicklung in Wuppertal im 19. Jahrhundert
3.1. Aussagen der Bevölkerungsstatistik
3.1.1 Darstellung der Bevölkerungsexplosion in den Wuppertaler Gebieten
Bevor 1929 die Stadt Wuppertal gegründet wurde, geschah im 19. Jahrhundert eine einmalige Entwicklung in den Gemeinden: Die Bevölkerung stieg explosionsartig an. Die Einwohnerzahl Barmens wuchs in den Jahren von 1807 bis 1910 um das Zwölffache, die Elberfelds um das Zehnfache, Cronenberg verdreifachte sich und Ronsdorfs Einwohnerzahl stieg um das Fünffache.
Rechnet man alle späteren Wuppertaler Stadtteile zusammen, so erreichte die Wuppertaler Bevölkerung schon 1910 einen Stand von ca. 400 000 Einwohnern, war also im Laufe des 19. Jahrhunderts um das Zehnfache angestiegen. Dieser Bevölkerungsstand hat sich bis heute unwesentlich verändert, die Zahl ist nur geringfügig gestiegen, es fand nur eine Verteilung innerhalb der Stadtteile statt.
Um die Bevölkerungsexplosion zu verdeutlichen, habe ich für den Zeitraum vom 1810 bis 1900 ein Schaubild von Barmen erstellt :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einwohnerzahlen entnommen aus: Köllmann, Wolfgang „Sozialgeschichte der Stadt Barmen im 19. Jahrhundert“, S. 71
Die Zahlen für Elberfeld sind ähnlich, Elberfelds Bevölkerung wuchs jedoch von 1811-1847 schneller, die Einwohnerzahl wurde aber 1868 von Barmen übertroffen. Deutlich wird die enorme Bevölkerungszunahme, wenn man Elberfeld und Barmen zusammennimmt, was auch schon die Zeitgenossen wegen der großen räumlichen Nähe taten, und mit dem Bevölkerungswachstum anderer Gebiete in Deutschland vergleicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle teilweise entnommen aus: Wolfgang Hoth, „Wuppertal - Die Industrialisierung einer rheinischen Gewerbestadt“, S 72
3.1.2 Ursachen der Bevölkerungsexplosion
Fragt man danach, warum in Wuppertal die Bevölkerung im 19. Jahrhundert so explosionsartig zugenommen hat, muss man zwei Faktoren genauer betrachten:
- den Geburtenüberschuss, das ist die Zunahme der Bevölkerung durch Geburten abzüglich der Sterbefälle und
- den Wanderungsgewinn, das ist der Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderung aus anderen Gebieten abzüglich der Abwanderungen.
Um feststellen zu können, welche der beiden Faktoren in welchen Jahren für den Wachstum verantwortlich war, habe ich folgendes Schaubild für Barmen erstellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zahlen zum Geburtenüberschuss und zum Wanderungsgewinn entnommen aus: Köllmann, Wolfgang „Sozialgeschichte der Stadt Barmen im 19. Jahrhundert“, S. 71
Betrachtet man die Kurve, die den Geburtenüberschuss anzeigt, ist in der ersten Jahrhunderthälfte eine ständige leichte Steigung festzustellen, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, als die Zuwanderungswelle in den 50er Jahren einsetzte (vgl. auch rote Kurve), deutlich steiler wird. Da vor allem jüngere Arbeitskräfte einwanderten, die kinderreiche Familien gründeten, stieg der Geburtenüberschuss bis 1880 um das 6,5fache. Als in den 70er Jahren der Zuwanderungsstrom abnahm, blieben die Geburtenüberschüsse trotzdem relativ hoch, was der besseren medizinischen Versorgung zuzuschreiben ist. Leichte Abfälle in der Kurve bedeuten weniger Geburten und mehr Sterbefälle aufgrund von Epidemien oder wirtschaftlichen Krisen (1818 Hungerkrise, 1830 Grippe, 1846 Agrarkrise, 1867 Cholera, Mitte der 70er Jahre Gründerkrise).
In solchen Krisenphasen war verständlich auch der Wanderungsgewinn geringer.
Nach verhältnismäßig hohen Zuwanderungen in den Jahren 1810 bis 1850 entstand zwischen 1851 und 1875 ein ungeheurer Zuwanderungsboom, nach der Gründerkrise wurde der Wanderungsgewinn unbedeutend, da auch viele Menschen die Wuppertaler Gebiete verließen. Die Bevölkerungsexplosion hätte ohne die Zuwanderer nicht stattgefunden, Barmen und Elberfeld hätten sich nicht zu Industriegroßstädten entwickeln können, denn der industrielle Fortschritt war nicht nur Ursache, sondern auch Folge der Zuwanderungen. Deshalb muss ich mir die Frage stellen: Woher kamen die Zuwanderer und welche Gründe hatten sie, sich ausgerechnet in Wuppertal anzusiedeln?
3.2 Zuwanderungen im 19. Jahrhundert
3.2.1 Übersicht über die Herkunftsgebiete
Die Zuwanderer zogen im 19. Jahrhundert vor allem aus ländlichen Gebieten Westdeutschlands auf der Suche nach Arbeit nach Barmen-Elberfeld. Die Landbevölkerung war zu stark angewachsen, als dass alle ihren Lebensunterhalt in der Heimat verdienen konnten. Sie fanden Arbeit im Wuppertaler Industriegebiet als Handwerker oder als Arbeiter in den Bleichereien, Färbereien und Bauwollspinnereien.
Die Neubürger kamen vorwiegend aus dem Oberbergischen (Hombecker Maurer, Eckenhagener Pflasterer), aus Hessen vor allem aus Waldeck (Fuhrleute, Schaffner), aus Westfalen und aus dem Rheinland.
Goebel hat in seinem Beitrag „So wurden sie Wuppertaler“ für die Jahre 1865 und 1895 die Geburtsorte von Heiratenden aufgelistet. Von diesen Stichproben können Rückfolgerungen darauf geschlossen werden, wie viel Prozent der Barmer / Elberfelder aus welchen Gebieten zugewandert waren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Neubürger brachten Traditionen, katholischen bzw. lutherischen Glauben, eine bestimmte Arbeitsmoral oder die Vorliebe für bestimmte Nahrungsmittel mit nach Wuppertal und prägten damit das kulturelle und religiöse Leben in den Wuppertaler Gebieten. Die Oberbergischen Tüncher, Zimmerleute und Bauarbeiter z.B. brachten Fleiß, Sparsamkeit und Ausdauer mit und konnten häufig in ihrem Beruf aufsteigen und Karriere machen. Die Zuwanderung der katholischen Sauerländer hatte das Anwachsen der katholischen Gemeinden zur Folge und die Waldecker bereicherten die Wuppertaler Mitbürger durch heimische Wurst- und Brotsorten.
3.2.2 Hintergründe der Landflucht am Beispiel Waldecks
Da aus Waldeck so viele Zuwanderer kamen, dass in Wuppertal um 1900 mehr gebürtige Waldecker Menschen lebten als in Korbach, der größten waldeckischen Stadt, möchte ich die Auswanderung der Waldecker etwas näher beschreiben. Welche Gründe hatten sie, ihre Heimat zu verlassen und welche Anziehungskraft hatte Wuppertal auf sie?
Die Landwirtschaft war der wichtigste Erwerbszweig der waldeckischen Bevölkerung, der Boden war allerdings nicht sonderbar fruchtbar. Da außerdem ein Verbot der Teilung von Bauerngütern bestand, blieb den Erben nichts anderes übrig, als ihre Heimat zu verlassen. Wuppertal wurde als Zielort deshalb so häufig gewählt, weil Barmen und Elberfeld die Städte waren, die die besten Arbeitsmöglichkeiten boten. Die Städte des Ruhrgebietes waren zu dieser Zeit Wuppertal in der wirtschaftlichen Entwicklung noch unterlegen. Außerdem vermittelten die Upländer Linnenhändler und auch die Handwerker auf Wanderschaft manchem Mädchen und Jungen aus Waldeck eine Lehrstelle in Barmen. Andere Stellen wurden durch verwandtschaftliche Beziehungen besorgt.
So zogen ledige Männer und junge Mädchen, oftmals auch mehrere Geschwister mit ihrem armseligen Besitz zu Fuß nach Wuppertal. Dazu brauchten sie 2-3 Tagesreisen. Ab 1872 konnte man die Eisenbahn benutzen, was jedoch selten in Anspruch genommen wurde, denn nur wenige hatten Geld für eine Fahrkarte. In Wuppertal angekommen, arbeiteten die Waldecker häufig als Schneider, Schreiner, Schmied, Kutscher, Pferdebahnschaffner oder Fuhrleute. Da die meisten Waldecker mit Pferden großgeworden waren, drängten sie auch in entsprechende Berufe. So nannte man bald in Barmen und Elberfeld alle Fuhrleute ganz allgemein „die Waldecker“. Die ausgewanderten Mädchen verdienten ihr Geld immer als Dienstmagd.
Bald erhielten die Daheimgebliebenen Nachricht von den gut verdienenden Verwandten, was weitere Auswanderungen nach sich zog. Die Großstadt Barmen-Elberfeld lockte immer mehr junge Leute aus Waldeck an, die Abwanderung nahm derart zu, dass Barmen - Elberfeld als „heimliche Hauptstadt Waldecks“ bezeichnet wurde.
4. Bevölkerungsbewegungen im 20. Jahrhundert
Vor und nach dem Ersten Weltkrieg stagnierte der Bevölkerungszuwachs und erst nach einigen Jahren wanderten kleine Gruppen italienischer Gastarbeiter ein, um an Staumauern, Brücken, usw. zu arbeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen 55400 Vertriebene aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen, dem Ostteil Brandenburgs und außerdeutschen Staaten Ostund Südeuropas bis ins Jahr 1960 nach Wuppertal. Auch aus Berlin und der ehemaligen DDR stammten weitere 31554 Menschen. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung nahm immer mehr zu, 1970 lebten in Deutschland schon 34740 Ausländer, 1960 waren es noch 4590 gewesen. Allein in den Jahren 1961-1970 verzeichnete Wuppertal 153200 Zuwanderungen, denen jedoch auch 158200 Fortgezogene gegenüberstanden. Zur Zeit liegt die Bevölkerungszahl Wuppertals bei 375378, der Ausländeranteil beträgt 53040 Einwohner, das entspricht ca.14% der Gesamtbevölkerung Wuppertals.
Verwendete Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Der Text befasst sich mit der Bevölkerungsentwicklung in Wuppertal, insbesondere mit den Zuwanderungen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert und den Ursachen für das Wachstum der Stadt.
Welche Zeiträume werden im Text behandelt?
Der Text behandelt hauptsächlich die Zeit vom 16. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert, wobei der Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert und der damit verbundenen Bevölkerungsexplosion liegt.
Welche Ursachen werden für die Bevölkerungsexplosion im 19. Jahrhundert genannt?
Die Bevölkerungsexplosion im 19. Jahrhundert wird auf zwei Hauptfaktoren zurückgeführt: einen Geburtenüberschuss (mehr Geburten als Sterbefälle) und einen Wanderungsgewinn (mehr Zuwanderungen als Abwanderungen). Die Industrialisierung bot Arbeitsplätze, die Menschen aus ländlichen Gebieten anzogen.
Aus welchen Regionen kamen die Zuwanderer?
Die Zuwanderer kamen hauptsächlich aus ländlichen Gebieten Westdeutschlands, insbesondere aus dem Oberbergischen Land, Hessen (vor allem Waldeck), Westfalen, dem Rheinland, aber auch aus Frankreich und den Niederlanden.
Welche Rolle spielte die Industrialisierung in der Bevölkerungsentwicklung?
Die Industrialisierung spielte eine entscheidende Rolle, da sie Arbeitsplätze schuf und somit Menschen aus ländlichen Gebieten anzog, die auf der Suche nach Erwerbsmöglichkeiten waren. Barmen und Elberfeld entwickelten sich so zu Industriegroßstädten.
Welche spezifischen Beispiele für Zuwanderergruppen werden genannt?
Der Text nennt Beispiele wie Waldecker, Homburger, Schwarzenberger, Sauerländer und Hessen, die im 19. Jahrhundert nach Wuppertal kamen. Besonders die Waldecker werden hervorgehoben, da sie einen großen Teil der Zuwanderer stellten.
Wie veränderte sich die Bevölkerungsstruktur Wuppertals im 20. Jahrhundert?
Im 20. Jahrhundert stagnierte der Bevölkerungszuwachs zunächst. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und der DDR nach Wuppertal. Später stieg der Anteil ausländischer Bevölkerung durch Gastarbeiter.
Welche Rolle spielten religiöse Gründe für Zuwanderung?
Religiöse Gründe spielten vor allem bei der Gründung Ronsdorfs eine Rolle. Elias Eller gründete dort eine reformierte Gemeinde, was zu Zuzügen aus verschiedenen Regionen führte.
Welche wirtschaftlichen Faktoren beeinflussten die Zuwanderung der Waldecker?
Die Zuwanderung der Waldecker wurde durch die wenig fruchtbaren Böden in Waldeck und das Verbot der Teilung von Bauerngütern begünstigt. Wuppertal bot bessere Arbeitsmöglichkeiten, und es gab familiäre Netzwerke, die bei der Vermittlung von Arbeitsstellen halfen.
- Quote paper
- David Noack (Author), 2000, Der Bevölkerungszuwachs Wuppertals, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106329