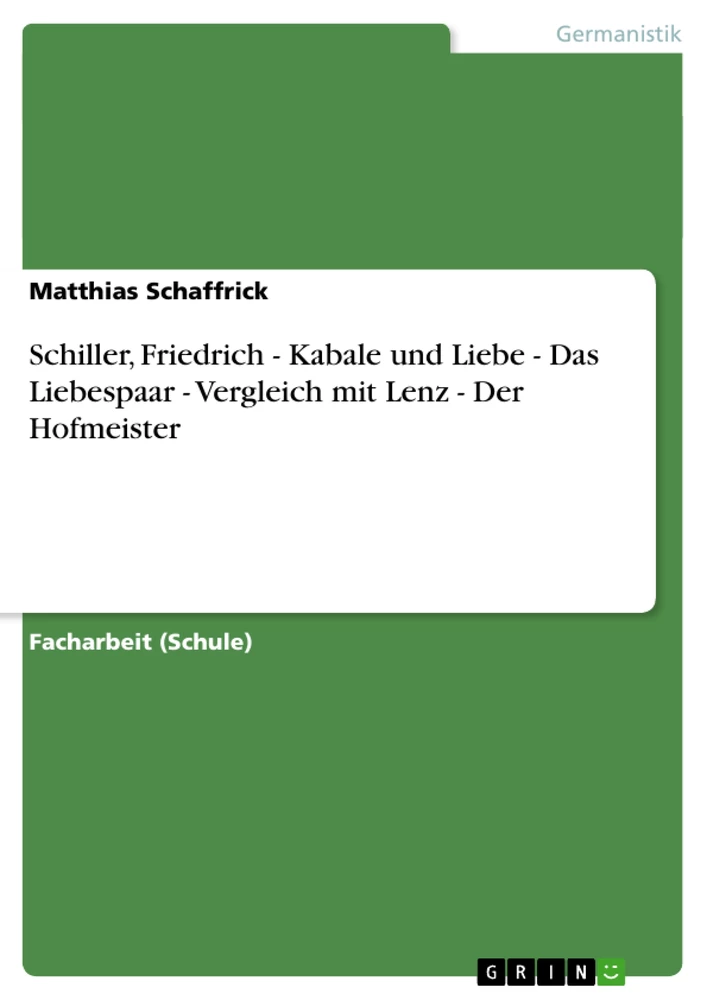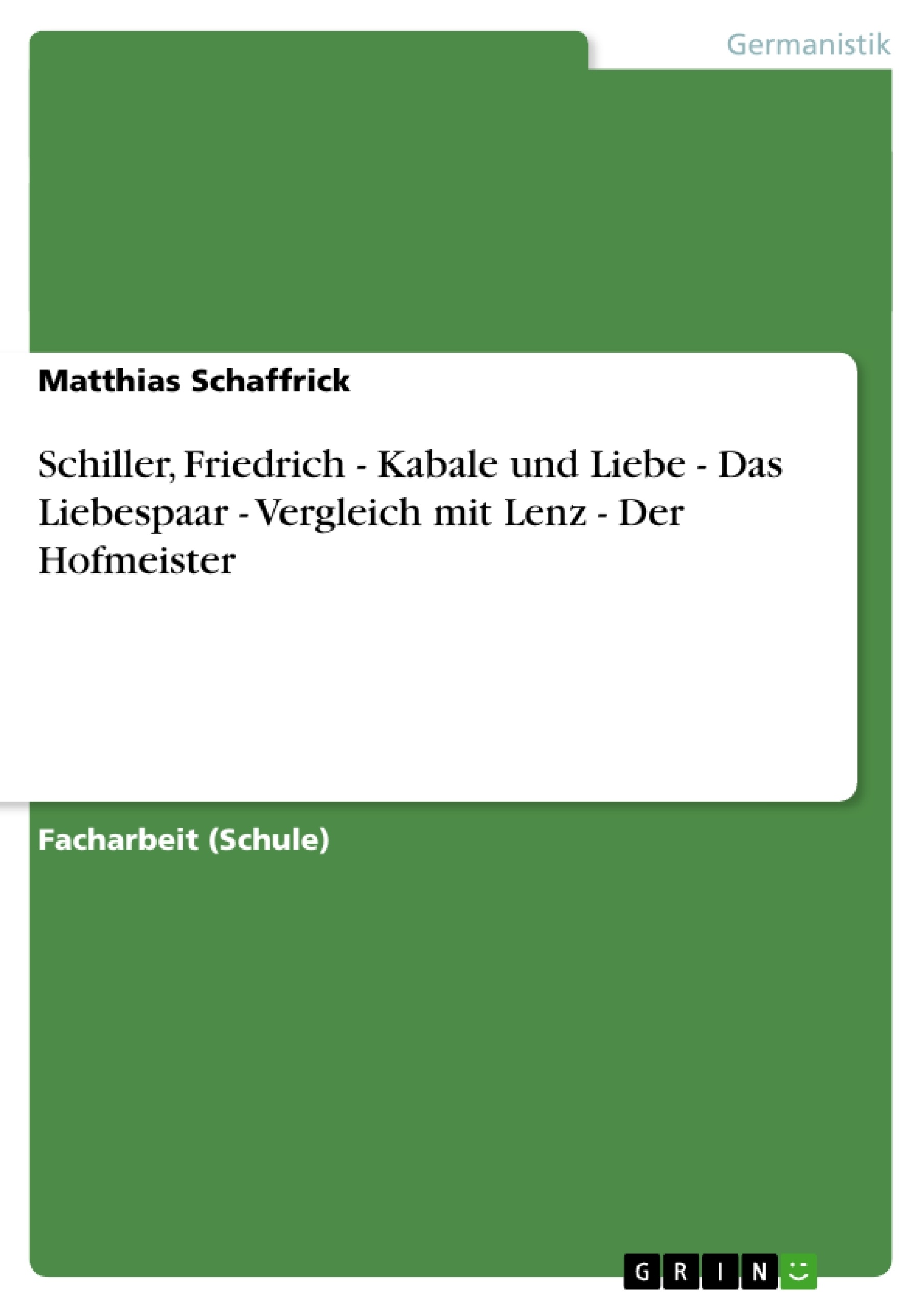Was, wenn die Liebe selbst zur tödlichsten Waffe wird? In Friedrich Schillers bürgerlichem Trauerspiel „Kabale und Liebe“ entfaltet sich eine herzzerreißende Geschichte um die unüberwindbaren Standesunterschiede und die zerstörerische Macht von Intrigen am Hofe. Ferdinand von Walter, ein junger Adliger, und Luise Millerin, eine bürgerliche Musikertochter, lieben einander leidenschaftlich, doch ihre Verbindung wird von Ferdinands Vater, dem machthungrigen Präsidenten von Walter, und seinem intriganten Sekretär Wurm aufs Äußerste bekämpft. Durch eine perfide Kabale, die Luise zwingt, einen falschen Liebesbrief zu schreiben, wird Ferdinands Eifersucht geschürt und das Paar in den Abgrund getrieben. Schillers Werk ist eine fulminante Anklage gegen die Willkür des Adels, die Korruption am Hof und die Unvereinbarkeit von Liebe und gesellschaftlichen Konventionen. Jakob Michael Reinhold Lenz' „Der Hofmeister“ hingegen, ein Schlüsselwerk des Sturm und Drang, wirft einen satirischen Blick auf die Verhältnisse in der deutschen Provinz. Der junge Hauslehrer Läuffer verführt Gustchen, die Tochter seines adeligen Dienstherrn, und stürzt dadurch in eine tiefe Krise. Lenz entlarvt die Heuchelei der adligen Gesellschaft und die bornierten Moralvorstellungen des Bürgertums, wobei er mit drastischen Bildern und einer entlarvenden Sprache die Absurdität der ständischen Ordnung vor Augen führt. Beide Dramen, obwohl in ihrer Ausgestaltung unterschiedlich, eint die Kritik an den gesellschaftlichen Zwängen ihrer Zeit und die Darstellung der fatalen Folgen, wenn individuelle Freiheit und wahre Gefühle den Interessen von Macht und Konventionen untergeordnet werden. „Kabale und Liebe“ und „Der Hofmeister“ sind somit nicht nur packende Liebesgeschichten, sondern auch zeitlose Mahnungen gegen die Unmenschlichkeit einer Gesellschaft, die den Wert des Einzelnen missachtet. Eine vergleichende Analyse dieser beiden Werke des Sturm und Drang offenbart die komplexen Wechselwirkungen zwischen Liebe, Standesdünkel und politischer Intrige, und zeigt, wie diese Kräfte das Leben des Einzelnen zerstören können. Tauchen Sie ein in die Welt des 18. Jahrhunderts, wo Leidenschaft auf Konvention trifft und das Schicksal seinen unerbittlichen Lauf nimmt.
Inhalt
1 Einleitung
2 Kabale und Liebe - Luise und Ferdinand
2.1 Ablauf
2.2 Darstellung
2.3 Sprache
3 Der Hofmeister - Gustchen und Läuffer
3.1 Ablauf
3.2 Darstellung
4 Eine vergleichende Auswertung
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Innerhalb der Unterrichtsreihe „Geschlossene Form des Dramas am Beispiel der Dramen des 18./19. Jhdt." haben wir uns im Leistungskurs Deutsch mit Schillers Sturm-und-Drang-Drama „Kabale und Liebe" auseinandergesetzt. Inhaltlich haben wir uns dabei mit dem Aufbau des Dramas, der Charakterisierung der Figuren und der Form des Dramas als bürgerliches Trauerspiel beschäftigt. Zudem wurden Schillers Leben und Werk und die historischen Bezüge des Dramas behandelt.
Der Titel „Kabale und Liebe“ impliziert, dass das Stück von einer Liebesbeziehung und einer damit verbundenen Hofintrige handelt. Dieses Verhältnis wurde innerhalb des Unterrichts schon eingehend behandelt. Es handelt sich um die Liebesbeziehung zwischen dem jungen Adligen Ferdinand von Walter und der bürgerlichen Geigerstochter Luise Millerin.
Als interessantes und bearbeitenswertes Thema habe ich mir dann die nähere Beschäftigung mit diesem Liebespaar und einen Vergleich mit einem anderen Liebespaar überlegt. Dabei lag es nahe, ein Liebespaar aus einem Drama der gleichen Epoche zu wählen, um zugleich den Versuch der Herausarbeitung epochentypischer Elemente in der Liebesdarstellung anzustellen. Als zum Vergleich geeignetes und sich nicht nur durch Übereinstimmungen auszeichnendes Liebespaar erschienen mir die Majorstochter Gustchen und der Hofmeister Läuffer aus dem ebenfalls zu den Dramen des Sturm und Drang zählenden Stück „Der Hofmeister“ von Jakob Michael Reinhold Lenz. So ergab sich nach Absprache mit meinem mich betreuenden Lehrer als offizielles Thema der Facharbeit:
Das Liebespaar in Schillers „Kabale und Liebe“ und in Lenzens „Der Hofmeister“. Ein Vergleich Anmerkung: Die Seitenangaben im laufenden Text und die Belege der meist in Klammern angeführten Zitate beziehen sich auf die Ausgabe der beiden Dramen aus dem Hamburger Lesehefte Verlag (61. und 168. Heft).
2 Kabale und Liebe - Luise und Ferdinand
Schillers Drama „Kabale und Liebe“ ist 1784 erschienen und behandelt die tragisch endende Liebe zwischen dem adligen Ferdinand von Walter und der bürgerlichen Luise Millerin, deren Liebe an sowohl äußeren - in Form von Intrigen - als auch inneren, also mit der Lebenseinstellung zusammenhängenden, Einflüssen scheitert.
2.1 Ablauf
Luise ist das erste Mal verliebt und von ihrem adligen Freund Ferdinand überwältigt. Ihr fällt es schwer klare Gedanken zu fassen (I,3). Ihrem Vater, der ein Stadtmusikant ist, missfällt dieses Verhältnis, da er befürchtet, dass seine Tochter von Ferdinand sexuell ausgenutzt wird (I,1). Ferdinands Vater, Präsident von Walter, sieht die Verbindung im ersten Moment als positiv an, da seiner Meinung nach sein Sohn in der Beziehung mit einem bürgerlichen Mädchen seine ersten Erfahrungen machen könne (I,5). Sein ebenfalls an Luise interessierter Sekretär Wurm hat ihm von der Verbindung seines Sohnes mit Luise berichtet. Nachdem der Präsident von seinem Sohn selbst von dieser für Ferdinand ernsten Liebe gehört hat, erzürnt er sich sehr, da er die Liebe zwischen einem Adligen und einer Bürgerlichen für nicht angemessen hält und zudem Absichten hatte ihn mit persönlichen Vorteilen verbunden innerhalb des Hofes zu verheiraten (I,7).
Daraufhin dringt der Präsident in Millers Haus ein und versucht die weitere Beziehung zwischen Luise und Ferdinand durch Drohungen und Gewalt zu unterbinden. Im letzten Moment macht Ferdinand jedoch eine auf die Karriere des Präsidenten bezogene Anmerkung, die ihn davon abhält, Luise und ihre Eltern zu verhaften (II,6 und 7).
Im Folgenden überlegen sich der Präsident und Wurm eine Methode mit der sie Ferdinand von Luise abbringen wollen: Luise soll durch die Verhaftung ihrer Eltern gezwungen werden, einen erdachten Brief an einen anderen Mann zu schreiben, welcher anschließend Ferdinand zugespielt werden soll, um seine Eifersucht zu wecken und sich von Luise zu trennen. Zudem muss Luise einen Eid darauf ablegen, die Intrige zu verschweigen (III,1). Dieser Plan wird sodann auch durchgeführt (III,6). Zuvor hat Ferdinand versucht Luise zu einer Flucht zu überreden, welche sie jedoch mit Verweis auf die Liebe zu ihrem Vater abgelehnt hat (III,4).
Nachdem Ferdinand den Brief erhalten hat, beschließt er in blinder Eifersucht, Luise und sich selbst zu töten (IV,4).
Luise, die wegen des Briefes, den sie zu schreiben gezwungen wurde und Ferdinands eifersüchtiger Reaktion auf ihre Ablehnung der Flucht, verzweifelt beschlossen hat Selbstmord zu begehen, trifft ihren Vater wieder und lässt sich durch ihn von ihrem Vorhaben abbringen (V,1). Ferdinand kommt hinzu und schickt Miller mit einem Brief zu seinem Vater (V,6). Anschließend führt er seinen Plan Luise und sich selbst zu töten durch, indem er ihre gemeinsame Limonade vergiftet. Erst kurz vor ihrem Tod bricht Luise ihren Eid und erzählt Ferdinand von der Intrige, welcher sterbend seinen Fehler erkennt (V,7).
2.2 Darstellung
Wie hat Schiller die beiden Figuren des Liebespaares dargestellt?
Luise äußert schon bei ihrem ersten Auftritt (I,3) ihre Hoffnung auf eine jenseitige Erfüllung ihrer Liebe zu Ferdinand, wenn die ihr „verhasste(n) Hülsen des Standes“ (S. 10) gebrochen sind. Die Äußerung macht nicht nur ihre religiöse Weltanschauung sondern auch ihre realistische Einschätzung der Situation deutlich. Sie weiß um den ständischen Unterschied, der zwischen ihr und Ferdinand liegt und ihnen eine glückliche Erfüllung ihrer Liebe in diesem Leben unmöglich macht. Sie ist bereit Ferdinand in Hinblick auf die ihr unüberwindlichen Standesschranken, die für Luise eine „allgemeine ewige Ordnung“ bedeuten (S. 50), zu entsagen1.
Zum einen ist es der Glaube an diese „ewige Ordnung“ der Stände, zum anderen ihre stark ausgeprägten, bürgerlich-moralischen Vorstellungen, die z. B. in der Aussage „Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann, so hab ich noch Stärke, dich zu verlieren“ (S. 50) deutlich werden und ihr eine skeptische Betrachtung („Ich seh in die Zukunft - [...] - mein Nichts.“ (S. 11)) der Beziehung ermöglichen. Ferdinand reagiert auf dieses Bekenntnis überrascht (steht still und murmelt düster: „Wirklich?“), da ihm nicht bewusst war, wie hoch Luise ihre moralischen Ansichten einordnet.
Ferdinand dagegen liebt Luise zunächst einmal uneingeschränkt. Für ihn gibt es als höchste Instanz nur sein Herz, seine Empfindungen und seine Leidenschaft, Begriffe, die Ferdinand selbst bei seinen Auftritten permanent gebraucht. So bekennt er vor seinem Vater, dem Präsidenten: „Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben.“ (S. 18). Er möchte der Amoralität des Hofes entgehen (S. 17), indem er seinem Herzen folgt und die Erfüllung in einer von Einschränkungen freien Liebe („Du, Luise, und ich und die Liebe!“ (S. 49)) sucht. Dabei ist er sich der Standesschranken wohl bewusst („Ich weiß, worein ich mich stürze;...“ (S. 31)), doch sieht er sie als gefundene Herausforderungen für seine stürmische Leidenschaft („groß und vermessen wie meine Leidenschaft“ (S. 49)) an. An zwei Stellen im Stück beansprucht er als Legitimation seiner Liebe das „Naturrecht“ und das „Menschenrecht“2. Ferdinand lässt sich also nicht von der die Gesellschaft bestimmenden Ständeordnung abbringen, eine glückliche Erfüllung seiner Liebe zu suchen.
Allerdings neigt er dabei zu Selbstüberschätzung und Anmaßungen, aus denen sein besitzergreifendes Liebesverständnis erwächst. Diese Einstellung wird im wiederholten Gebrauch des Possessivpronomens in der ersten Person Singular im Zusammenhang mit Luises Namen sehr deutlich (z. B. „Du bist meine Luise!“ (S. 11)). Der Wunsch Luise besitzen zu wollen geht mit der Anmaßung einher, ihr Schutzengel sein zu wollen („Du brauchst keinen Engel mehr...“ (S. 11)). Auf diese Weise wird in dieser Szene auch das Motiv der Eifersucht eingeführt, das für das letztendliche Scheitern der Beziehung eine wichtige Rolle spielt.
Zwar bleibt Ferdinands Liebe dem Himmel gleich unendlich und eine Flucht erscheint ihm nicht zu abenteuerlich (III,4), doch schaffen seine nicht zu verdrängenden, adligen Ansichten und seine Besitzansprüche eine unüberbrückbare Barriere zwischen ihm und Luise. In der Peripetieszene (III,4) wird Ferdinands nicht abzulegende, aristokratische Verhaltens- und Denkweise sehr deutlich. Anstatt Verständnis für Luises religiöses Pflichtgefühl gegenüber dem Vater3 aufzubringen, das ihr die Verweigerung der Flucht auferlegt, vermutet er hinter ihrer Absage einen anderen Liebhaber („Ein Liebhaber fesselt dich,“ S. 51)). Diese Vermutung scheint seiner adligen Denkweise und der Übertragung dieser auf seine Freundin zu entspringen4. Luise bestätigt diesen Eindruck in der Peripetieszene durch den Satz „..., und dein Herz gehört deinem Stande“ (S. 50). Damit macht sie Ferdinand deutlich, dass sein Herz als höchste Instanz für sein Denken und Handeln den adligen Einstellungen des Hofes verhaftet geblieben ist.
Die Eifersucht des völlig verblendeten Ferdinands und die Erkenntnis, dass er Luise nicht besitzen kann, bringen ihn so sehr aus der Fassung, dass er eine Geige Millers zerstört und Luise als lügende „Schlange“ beschimpft (S. 50 f.). So erleidet die zuvor harmonische Liebe einen schweren Rückschlag, der sich bis zum tragischen Ende nicht ausgleichen lässt.
Die schon erwähnte bürgerlich-moralische und religiöse Einstellung Luises, die für die Ablehnung der gemeinsamen Flucht verantwortlich ist, wird im weiteren Verlauf des Dramas erneut deutlich.
Zum einen in der ersten Szene des fünften Aktes, in der sie ihrem Vater anvertraut, Selbstmord begehen zu wollen, dieser sie jedoch von ihrem Vorhaben abbringen kann. Luise hat erkannt, dass ihre Liebe nur an „einem dritten Ort“ (S. 75) in Erfüllung gehen kann. Miller kann diese Tat jedoch mit Verweis auf die Frevelhaftigkeit dieses sündigen Vorhabens („Selbstmord ist die abscheulichste [Sünde], mein Kind“ (S. 76)) und einem hoch emotionalen („indem er laut weinend fortstürzen will“ (S. 78)) Appell an ihre Vaterliebe verhindern (S. 77 f.). Die „Herzen“ der Beteiligten spielen in dieser Szene erneut in der Wortwahl eine entscheidende Rolle. Luise schreibt an Ferdinand: „...; nichts kannst du brauchen als dein Herz.“ (S. 75) und Miller fordert Luise auf: „Hier ist ein Messer - durchstich dein Herz, und [...] das Vaterherz!“ (S. 77 f.).
Zum anderen demonstriert sie ihre Moralität in ihrem langen, abschließenden Dialog mit Ferdinand, in dem sie durch Ferdinands vergiftete Limonade verursacht stirbt (V,7). Ferdinand hatte sich in durch Luises Fluchtverweigerung hervorgerufener, blinder Eifersucht und der übermäßigen Anmaßung, Luise zu besitzen und über sie zu richten („Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jetzt ihr Teufel!“ (S. 62)), entschlossen, sich und Luise zu töten (IV,4). Sein Unverständnis und seine Verblendung gehen in dieser Situation soweit, dass er das klimaktisch aufgebaute Geständnis des Hofmarschalls „Ich sah sie nie. Ich kenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr“ (S. 62) erbost als unverschämte Lüge abstempelt.
Die siebte Szene des fünften Aktes zeigt schon durch die einleitende Regieanweisung die Entfremdung des Liebespaares, welche nicht mehr zu verhindern gewesen ist, und im folgenden, von Ablenkungen (Luise (S. 87)) und Zynismus (Ferdinand (S. 88)) bestimmten Dialog noch voran geht5. Im weiteren Verlauf ihres Gesprächs quält Ferdinand die durch den Eid gebundene und zum Schweigen verpflichtete („Das anzuhören und schweigen zu müssen!“ (S. 90)) Luise mit von Ich-Bezogenheit geprägten Ausführungen (S. 89 f.), in denen er sich die Notwendigkeit seiner Tat erneut vor Augen führt („Ich muss die Natter zertreten, oder verzweifeln...“ (S. 89)). Luise aber bricht ihren Eid erst, als Ferdinand ihr gesteht, dass er sie beide vergiftet hat (S. 91), da „sich Luise bis zum Tod an den erzwungenen Eid gebunden fühlt, da die Tugend einen wesentlichen Teil ihrer bürgerlichen Identität ausmacht“6, die sie unter keinen Umständen aufgeben will. „...der Tod hebt alle Eide auf“, (S. 92) meint Luise und gesteht Ferdinand: „...dein Vater hat ihn [den Brief] diktiert.“ (S. 92). Doch zunächst legt Ferdinand sein egoistisches Verhalten nicht ab und denkt nur an die Rache an seinem Vater („Mörder und Mördervater!“ (S. 92)) und maßt sich erneut an, den irdischen Vertreter des „Richter(s) der Welt“ (S. 92) spielen zu müssen. Dann erst, viel zu spät, als Luise schon gestorben ist, versucht er alles zu stoppen („Halt! Halt!“ (S. 92)) und erkennt voller Schmerz, dass Luise ein „Engel des Himmels“ (S. 92) ist.
Bis kurz vor Luises Tod bleiben die Positionen der beiden also unvereinbar: Luise beharrt konsequent auf der Erfüllung ihrer bürgerlich-moralischen Vorstellungen. Ferdinand bleibt verblendet und auf sich bezogen, überschätzt sich und entwickelt kein Verständnis für Luises Verhalten.
2.3 Sprache
Die Sprache der Liebenden ist eine „Sprache des Herzens“, die vor allem in den symmetrisch im Drama eingegliederten Szenen Ferdinands und Luises gebraucht wird (I,4; III,4; V,7), aber auch in anderen Szenen, die von Liebe und Gefühlen handeln, Verwendung findet, z. B. in den Unterhaltungen der Hauptcharaktere mit ihren Vätern (I,7; V,1). Zunächst einmal weist ihre Sprache „so gut wie keine ständischen Momente auf“7, was Ferdinand und Luise von den anderen Figuren des Stückes (ausgenommen Lady Milford) unterscheidet. Dabei ist vornehmlich auf Ferdinands und Luises Wortwahl zu achten, die von den Worten „Herz“ (S. 10, S. 12, S. 18, S. 34, S. 50, S. 89), „Empfindung“ (S. 11, S. 88, S. 90) und „Leidenschaft“ (S. 31, S. 49) geprägt ist. Ferdinands Sprache wirkt pathetisch und abstrakt, wohingegen Luise mit ihrer Sprache Glaubwürdigkeit erlangen und Gefühligkeit ausdrücken kann8. Schon die Wortwahl Ferdinands lässt erkennen wie sehr er auf sein „Herz“ als Instanz für seine Verhaltensweise vertraut9 und die beinahe „uneingeschränkte Entfaltung von Gefühlen“ beabsichtigt. Dies zeichnet ihn als typischen Vertreter der Sturm-und-Drang-Dichtung, als „Stürmer und Dränger“, aus.
3 Der Hofmeister - Gustchen und Läuffer
Das Sturm-und-Drang-Drama „Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung“ von Jakob Michael Reinhold Lenz aus dem Jahre 1774 hat mehrere Handlungsebenen. Das Stück behandelt das Thema der Privaterziehung durch Hofmeister und - und das ist im folgenden von hauptsächlichem Interesse - die Liebesbeziehung zwischen der adligen Majorstochter Gustchen von Berg und ihrem Hofmeister Hermann Läuffer. Zudem enthält das Drama eine Nebenhandlung, die das Leben dreier Studenten schildert.
3.1 Ablauf
Der Pastorensohn Läuffer übernimmt eine Hofmeisterstelle in der Majorsfamilie von Berg. Zunächst besteht seine Aufgabe nur in der Unterrichtung des Sohnes Leopold, doch beauftragt der Major ihn bald zusätzlich mit Religions- und Zeichenunterricht für seine Tochter Gustchen (I,4), die mit ihrem Cousin Fritz von Berg eine Verlobung eingeht (I,5 und 6).
Nach zwei Jahren als Hofmeister in der Familie von Berg und mittlerweile von Insterburg nach Heidelbrunn umgezogen, klagt Läuffer seinem Vater von seiner zunehmenden Isolation und seinen finanziellen Nöten (II,1). In Heidelbrunn ist er nun mit der Unterrichtung Gustchens beschäftigt. Zwischen Läuffer und seiner Schülerin entwickelt sich eine Liebesbeziehung (II,2 und 5), die von der Majorin aufgedeckt wird (III,1), was zur getrennten Flucht Gustchens und Läuffers führt. Läuffer kommt bei dem verschrobenen Dorfschulmeister Wenzeslaus unter (III,2), und Gustchen findet bei einer alten Bettlerin im Wald Unterschlupf (IV,2).
Nach einem Jahr spüren der Major, sein Bruder, der Geheime Rat, und der frühere Verehrer Gustchens, Graf Wermuth, Läuffer im Haus des Dorfschulmeisters auf. Dieser kann ihnen jedoch nur gestehen, dass er damals von Gustchen getrennt geflüchtet sei (IV,3). Kurz darauf entdecken die drei Herren Gustchen kurz vor ihrem Ertrinken in einem nahe gelegenen Teich und der Major kann sie retten (IV,4 und 5). Wie sich nun herausstellt, ist aus der Beziehung zwischen Gustchen und Läuffer ein Kind hervorgegangen, das auch Läuffer durch Zufall zu sehen bekommt (V,1). Er bereut seine Tat und kastriert sich (V,3). Letztendlich findet er aber trotz der verlorenen Manneskraft ein Mädchen, das ihn zu heiraten bereit ist (V,10). Gustchen wird mit ihrem Kind wieder in ihre Familie aufgenommen und mit dem das Kind akzeptierenden Fritz zusammengeführt (V,12).
3.2 Darstellung
Welche Form der Liebesbeziehung stellt Lenz im „Hofmeister“ dar?
Läuffer bekommt bei der Familie von Berg eine Hofmeisterstellung, was aber nicht sein eigentlicher Berufswunsch ist (I,1). Trotzdem übernimmt er die Stelle als Hofmeister, die, wie sein Vater behauptet und selbst erfahren hat, ein „Sprungbrett“ zur Karriere in einem öffentlichen Amt sein kann10. Durch den zusätzlichen Auftrag seines Arbeitgebers, des Majors, seiner von ihm verehrten Tochter (S. 8 f.) Zeichenund Religionsunterricht zu geben (I,4), lernt er Gustchen kennen. In der von Lenz erst nachträglich eingefügten Szene II,2 wird eine erste, vorsichtige Annäherung zwischen Gustchen und Läuffer deutlich11.
In dieser Szene sind die beiden noch sehr voneinander distanziert. Diese Distanz macht sich in der siezenden Anrede bemerkbar, die in ihrer zweiten gemeinsamen Szene (II,5) schon aufgehoben ist. Läuffer reagiert auf Gustchens Versäumnis, ein „Porträt“ zu zeichnen, und ihre Entschuldigung, dass sie einen „Schnupfen“ habe, überzogen erregt und affektiert („Ich denke, wir hören ganz auf zu zeichnen.“ (S. 19), „Ich sehe doch, dass es Ihnen auf die Länge unausstehlich wird, von mir Unterricht anzunehmen“ (S. 20)). Sicherlich versucht er durch eine solche Reaktion Gustchens Mitgefühl zu erlangen, welches sie im letzten Satz, als Läuffer schon abgegangen ist, äußert (Wie dauert er mich!“ (S. 20)). Zuvor hat sie schon ihre Aufmerksamkeit für Läuffers elende Situation gezeigt. So ist ihr aufgefallen, dass ihm die Augen „immer voll Wasser“ stehen und er nichts mehr isst (S. 19). Darauf antwortet Läuffer zynisch, dass Gustchen „ein rechtes Muster des Mitleidens“ sei (S. 19). Die Regieanweisung „halb weinend“ (S. 19) bestätigt das von ihrem Vater schon angedeutete weinerliche, leicht verletzliche Gemüt Gustchens („...gleich stehen ihr die Backen in Feuer und die Tränen laufen ihr wie Perlen drüber herab.“ (S. 9)). Zudem kommt es in dieser Szene zu einem ersten körperlichen Kontakt der beiden, denn „sie fasst ihn an der Hand“ (S. 19). Das Interesse der beiden füreinander wird in dieser Szene jedenfalls ansatzweise deutlich.
Läuffers miserable finanzielle Situation ist zunächst das Thema in der zweiten, viel intimeren („Gustchen liegt auf dem Bette,“ (S. 25)) Szene (II,5), in der sie bereits zum „Du“ übergegangen sind. Gustchen ist wohl die einzige Person in Heidelbrunn, mit der Läuffer über seine Sorgen und Probleme sprechen kann. Läuffer hatte seinem Vater jedenfalls einen Brief geschrieben, in dem er schildert, „wie elend es mir hier geht“ (S. 18). Darin spricht er von seiner zunehmenden Abschottung und Isolation („...und in einem ganzen Jahr meinen Fuß nicht aus Heidelbrunn habe setzen können...“ (S.18)) und bittet ihn den Bruder des Majors, den Geheimen Rat, aufzusuchen, damit dieser seinen Bruder ersuchen könne das bis zu einem Minimum herabgesetzte Gehalt (S. 14) wieder zu erhöhen. Aber „der Geheime Rat will nicht“ (S. 25) und Läuffer zieht gedrängt durch seine massiven monetären Sorgen den Schluss: „Ich muss quittieren.“ (S. 25).
Darauf reagiert Gustchen in ihrer schon erwähnten, weinerlich sentimentalen Art und ergeht sich selbstbemitleidend in der klimaktisch aufgebauten Aussage: „Niemand fragt nach mir, niemand bekümmert sich um mich; meine ganze Familie kann mich nicht mehr leiden;“ (S. 25).
Läuffer beklagt zudem die Demütigungen durch Gustchens Bruder, der ihm eine „Ohrfeige“ gegeben hat, gegen die er sich wegen der Einstellungen der Eltern nicht zur Wehr setzen kann (S. 26). Seine Ausweglosigkeit und Unterlegenheit hängt neben dem Standesunterschied sehr stark mit seiner devoten, unterwürfigen Verhaltensweise gegenüber den adligen Personen zusammen. So geht er z. B. am Major und dem Geheimen Rat „mit viel freundlichen Scharrfüßen vorbei“ (S. 3). Noch deutlicher beweist er dies in der Unterhaltung mit der Majorin, in der er in „sehr demütiger Stellung“ auftritt, sich ihr anpasst, sich herumkommandieren lässt („...mir ein Kompliment aus der Menuett zu machen;“) und durch plumpe Schmeicheleien
(„...der auf seinem Instrument Euer Gnaden Stimme zu erreichen hoffen dürfte!“) auffällt (alles S. 5). Dieses den „Monarchen huldigende“ Verhalten wird auch vom Geheimen Rat in der Unterhaltung mit Läuffers Vater als die adlige Denkweise bestätigend kritisiert (S. 17).
Gustchen reagiert verzweifelt und beginnt aus Shakespeares Liebestragödie „Romeo und Julia“ zu rezitieren. Dabei mag sie an ihren Verlobten Fritz denken, denn in ihrer Verlobungsszene (I.5) tauchte das Romeo-und-Julia-Motiv schon einmal auf12. Außerdem wird hier auch ihr Hang zum „Schwärmerischen“ (Läuffer S. 26) und Träumerischen deutlich, dessen Ursache ihr Vater in ihrer Vorliebe für „Bücher“ und „Trauerspiele“ (S. 9) vermutet. Ihre gesamte Liebeseinstellung ist dadurch stark geprägt.
Am Ende des Dialogs deutet Läuffer nach langem Nachdenken („Bleibt nachsinnend sitzen.“, „fällt wieder in Gedanken“ (S. 26)) mit Verweis auf „Abaelard“ auf die vermutliche Schwangerschaft hin. Außerdem führt er damit das Motiv der Kastration ein. Der Philosoph Abälard war, nachdem er seine privat unterrichtete Schülerin Heloїse verführt und mir ihr ein Kind gezeugt hatte, überfallen und entmannt worden13. Gustchen streitet die Vermutung ab und behauptet, die Krankheit sei psychosomatisch bedingt („Meine Krankheit liegt im Gemüt“ (S. 26)).
Die Szene endet mit dem für Läuffer typischen Davonlaufen14. Er flüchtet vor dem Major aus Angst vor einem Konflikt.
Nachdem die Majorin die den Ruf der Familie zerstörende Liebesbeziehung („Wir sind verloren - Unsere Familie, unsere Familie!“ (S. 33)) aufgedeckt hat, indem sie ihre Tochter und Läuffer in flagranti erwischt hat, flüchtet Läuffer in Angst um sein Leben („Man steht mir nach dem Leben.“ (S. 34)) zu dem Schulmeister Wenzeslaus und taucht dort unter. Von da an arbeitet Läuffer bei ihm als unbezahlter „Kollaborator“ (S. 41).
Letztendlich kastriert er sich aus „Reue“ und „Verzweiflung“ (S. 58) und wird somit für Wenzeslaus zum „zweiten Origines“ (S. 58), der ein griechischer Kirchenvater und Philosoph war, der sich in seiner Jugend aus religiösen Gründen entmannte15.
Daraufhin zieht Läuffer das von Verzweiflung gekennzeichnete Fazit: „O Unschuld, welch eine Perle bist du. Seit ich dich verloren, tat ich Schritt auf Schritt in der Leidenschaft und endigte mit Verzweiflung.“ (S. 59). Dies zeigt, dass er seine Taten, auch die Beziehung zu Luise, bereut und vergebenen Chancen nachtrauert. Der gesellschaftliche Aufstieg, den er sich aus der Beziehung mit einer Adligen zu erreichen hoffte („..., dass die Aussichten in eine selige Zukunft mir alle die Mühseligkeiten [Isolation und Geldknappheit] meines gegenwärtigen Standes“ (S. 19)), wurde ihm nicht zuteil, sondern er sinkt in seiner sozialen Stellung nur weiter herab16. Wenigstens findet er abschließend ein Mädchen, das ihn trotz seiner Kastrierung heiraten möchte (V,10).
Gustchen wird, nachdem sie ein Jahr bei der blinden Bettlerin Marthe verbracht hat, bei der es sich - was in der abschließenden, abstrusen Versöhnungsszene (V,12) klar wird - um die verstoßene Mutter eines Bekannten handelt, voller Freude wieder in die Familie aufgenommen. Auch ihr wahrer „Romeo“ Fritz verzeiht ihr und beabsichtigt Gustchen zu heiraten (S. 74 f.).
4 Eine vergleichende Auswertung
Beide Stücke werden der Epoche des Sturm und Drang zugerechnet. Damit müssen sie also typische Elemente dieser Epoche beinhalten.
Das Streben nach Freiheit und das Ausbrechen aus den von Menschen gesetzten Normen, besonders ständischen Vorschriften, spielt in dieser stark von der Aufklärung beeinflussten Epoche die entscheidende Rolle. Der Sturm und Drang unterscheidet sich insoweit von der Aufklärung, dass „die Emanzipation des Gefühls gegen die Herrschaft der Ratio“17 gesetzt wird. Das heißt, dass das subjektive Gefühl, die Leidenschaft, noch über der reinen Vernunft eingeordnet wird, was sich in Ferdinands Vertrauen auf sein „Herz“ ganz deutlich zeigt. Dabei bestehen die „Stürmer und Dränger“ auf das konsequente Ausleben dieser Einstellung.
Ferdinand eignet sich wohl am ehesten als Beleg für eine solche Beschreibung, aber auch Gustchen und Läuffer missachten die Standesschranken und demonstrieren ihr Bestreben nach sexueller Ungebundenheit und Selbstbestimmung. Das jeweils bei den adligen Figuren des Liebespaares stark vertretene Ausleben der Leidenschaften war gerade in den Adelskreisen verpönt, da es als triebhafter Affekt und somit Verlust der angestrebten Selbstbestimmung (Freiheit) gewertet wurde.
Dass beide Autoren die Beziehungen scheitern und mehr oder weniger dramatisch enden lassen, zeigt schließlich eine bedingte Skepsis gegenüber der vom Sturm und Drang propagierten, subjektiven und verabsolutierten Gefühlskultur. Bei Lenz vermag es vor allem der sich dem Adel anpassende Läuffer nicht aus den ihn bedrängenden Verhältnissen auszubrechen, sondern flüchtet erst als er sich existenziell bedroht fühlt. Deshalb scheitert er mit seinem Aufbegehren gegen die ihn einschränkende und bestimmende, ständische Ordnung.
Ferdinand und Luise scheitern auf diffizile Weise: Sie übernehmen sich mit ihrem Aufbegehren gegen die ständische Ordnung. Luise wird dies bewusst und besinnt sich auf ihre bürgerlich-moralischen Werte zurück. Ferdinand jedoch endet in verblendeter Selbstüberschätzung und reißt sie beide in den Tod. Dabei darf der zusätzlich negative Einfluss der Kabale nicht vergessen werden. So endet die Beziehung für sie beide tragisch.
Der „Hofmeister“ endet dagegen nicht tragisch. Für Gustchen bleiben ihre unstandesgemäße Beziehung und ihr „Fehltritt“ ohne Folgen. Läuffer kastriert sich zwar aus „Reue, Verzweiflung“, findet jedoch mit Lise ein ihn zu heiraten bereites Mädchen.
Der Aspekt der Sexualität bei Lenz auf der einen Seite, und der Leidenschaft bei Schiller auf der anderen in der Darstellung der Liebesbeziehungen hängt mit dem Ästhetikverständnis im Sturm und Drang zusammen. Sexualität und Leidenschaft, die grundsätzlich eng zusammen hängen, werden zunächst einmal dargestellt, um alte, festgesetzte Ästhetikvorschriften zu durchbrechen. Schließlich wird dies mit einem Kunstverständnis begründet, das die gesamte Natur darstellen will. Und dazu gehören auch Sexualität und Leidenschaft18.
Insgesamt macht die Liebesbeziehung in „Kabale und Liebe“ zusammen mit der Intrige die eigentliche Handlung des Dramas aus. Die Konflikte, die die beiden Liebenden miteinander und mit sich austragen, ist dabei auf das Wesentliche reduziert, in gewisser Weise idealisiert. Keinen der beiden plagen z. B. finanzielle Sorgen oder keiner wird durch seinen Beruf in seinem Verhalten eingeschränkt oder bestimmt, wie es bei Läuffer im „Hofmeister“ der Fall ist. Lenz stellt die Liebesbeziehung von der Konfliktsituation her betrachtet sicherlich realistischer dar als Schiller, der den Konflikt und das tragische Ende auch unter der Duldung „psychologischer Unwahrscheinlichkeiten“19 im Sinne der „dramatischen Effektivität“20 idealisiert.
Die Intention beider Autoren ist eine Anklage der Ständeordnung als Ursache massiver sozialer Missstände, wobei Lenz dies auf das Hofmeistertum konkretisiert. Bei Schiller beinhaltet die gesellschaftliche Kritik insbesondere einen Verweis auf die willkürliche, absolutistische Ordnung. Schiller kombiniert diese Absolutismuskritik darüber hinaus mit der Frage nach Moral und Amoral21, was sich in der Gegenüberstellung von bürgerlicher Moral und höfischer Amoral deutlich macht.
Beide Dramen stellen ein Liebespaar dar, das die Standesschranken missachtet und von den Einflüssen des Sturm und Drang bestimmt ist. Ihre Darstellung und die Art ihrer Beziehung unterscheiden sich jedoch in mehreren Aspekten.
5 Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Lenz, Jakob Michael Reinhold, Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, Husum (Hamburger Lesehefte Verlag)
Schiller, Friedrich von, Kabale und Liebe, Husum (Hamburger Lesehefte Verlag)
Sekundärliteratur
Daemmrich, Horst S. und Ingrid, Themen und Motive in der Literatur, Tübingen (Francke Verlag) 1987
Frenzel, Elisabeth, Motive der Weltliteratur, Stuttgart (Alfred Kröner Verlag) 1992 4
Große, Wilhelm, Von der Aufklärung zum Sturm und Drang.
Literaturgeschichtliche Längsschnitte, Hollfeld (C. Bange Verlag) 1989 Haffner, Herbert, Lenz: Der Hofmeister - Die Soldaten. Mit Brechts
„Hofmeister“-Bearbeitung und Materialien, München (R. Oldenbourg Verlag) 19791Hohoff, Curt, J. M. R. Lenz, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt Taschenbuch Verlag) 19934
Liewerscheidt, Dieter, Die Dramen des jungen Schiller. Einführende Untersuchung, München (R. Oldenbourg Verlag) 19821
Luserke, Matthias, Sturm und Drang. Autoren - Texte - Themen, Stuttgart (Reclam) 1997
Müller, Hans Georg, Klett Lektürehilfen. Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, Stuttgart - Dresden (Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung) 19945Müller, Udo, Klett Lektürehilfen. J. M. R. Lenz, Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung - Die Soldaten, Stuttgart (Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung) 1991 1
Struck, Hans-Erich, Oldenbourg Interpretationen. Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, München (R. Oldenbourg Verlag) 19982
Voit, Friedrich, Erläuterungen und Dokumente. J. M. R. Lenz, Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, Stuttgart (Reclam) 1986
Aufsätze
Becker-Cantarino, Barbara, Jakob Michael Reinhold Lenz: Der Hofmeister, aus: Interpretationen. Dramen des Sturm und Drang, Stuttgart (Reclam) 1987
Lappe, Claus O., Wer hat Gustchens Kind gezeugt? Zeitstruktur und Rollenspiel in Lenz` Hofmeister, aus: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 54, 1980, S. 14 - S. 46
[...]
1 Struck, Oldenbourg Interpretationen. Kabale und Liebe, S. 50
2 ebd. S. 54
3 „Es ist das Pflichtgefühl gegen den Vater, das Gebot der Elternliebe“, ebd., S. 52
4 Liewerscheidt, Die Dramen des jungen Schiller, S 67
5 Müller, H. G., Klett Lektürehilfen. Kabale und Liebe, S. 37
6 Struck, Oldenbourg Interpretationen. Kabale und Liebe, S. 28
7 Müller, H. G., Klett Lektürehilfen. Kabale und Liebe, S. 49
8 ebd., S. 49
9 Müller, H. G., Klett Lektürehilfen, Kabale und Liebe, S. 60
10 „Man muss eine Warte haben, von der man sich nach einem öffentlichen Amt umsehen kann, wenn man von den Universitäten kommt; [...] und ein Patron ist sehr oft das Mittel zu unserer Beförderung; wenigstens ist es mir so gegangen.“ (S. 16)
11 Voit, Erläuterungen und Dokumente. Lenz, Der Hofmeister, S. 25
12 Haffner, Lenz: Der Hofmeister - Die Soldaten, S. 21
13 Voit, Erläuterungen und Dokumente. Lenz, Der Hofmeister, S.31
14 Müller, Udo, Klett Lektürehilfen. Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung - Die Soldaten, S.52
15 Voit, Erläuterungen und Dokumente. Lenz, Der Hofmeister, S. 53
16 Haffner, Lenz: Der Hofmeister - Die Soldaten, S. 22
17 Struck, Oldenbourg Interpretationen. Kabale und Liebe, S. 63
18 Luserke, Sturm und Drang, S. 91 f.
19 Müller, H. G., Klett Lektürehilfen. Kabale und Liebe, S. 39
20 ebd. S. 22
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit über "Kabale und Liebe" und "Der Hofmeister"?
Die Facharbeit vergleicht die Darstellung von Liebespaaren in Friedrich Schillers "Kabale und Liebe" und Jakob Michael Reinhold Lenzens "Der Hofmeister", wobei untersucht wird, wie epochentypische Elemente des Sturm und Drang in der Liebesdarstellung zum Ausdruck kommen.
Welche Liebespaare werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden das Liebespaar Luise Millerin und Ferdinand von Walter aus "Kabale und Liebe" und Gustchen von Berg und Hermann Läuffer aus "Der Hofmeister".
Welche Aspekte der Beziehung von Luise und Ferdinand werden analysiert?
Die Arbeit untersucht den Ablauf ihrer Beziehung, Ferdinands Eifersucht, Luises bürgerlich-moralische Vorstellungen, die Standesunterschiede, die zur Tragödie führen, und die Sprache der Liebenden.
Wie wird die Beziehung zwischen Gustchen und Läuffer im "Hofmeister" dargestellt?
Die Analyse fokussiert sich auf Läuffers soziale Stellung als Hofmeister, die Entwicklung der Beziehung, Läuffers Kündigung und seine Kastration sowie Gustchens Schwangerschaft und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Welche Rolle spielt die Ständeordnung in den analysierten Dramen?
Die Ständeordnung wird als Haupthindernis für die Liebe zwischen Luise und Ferdinand in "Kabale und Liebe" dargestellt, während Läuffers soziale Stellung und Anpassung an den Adel im "Hofmeister" thematisiert werden.
Welche Sturm-und-Drang-Elemente werden in den Dramen identifiziert?
Das Streben nach Freiheit, die Emanzipation des Gefühls gegen die Ratio, die Missachtung ständischer Vorschriften und die Darstellung von Leidenschaft und Sexualität als Mittel zur Durchbrechung alter Ästhetikvorschriften werden als typische Elemente des Sturm und Drang hervorgehoben.
Wie unterscheidet sich die Darstellung der Liebesbeziehungen in "Kabale und Liebe" und "Der Hofmeister"?
Während "Kabale und Liebe" die Liebesbeziehung idealisiert und auf das Wesentliche reduziert darstellt, wird die Beziehung im "Hofmeister" realistischer und stärker durch soziale und finanzielle Aspekte beeinflusst dargestellt.
Welche Intention verfolgen Schiller und Lenz mit ihren Dramen?
Schiller kritisiert die Ständeordnung, den Absolutismus und die Frage nach Moral und Amoral, während Lenz das Hofmeistertum als konkretes Beispiel für soziale Missstände anprangert.
Welche sprachlichen Besonderheiten werden in der Facharbeit betrachtet?
Die Sprache der Liebenden, insbesondere die Verwendung von Begriffen wie "Herz", "Empfindung" und "Leidenschaft", sowie der Unterschied zwischen Ferdinands pathetischer und Luises gefühlvoller Sprache werden analysiert.
Welche Literatur wurde für die Facharbeit verwendet?
Es wurde sowohl Primärliteratur (die Dramen selbst) als auch Sekundärliteratur (Interpretationen, Monographien und Aufsätze zu Schiller und Lenz) verwendet. Eine Liste der verwendeten Literatur findet sich im Literaturverzeichnis.
- Quote paper
- Matthias Schaffrick (Author), 2001, Schiller, Friedrich - Kabale und Liebe - Das Liebespaar - Vergleich mit Lenz - Der Hofmeister, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106302