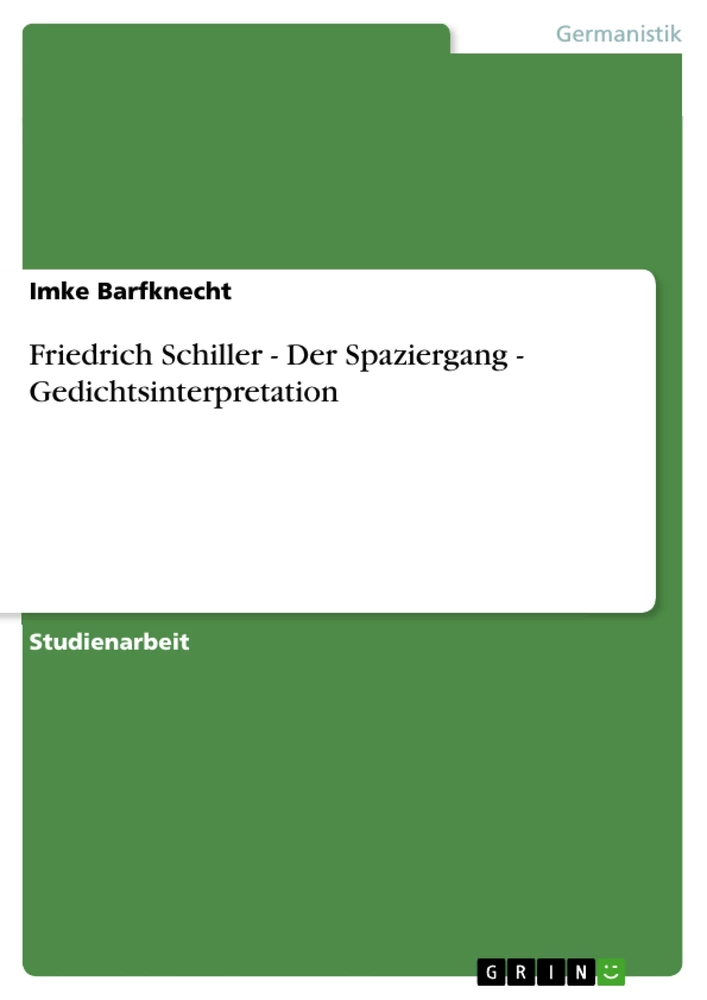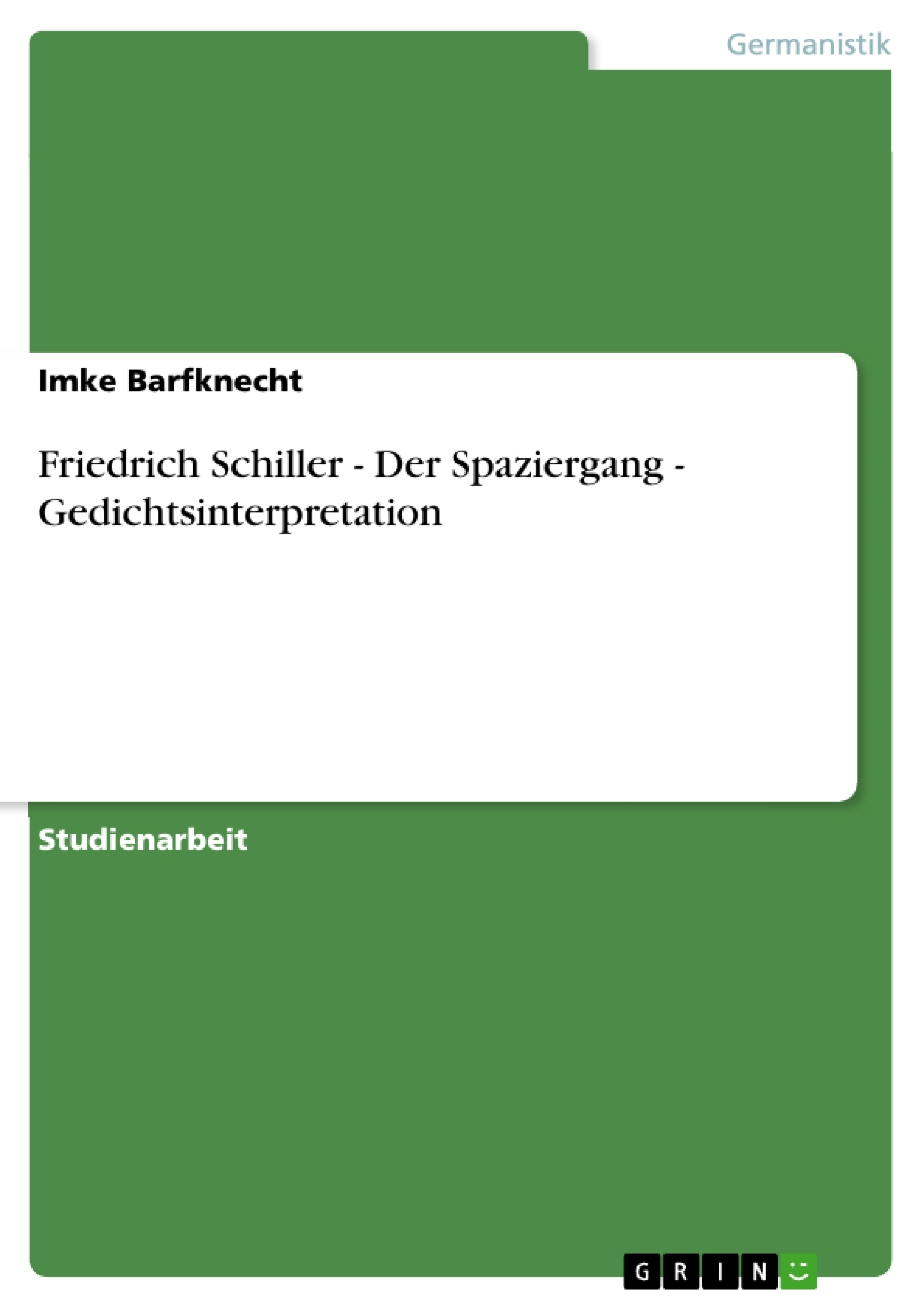1795 wandte sich Schiller wieder der Dichtung zu, nachdem er sich viele Jahre mit Geschichte und Philosophie beschäftigt hatte. Zu jener Zeit arbeitete er zu einer philosophisch durchdrungenen Poesie hin, weg von rethorischer Lehrdichtung. In diesem Jahr schrieb er die ”Elegie”, in der er seine vorhergehenden Arbeiten mit
Philosophie und Kulturtheorie verarbeitete. In seiner Versgestalt ist es eine Reihe von Distichen, die als zweizeilige Einheiten aus einem Hexameter und einem Pentameter bestehen. Es war Schillers erster Versuch im größeren Umfang am elegischen Versmaß. Daher nahm er für die zweite Auflage von 1800 einige Änderungen und Kürzungen vor, außerdem änderte er den Titel zu ”Der Spaziergang”. Trotz dieser Korrekturen ist diese Fassung ebenso elegisch im Versmaß wie die erste, auch Inhalt und Aussage haben sich im Ganzen nicht
geändert.(1) Inhaltlich ist der ”Spaziergang” keine einfache Darstellung dessen, was der lyrische Wanderer gerade vor Augen hat, vielmehr ist es eine durch Betrachtung vollzogene Reflexion über das Ganze der Natur und der Geschichte.
[...]
______
1 Wolfgang Riedel: Der Spaziergang. Ästhetik der Landschaft und Geschichtsphilosophie der Natur bei Schiller, Würzburg 1989, S. 17; Doris Maurer: Schillers ”Elegie” / ”Der Spaziergang”, in: Edition und Interpretation (Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Bd. 11) 1981, S. 255; Klaus Jeziorkowski: Der Textweg, in: Interpretationen: Gedichte von Friedrich Schiller, hrsg. v. Norbert Oellers, Stuttgart 1. Aufl. 1996, S. 161.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Naturdarstellungen: "Poetisches Gemälde" und "Ideallandschaft"
- Menschheitsgeschichte und Natur
- "Das goldene Zeitalter"
- Höhepunkt der klassischen Antike
- Die Aufklärung als Tiefpunkt
- Die Zukunft als Hoffnungsträger
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Schillers Gedicht "Der Spaziergang" und untersucht dessen ästhetische und philosophische Dimensionen. Das Gedicht wird als Reflexion über Natur und Menschheitsgeschichte interpretiert, wobei die Wechselwirkung zwischen beiden im Mittelpunkt steht. Die Entwicklung der Beziehung zwischen Mensch und Natur wird im historischen Kontext beleuchtet.
- Die Darstellung der Natur als "poetisches Gemälde" und "ideale Landschaft"
- Die Beziehung zwischen Menschheitsgeschichte und Natur
- Die Entwicklung der menschlichen Kultur im Kontext der Natur
- Die Rolle der Imagination und des ästhetischen Erlebens
- Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Entstehungskontext von Schillers "Der Spaziergang", der aus einer früheren "Elegie" hervorgegangen ist und Schillers Hinwendung zu einer philosophisch durchdrungenen Poesie kennzeichnet. Sie hebt den elegischen Versbau hervor und verweist auf inhaltliche Änderungen zwischen der ersten und zweiten Auflage. Der Fokus liegt auf der Reflexion über Natur und Geschichte, die im Gedicht vollzogen wird, und Schillers selbst formulierter Anspruch an die poetische Kraft des Gedichts.
2. Naturdarstellungen: "Poetisches Gemälde" und "Ideallandschaft": Dieses Kapitel analysiert Schillers Landschaftsbeschreibung als "poetisches Gemälde" einer "idealen Landschaft". Es untersucht, wie Schiller die Einbildungskraft des Lesers anspricht, indem er konventionelle Naturmotive – wie braunes Gebirge, grüner Wald, blühende Au – verwendet und auf überraschende Elemente verzichtet. Die Beschreibung eines "Locus amoenus" und später eines "Locus sublimis" wird im Detail erläutert, wobei der Kontrast zwischen dem Schönen und dem Erhabenen herausgearbeitet wird und Bezug auf zeitgenössische Vorstellungen der idealen Landschaft genommen wird. Der Einfluss von Claude Lorrain auf die Gestaltung der Landschaft im Gedicht wird ebenfalls diskutiert.
3. Menschheitsgeschichte und Natur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Menschheitsgeschichte im Gedicht, die als imaginäre Reise durch verschiedene Epochen konzipiert ist. Es beginnt mit dem "Goldenen Zeitalter", wo Mensch und Natur in Harmonie lebten. Die Arbeit analysiert, wie Schiller die Entwicklung der menschlichen Beziehung zur Natur darstellt und auf den Einfluss der Kultur auf die Natur eingeht. Die Arbeit thematisiert dabei die Bedeutung der Natur für das menschliche Dasein und die Folgen menschlichen Handelns. Der Abschnitt hebt die selektive Darstellung der Menschheitsgeschichte in Schillers Gedicht hervor und analysiert den Übergang von der harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Natur zu einem komplexeren Verhältnis, welches durch menschliche Eingriffe und Entwicklungen geprägt ist.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Der Spaziergang, Naturlyrik, Ideallandschaft, Menschheitsgeschichte, Locus amoenus, Locus sublimis, Poetisches Gemälde, Ästhetik, Philosophie, Imagination.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Der Spaziergang"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Friedrich Schillers Gedicht "Der Spaziergang" auseinandersetzt. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in Schillers "Der Spaziergang" behandelt?
Das Gedicht behandelt die Beziehung zwischen Mensch und Natur im Kontext der Menschheitsgeschichte. Es analysiert die Darstellung der Natur als "poetisches Gemälde" und "ideale Landschaft" und untersucht die Entwicklung dieser Beziehung von einer harmonischen Koexistenz im "Goldenen Zeitalter" hin zu einem komplexeren Verhältnis, das durch menschliche Eingriffe geprägt ist. Weitere Themen sind die Rolle der Imagination und des ästhetischen Erlebens sowie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die den Entstehungskontext des Gedichts beleuchtet; ein Kapitel zur Analyse der Naturdarstellungen als "poetisches Gemälde" und "ideale Landschaft"; ein Kapitel zur Darstellung der Menschheitsgeschichte im Gedicht und deren Wechselwirkung mit der Natur; und möglicherweise weitere Kapitel, die in der Zusammenfassung nicht explizit genannt werden.
Welche Methoden werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse verwendet literaturwissenschaftliche Methoden, um Schillers Gedicht zu interpretieren. Es werden ästhetische und philosophische Dimensionen des Gedichts untersucht. Die Arbeit berücksichtigt den historischen Kontext und bezieht sich auf zeitgenössische Vorstellungen der idealen Landschaft und den Einfluss von Künstlern wie Claude Lorrain.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Gedichts wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Friedrich Schiller, Der Spaziergang, Naturlyrik, Ideallandschaft, Menschheitsgeschichte, Locus amoenus, Locus sublimis, Poetisches Gemälde, Ästhetik, Philosophie, Imagination.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden im Dokument angeboten?
Das Dokument bietet Zusammenfassungen für die Einleitung, die Analyse der Naturdarstellungen und die Analyse der Menschheitsgeschichte im Gedicht. Die Einleitung beschreibt den Entstehungskontext und die zentralen Anliegen des Gedichts. Das Kapitel zu den Naturdarstellungen analysiert die Landschaftsbeschreibung als "poetisches Gemälde" und den Einsatz von konventionellen und überraschenden Elementen. Das Kapitel zur Menschheitsgeschichte untersucht die imaginäre Reise durch verschiedene Epochen und die Entwicklung der Beziehung zwischen Mensch und Natur.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Schillers Gedicht "Der Spaziergang" und untersucht dessen ästhetische und philosophische Dimensionen. Sie interpretiert das Gedicht als Reflexion über Natur und Menschheitsgeschichte und beleuchtet die Wechselwirkung zwischen beiden im historischen Kontext.
- Quote paper
- Imke Barfknecht (Author), 2001, Friedrich Schiller - Der Spaziergang - Gedichtsinterpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1062