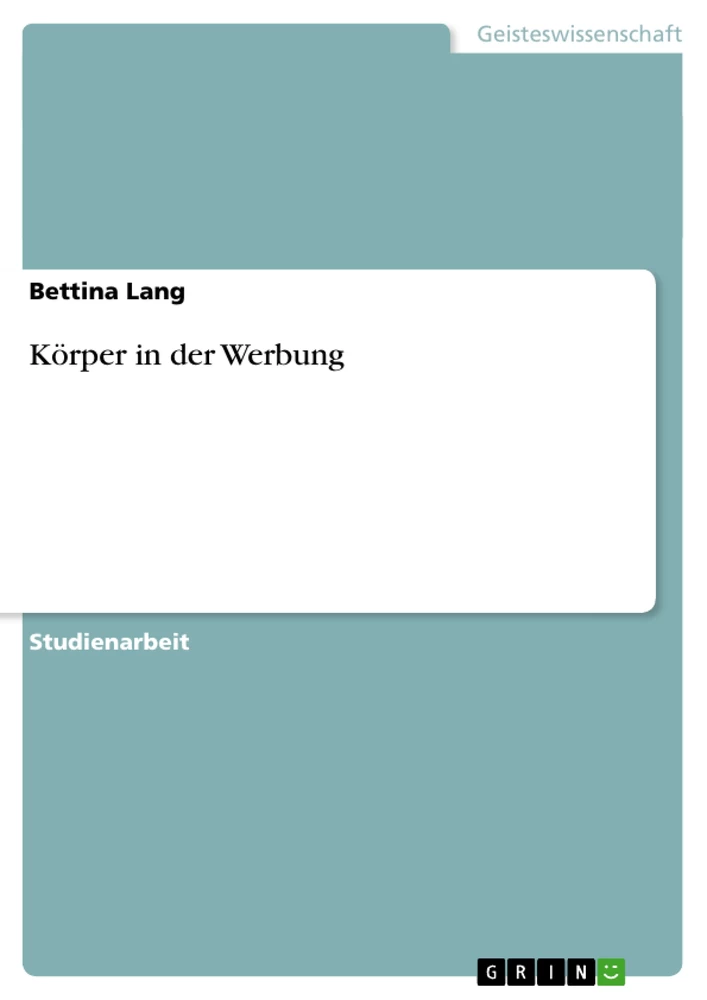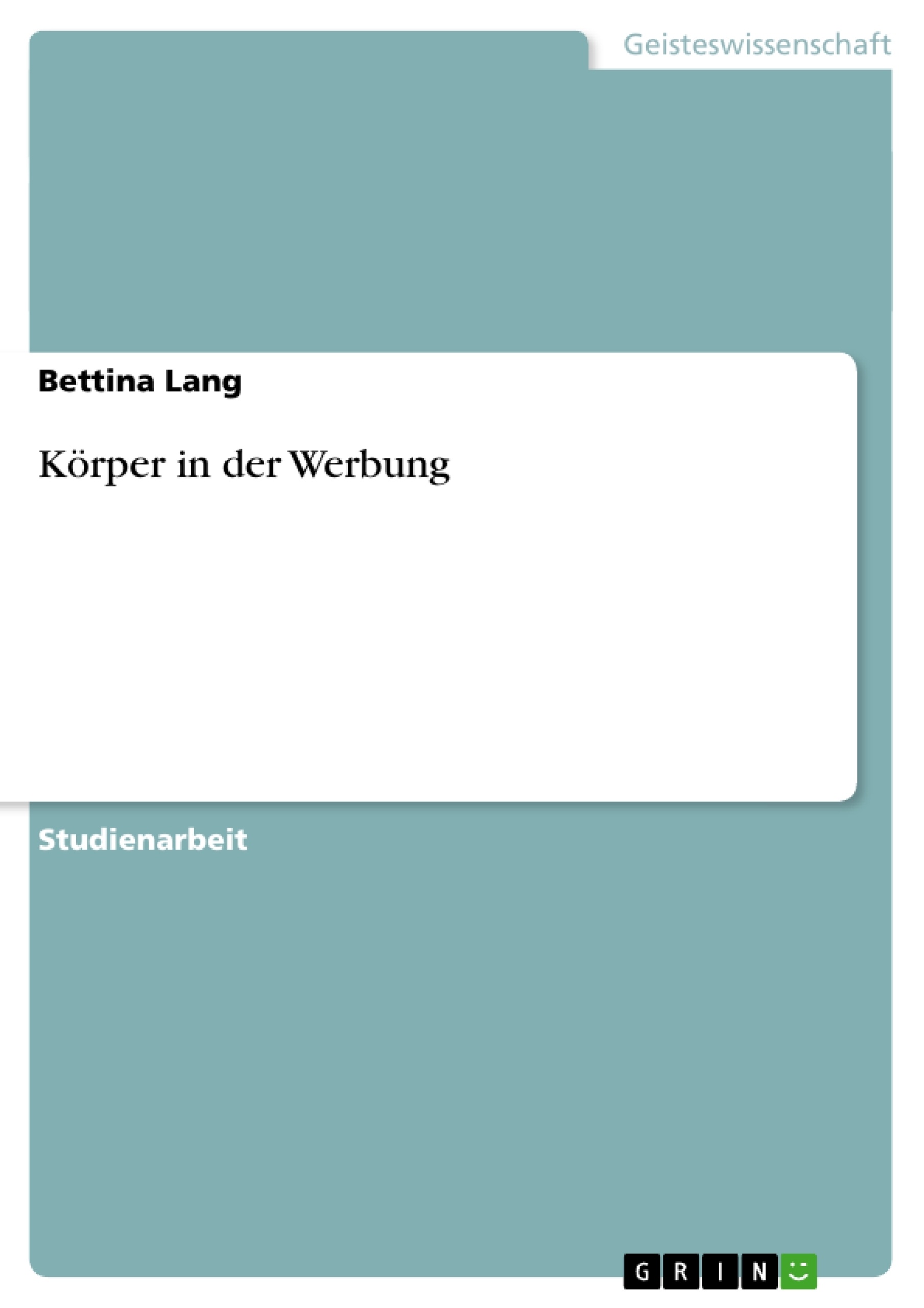Gliederung
1 Der Reiz der Werbung
2 Das Spiel mit den Gefühlen
3 Der Körper als Blickfang
3.1 Der weibliche Körper
3.2 Der männliche Körper
4 Vergleich der Anzeigen in GQ und MC
4.1 Zielgruppe
4.2 Vermittlung von Gefühlen
4.3 Der perfekte Körper und das Alter
4.4 Der künstliche Körper
4.5 Spiel mit der Nacktheit
4.6 Rollenverhalten der Geschlechter
5 Was bleibt vom Körper? - Ein Ausblick
6 Bibliographie
1 Der Reiz der Werbung
„Unter Werbung versteht man die beabsichtigte Beeinflussung von marktrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen ohne formellen Zwang unter Einsatz von Werbemitteln und bezahlten Medien.“1 Werbung soll also das Kaufverhalten der Menschen beeinflussen, ohne physischen oder psychischen Zwang auf sie auszuüben. Sehr oft geht es in erster Linie um die Bekanntmachung eines Produkts und seines Namens. Fraglich bleibt jedoch immer, wieviel Macht die Werbung tatsächlich auf das Kaufverhalten des Konsumenten ausübt, der immer noch frei in seiner Entscheidung ist. Wichtig erscheint mir insbesondere, dass der mögliche Konsument eines Produkts sich in der Werbung wieder erkennt. Goffman macht auf die Vergleichbarkeit von privaten mit öffentlichen Bildern bzw. Fotos aufmerksam, die oft beide kleine Geschichten erzählen oder Rituale andeuten, die dem Betrachter wohl bekannt sind.2 Rituale wie Begrüßungen, Verabschiedungen, Formeln, Gesten, Zeremonien regeln das Zusammenleben und die Kommunikation der Menschen. Die Werbung selbst ist ein Medium der Massenkommunikation, das die Botschaft z.B. einer Firma an möglichst viele Menschen weitertragen soll. Das Problem dabei ist, dass sich jeder persönlich angesprochen fühlen soll und eben nicht als Teil der undefinierbaren Masse. Zu diesem Zweck benutzt die Werbung Formen, die jedem einzelnen aus täglichen Ritualen oder Gemeinplätzen bekannt sind. Teilweise werden die Botschaften noch verschlüsselt und eine Anzeige kann zu einem „Geheimcode“ werden, den vermeintlich nur wenige entschlüsseln können. Dann fühlt sich der Betrachter, der den Schlüssel gefunden hat oder die Geschichte richtig deutet, als „Auserwählter“. Der Rückzug ins Private ist ein weiteres Mittel, um dem Betrachter das Gefühl zu geben, persönlich angesprochen zu werden. Deshalb ist der Körper, besonders natürlich der nackte Körper in privaten Situationen, ein beliebtes Motiv der Werbung. Auf der anderen Seite wird durch die öffentliche Abbildung das Private öffentlich und zum Allgemeingut gemacht. Da immer nur einzelne, relativ allgemeingültige Rituale abgebildet werden können, also solche, die nicht für alle Menschen die Norm sind, werden damit gleichzeitig Normen geschaffen, bzw. Wünsche nach einer Gemeinsamkeit, welche die Abfolge von den Ritualen aller umfassen soll. Abgesehen vom Aspekt der Privatheit ist der Körper in der Geschichte der Abbildungen, also der Gemälde und Fotos, seither ein beliebtes Motiv.
John Berger sieht die moderne Fotografie, und damit auch die Bilderwelt der Werbung in der Tradition der Malerei.3 Die Posen, welche die Körper heute einnehmen, gab es bereits sehr früh in der Malerei, private Liebesversprechungen also auch. Aber auch diese wurden durch die Plazierung eines Gemäldes im mehr oder weniger öffentlichen Raum ihrer Privatheit beraubt und hatten eine Funktion: Die abgebildeten nackten Menschen sind meist Frauen. Ihr Äußeres es ist, was die Frauen konstituierte. Deshalb konnten sie zudem als Objekte mit dem Objektcharakter des Bildes verschmelzen. Somit war ein Gemälde immer auch Ausdruck der Macht des Besitzers, da er mit dem Gegenstand auch den „Inhalt“ besaß. Umgekehrt wurde dadurch der Besitzer um so attraktiver. In der Werbung funktioniert das ähnlich:
Die Werbung benutzt die Sexualität, um jede beliebige Ware oder Dienstleistung zu verkaufen. Aber diese Sexualität ist in sich selbst unfrei; sie symbolisiert etwas angeblich Umfassenderes als sich selbst: das gute Leben, in dem man alles kaufen kann, was man haben möchte. Die Fähigkeit, alles kaufen zu können, gleicht dem Zustand, sexuell begehrenswert zu sein. [...] Gewöhnlich ist die Botschaft indirekt: Wenn du das Produkt kaufen kannst, wirst du begehrenswert. Kannst du es nicht kaufen, bleibst du weniger begehrenswert.4
Wie Berger und auch Goffman zeigten, war, etwas vereinfacht formuliert, vor allem der Mann das Subjekt, das kaufte und damit die Frau das Objekt, das besessen wurde. Dadurch wurde die vorrangige Position des Mannes in der Gesellschaft abgebildet und verstärkt. Mit seiner Kaufkraft konnte der Mann sich als Subjekt und die Frau als Objekt bestimmen und somit über die Sexualität der Frau verfügen. Die Machtposition des Mannes wurde damit unterstützt und gefestigt. Noch heute ist auffällig, dass Männer in der Werbung viel weniger Haut zeigen als Frauen und damit weniger Angriffsfläche bieten. Der Schutz durch die Kleidung, bzw. die Uniformierung - z.B. im klassischen Anzug mit Hemd und Krawatte - verleiht ihnen eine sicherere Ausstrahlung von Macht. Diese Tendenz ist noch spürbar, obwohl sich in der Werbung einiges verändert hat.
Deshalb ist einer der wichtigsten Aspekte der Werbung das Verhältnis zwischen Sexualität und Macht. Foucault zeigt in Der Wille zum Wissen, dem ersten Band von Sexualität und Wahrheit, wie die Regulierung der Sexualität vor allem dadurch stattfindet, dass die Sexualität an die Öffentlichkeit gezerrt wird und den Bereich des Privaten verläßt.5 Durch die Festlegung davon, was „normal“ ist, wird der Mensch wiederum im Privaten kontrolliert, bzw. es wird ihm eine Selbstkontrolle auferlegt. Hinzu kommt eine besondere Regulierung der Sexualität der Frau, welche der Kontrolle durch die Männer unterlag und damit wiederum deren Macht festigte. Betrachtet man die heutigen Anzeigen, hat man das Gefühl, auch der Körper und die Sexualität des Mannes würde inzwischen einer größeren Kontrolle unterliegen.
Ich möchte hier die Frage stellen, wie sich die dargestellten Körper in der Werbung in Bezug auf die Geschlechter geändert haben. Werden die Männer auch zu Objekten, unterliegen sie der gleichen Kontrolle wie die Frauen? Vertauschen sich sogar die Rollen? Wie werden die Gefühle der Betrachter in der Werbung angesprochen und sich zu Nutze gemacht? Interessant erscheint mir dabei die Ausrichtung auf die jeweilige Zielgruppe Mann oder Frau und die Frage, inwieweit der Körper eine andere Rolle für die jeweilige Zielgruppe spielt. Deshalb habe ich für die Untersuchung ein Männermagazin, GQ (Gentleman ’ s Quartely), und ein Frauenmagazin, Marie Claire 6, ausgesucht, die beide an eine jeweils klar definierte Zielgruppe gerichtet sind: Beides sind Lifestyle-Magazine für berufstätige Menschen ab Zwanzig, beide vermitteln die „herkömmlichen“ Rollen der Geschlechter: GQ steht für den starken, sportlichen Mann, der auf seine Karriere bedacht ist, MC für die schöne, jugendliche Frau, die auf ein Berufsleben nicht verzichten will. Beide Hefte haben weite Modestrecken im Programm, Geplauder über Stars aus der Musik- und Filmszene, ausführliche Beschäftigung mit dem Thema „Sex“ (bei GQ geht es vordergründig um den direkten Akt und wie man ihn verbessern kann, bei MC um das Verhältnis Liebe und Sex). MC veröffentlicht meistens noch eine Reportage über ein „Problem“ in der Welt, GQ eine ausführliche Vorstellung eines Models, welche an die Fotostrecken aus dem Playboy erinnert. Beide Magazine sind eher oberflächlich und unreflektiert, was politische, soziale und ähnliche Fragen betrifft.7 Ich habe jeweils nur die Anzeigen betrachtet, die von anderen Firmen geschaltet sind, nicht die Werbung für das eigene Heft (z.B. Abonnentenwerbung oder für den Auftritt im Internet), auch habe ich die Modestrecken außer acht gelassen, obwohl sie teilweise der Werbung sehr ähneln, da sie sowohl Produkte bestimmter Firmen vorstellen als auch der Ästhetik der Werbung für Modefirmen nahekommen. Ich beschränke mich auf die explizit als Werbung erkennbaren Anzeigen, um das Gebiet einzugrenzen.
2 Das Spiel mit den Gefühlen
Bevor ich den Körper in der Werbung untersuche, möchte ich jedoch die Frage stellen, weshalb er ein so beliebtes Werkzeug der Anzeigen ist. Die meisten Menschen beschäftigen sich sehr ausführlich mit dem eigenen Körper: Die verschiedensten Wünsche müssen befriedigt werden, sei es nach Schlaf, nach Ernährung, nach Sex, nach Luft oder nach Bewegung. Jeder dieser Wünsche wird durch Gefühle vermittelt, so dass die Beziehung zum Körper fast ausschließlich durch Emotionen und kaum durch rationale Überlegungen gesteuert ist. Die Werbung versucht, sich entweder die negativen Emotionen wie Angst zu Nutze zu machen, um eine abschreckende Wirkung zu erzeugen (z.B. Aufklärungskampagnen zu AIDS, die Werbung von Amnesty International). Oder sie bedienen sich positiver Emotionen, um Vertrauen für das Produkt zu wecken und die positive Einstellung mit dem Gefühl für das Produkt zu verbinden. Besonders wirkungsvoll werden positive Emotionen durch starke Farben, Familienszenen, Kinder bzw. Kindchenschema und erotische Darstellungen erzeugt. „Diese Reize aktivieren gleichsam automatisch jeden Menschen, da sie grundlegende Triebe und Motive aktualisieren.“8 Wie wichtig sind die erotischen Darstellungen in den Anzeigen der GQ und der MC und haben sich spezielle Zuordnungen der Geschlechterrollen geändert?9
3 Der Körper als Blickfang
In weit über 50% der Anzeigen dient der menschliche Körper als Blickfang für den Betrachter. In den verschiedensten Konstellationen posieren Frauen und Männer für ein Produkt, bei dem oft der Bezug zum Körper gar nicht erkennbar ist. Sowohl in der MC als auch in der GQ wirbt ein Großteil der Anzeigen für Modefirmen und Parfums. Hier ist der Körper Träger und direkter Bezugspunkt des Produkts. Auch bei den in der MC häufiger vorkommenden Anzeigen für Pflegeprodukte und Kosmetikartikel ist der Bezug offensichtlich. Dennoch lassen sich erotisierende Darstellungen von solchen unterscheiden, welche die Figur auf eine „natürliche“ Art in ihrer Nacktheit darstellen. Davon zu unterscheiden sind wiederum Akte, welche die Nacktheit thematisieren und den Körper als Kunstobjekt betrachten. Doch auch der völlig verhüllte Körper macht einen großen Teil der Werbung aus. Ich möchte diese vier Kategorien kurz allgemein darstellen, dann typische Darstellungen des weiblichen und des männlichen Körpers unterscheiden, um dann den Vergleich zwischen den Anzeigen der GQ und der MC ziehen zu können.
Erotisch sind vor allem solche Darstellungen, in welchen dem Betrachter ein „Angebot“ gemacht wird: Das betreffende Model flirtet mit dem/der BetrachterIn, deutet an, dass es sich auszieht, schließt die Augen und öffnet leicht die Lippen im Ausdruck des Genusses, zeigt sich in offenen ungeschützten Posen (z.B. das typische Zurücklegen des Kopfes, was einen freien Zugang auf die Halsschlagader ermöglichen würde) etc. Ganz deutlich wird es bei Bildern, in denen sich ein Paar streichelt, gegenseitig auszieht oder miteinander flirtet. Die Models brauchen gar nicht nackt zu sein, oft inszeniert gerade die Kleidung die Nacktheit durch ein gekonntes Spiel von Verdecken und Entblößen, oder aber es ist allein der Gesichtsausdruck (von Genuss bis Ekstase) für die erotische Wirkung verantwortlich.
In „natürlicher“ Nacktheit werden Models meistens für Pflegeprodukte abgebildet. Sie strahlen eine große Selbstzufriedenheit aus, die sich auf sich selbst und nicht auf den/die BetrachterIn bezieht: Das Setting ist meist neutral, vermittelt aber dennoch einen Hauch von Privatheit (z.B. Decken, auf denen das Model liegt), die Haltung ist entspannt, der Blick freundlich, das Bild zoomt nicht extra auf einzelne Körperteile. Der Akt ist dagegen inszenierte Nacktheit mit einem gewissen künstlerischen Anspruch. Meist nehmen die Models dann eine unbequem wirkende Haltung ein und halten eine hohe Körperspannung. Die Beleuchtung wird professionell inszeniert. Der Ausdruck der Gesichter, falls der Kopf überhaupt im Blickfeld ist, ist dann meist unbewegt. Berger unterscheidet zwischen Akt und Nacktsein folgendermaßen:
Nacktsein bedeutet, man selbst zu sein. Als Akt wird man von anderen nackt gesehen und doch nicht als man selbst erkannt. Ein nackter Körper muß als Objekt gesehen werden, um zu einem Akt zu werden. [...] Nacktheit enthüllt sich selbst; ein Akt wird zur Schau gestellt. Nacktsein bedeutet, man selbst zu sein. Ausgestelltsein bedeutet, die Oberfläche der eigenen Haut, die Haare des eigenen Körpers zu einer Verkleidung werden zu lassen, die - in dieser Situation - nicht mehr abgelegt werden kann. Der Akt ist dazu verdammt, niemals nackt zu sein; der Akt ist eine Form der Bekleidung.10
Natürlich sind alle Models der Werbung in gewisser Weise Objekte, da sie ihren Körper gegen Bezahlung ablichten lassen und sich zur Schau stellen. Dennoch kann auf der Ebene der „Handlung“ innerhalb der Werbung durchaus zwischen Subjekt und Objekt unterschieden werden. Somit ist es durchaus begründet auch in der Werbung von „Nacktheit“ zu sprechen.
Obwohl der nackte Körper wahrscheinlich den wichtigsten Blickfang der Werbung darstellt, arbeiten viele Anzeigen mit bekleideten Menschen in einer natürlichen Umgebung oder in einer Geschichte, die eine bestimmte Gefühlswelt vermittelt. Oft werden zum Beispiel kleine Eifersuchtsszenen dargestellt.
3.1 Der weibliche Körper
Bei der Darstellung des weiblichen Körpers lassen sich verschiedene Schemata erkennen, die sich wiederholen. Besonders auffällig ist, dass häufig nur Teile des Körpers abgebildet werden. Besondere Beachtung finden dabei Füße, Beine, Hände oder Haare der Frau. Abgeschnitten vom Rest des Körpers stehen sie als pars pro toto für den ganzen Menschen. Die Frau wird reduziert auf einen Teil von ihr, der sowohl ihr Geschlecht bezeichnet, als auch als entscheidend für das Schönheitsideal gilt.
Bei Abbildungen, auf denen die ganze Frau zu sehen ist, sind häufig genau diese Körperteile im Fokus oder so inszeniert, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich und damit auf die ganze Anzeige lenken. Die Beine der abgebildeten Frauen sind zum Beispiel oft nackt, besonders schlank und extrem lang im Verhältnis zum Rest des Körpers. Arme und Haare werden seltener getrennt vom Körper abgebildet, finden aber in vielen Bildkompositionen ähnliche Beachtung.
In Anzeigen, auf denen die ganze Frau oder zumindest Oberkörper und Kopf abgebildet sind, kommen Bauch und Busen meist die größte Bedeutung zu. Sei es durch die Anordnung im Bild oder durch das Zeigen der nackten Haut wird der Blick auf diese Teile des weiblichen Körpers gelenkt. Insgesamt ist es der Werbung überhaupt ein Anliegen, die Nacktheit des weiblichen Körpers zu inszenieren. „Normal“ angezogene Frauen, deren erotische Reize nicht extra betont werden, sind eher in der Minderzahl. Die Gefühlsregungen der abgebildeten Frauen reichen von unbewegt, melancholisch über Lust und hemmungslosem Lachen bis hin zu Erstaunen und Schmerz.
Bei Abbildungen des weiblichen Körpers in der Werbung ist zu beobachten, dass der Körper an sich im Mittelpunkt steht. In einer Traumwelt, in der es nur Strände, Partys, Einkaufsbummel, Flirts an der Bar etc. gibt, hat der weibliche Körper nur die Funktion, Körper zu sein. Oftmals ist der Körper der Frau nicht einmal mehr in einen Kontext gestellt, sondern „schwebt“ vor neutralem Hintergrund auf der Werbefläche. Solche Anzeigen werben oft für Produkte, die mit Körperpflege oder der Ausstattung des Körpers zu tun haben. Allerdings gibt es auf der anderen Seite Anzeigen, die für ähnliche Produkte werben, jedoch die Frau nicht auf ihren Körper reduzieren, sondern sie in einem Umfeld zeigen, das nicht losgelöst ist von der „realen“ Welt. Solche Werbungen sind selten, zeigen aber, dass es möglich ist, den weiblichen Körper in Szene zu setzen, ohne das Gefühl zu vermitteln, der Körper selbst sei das Produkt, das es zu verkaufen gilt. Denn in vielen Anzeigen bietet sich der weibliche Körper als Objekt an: Durch die Fokussierung auf bestimmte Körperteile, durch den Ausdruck von Genuss oder Lust, oder den scheinbar unbeteiligten Blick, der auf der einen Seite als Schranke dient, auf der anderen Seite aber eine gewisse Mitwisserschaft voraussetzt.11 Ein Ausbrechen aus den Konventionen ist sehr selten zu beobachten. Zum Beispiel gibt es kaum Darstellungen androgyn oder lesbisch wirkender Frauen.
3.2 Der männliche Körper
Im Allgemeinen zeigt der Mann in der Werbung weniger Haut als die Frau. Manchmal ist unter dem aufgeknöpften Hemd etwas von der Brust zu sehen oder der Mann zeigt sich beim Baden oder kurz vor dem Sex mit einer Frau. Losgelöst von einem Thema oder einer „erklärenden“ Umgebung wird der männliche Körper aber nur in Bekleidung abgebildet. Fokussierungen auf bestimmte Körperteile des Mannes sind nicht erkennbar. Sehr typisch sind dagegen Abbildungen des Kopfes (mit oder ohne Oberkörper) eines Mannes, der in die Ferne schaut, entweder melancholisch anmutend oder unbewegt, selten lächelnd. Die Gefühlspalette des Mannes in der Werbung ist längst nicht so weitreichend wie die der Frau.12
Auch der männliche Körper wird in der Werbung vorwiegend in einer Umgebung gezeigt, die eher auf Freizeit schließen läßt. Dadurch, dass aber in den wenigsten Fällen der Mann sich als Objekt anbietet, wirken diese Szenen eher wie Pausen von einer Betätigung. Vielleicht liegt diese Interpretation aber auch an der Konvention der Betrachtung: Wird eine Frau an einer Bar dargestellt, wird vermutet, dass sie nichts anderes zu tun hat, als an der Bar zu stehen. Besonders, wenn sie in Minirock und Pumps auftritt. Steht ein Mann im Anzug an der Bar, wird vermutet, dass er gerade einen Arbeitstag hinter sich hat, oder seinen Pausenkaffee zu sich nimmt. In gewisser Weise spielt die Werbung auch mit dieser Konvention der Interpretation bzw. übernimmt das Schema.
Andererseits gibt es immer mehr Anzeigen, die aus dieser herkömmlichen Sichtweise ausbrechen. Der Mann wird in solchen Fällen genauso erotisch und in ähnlichen Posen wie die Frau dargestellt. Die Lippen sind leicht geöffnet, die Augen halb geschlossen oder direkt auf den Betrachter gerichtet, der Mann liegt auf einem Bett oder befindet sich in einem ähnlich privaten Bereich. Hinzu kommen bei der erotischen Darstellung von männlichen Körpern anzügliche Gesten13, die sich auf das eigene Geschlecht beziehen wie sie bei Frauen eher nicht vorkommen14. Solche eher homosexuell anmutenden sowie androgyne Männer bleiben in den Anzeigen jedoch die Ausnahme. Ein wichtiger Bereich für den männlichen Körper in der Werbung ist der Sport: Häufig wird der Mann bei einer sportlichen Betätigung gezeigt. Sei es Skifahren, Klettern oder Rollerskaten: Wichtig ist, dass der Mann dabei seine Muskeln spielen läßt und zeigen kann, dass er fit ist. Den Unterschied zwischen der Rangordnung des Sports bei Männern und Frauen in der Werbung lässt sich gut an einer Anzeige der Zigarettenmarke R1 dokumentieren: Zwei Männer sitzen lässig am Kai und rauchen eine Zigarette. An ihren Füßen tragen sie Inlineskates, einer der beiden außerdem Knieschoner. Ansonsten sind sie sommerlich normal angezogen. Im Hintergrund kommen zwei Frauen auf Inlineskates angefahren. Sie tragen beide Knie-, Ellbogen- und Handschoner sowie ein spezielles Sportdress: Radlerhose und Bustier in jeweils einer Farbe. Die beiden Männer sind also schneller gefahren als die Frauen, bei ihnen geht es vor allem um Kraft, Technik und den Sport an sich. (Dass die Zigaretten der Fitness eher entgegenwirken sei dahingestellt.) Die Frauen sind in erster Linie schön, unterhalten sich wahrscheinlich während des Fahrens und stellen den sportlichen Aspekt hinten an. Zudem werden sie als sportlich weniger kompetent dargestellt: Sie müssen sich vermehrt mit Schonern vor dem Sturz schützen.15
Im Folgenden sollen nun die beiden Magazine MC und GQ miteinander verglichen werden hinsichtlich der von der Werbung angesprochenen Zielgruppe, der Gefühle, die vermittelt werden und der Verteilung von Geschlechterrollen.
4 Vergleich der Anzeigen in GQ und MC
4.1 Zielgruppe
Zur Untersuchung, welche Rolle der Körper in den Anzeigen in GQ und MC spielt, gehört die Frage, welchen Anteil an der Werbung insgesamt Anzeigen haben, in denen Körper abgebildet werden. Schon hier treten Unterschiede zwischen den beiden Magazinen auf: In der MC sind in etwa 26% der Anzeigen keine Körper oder Körperteile abgebildet, bei GQ fast in der Hälfte aller untersuchten Anzeigen (47,22%). Bei den Anzeigen, die ohne den Einsatz von Körpern funktionieren, handelt es sich vorwiegend um Werbung für Uhren und Autos. Auch Schuhe, Alkoholika, Schmuck und Zigaretten werden häufig nur mit der Abbildung des Produkts beworben. In der GQ gibt es mehr Anzeigen für Uhren und Autos als in der MC, in der dahingegen die Anzeigen für Pflegeprodukte den größten Raum einnehmen. Der Einsatz des Körpers in der Werbung ist also gekoppelt an die Produkte, die beworben werden sowie an die Zielgruppe der Zeitung. Der große Unterschied zwischen dem Männer- und dem Frauenmagazin kann eventuell damit erklärt werden, dass sich die Werber eine größere Reaktion des weiblichen Publikums auf Anzeigen erhoffen, die mit Emotionen spielen. Das würde den vermehrten Einsatz von Körperlichkeit in den Anzeigen der MC rechtfertigen.
Eine weitere Bestätigung der Zielgruppe des Magazins in den Anzeigen findet sich in der Abbildung von jeweils nur weiblichen oder nur männlichen Körpern: In der MC befinden sich auf etwa 52% der Anzeigen nur weibliche Körper(-teile) und nur gut jede 100ste Anzeige bildet nur männliche Körper(-teile) ab. In der GQ hingegen sind in knapp 5% der Anzeigen die abgebildeten Körper(-teile) nur weiblich, 27% Prozent dafür nur männlich. Der große Unterschied zwischen dem Anteil „nur weiblich“ in der MC und „nur männlich“ in der GQ liegt an dem höheren Prozentsatz der Anzeigen ohne Körper in der GQ. Die Differenz zwischen den Kategorien „nur weiblich“ in der MC und „nur männlich“ in der GQ ist in etwa die gleiche wie zwischen „Anzeigen ohne Körper(-teile)“ in den beiden Magazinen. Sowohl in der GQ als auch in der MC sind jedoch auf gut jeder elften Anzeige Körper(-teile) beiderlei Geschlechts zu sehen. Die Abbildung von Paaren und gemischtgeschlechtlichen Gruppierungen haben also den gleichen Stellenwert für die Zielgruppen weibliche und männliche Leser.
Betrachtet man die Geschlechter getrennt, lassen sich zwei Kategorien erkennen, die ich als „typisch weiblich“ und „typisch männlich“ in der Werbung bezeichnet habe16. Die typisch weiblichen sind Abbildungen, auf denen nur Frauen - meist auch nur der Kopf - zu sehen sind, die losgelöst von ihrer Umwelt sich der Betrachtung hingeben, anscheinend nichts zu tun haben, viel lachen und sich den Normen entsprechend verhalten. Diese Darstellung findet sich vor allem in der MC und macht dort den größten Teil der Anzeigen aus, in denen Körper(-teile) abgebildet werden. Bei der typisch männlichen Darstellungsweise verhält sich der männliche Körper entsprechend den ihm zugewiesenen Rollenmustern, meist blickt er leicht verträumt, melancholisch oder unnahbar in die Ferne. In der GQ machen die „typisch männlichen“ Anzeigen ebenso den größten Teil der Werbung mit Körpern aus.
Es erscheint mir besonders interessant, dass die Frauen, die in den Anzeigen des Männermagazins abgebildet sind, eher dem herkömmlichen Muster widersprechen, als die des Frauenmagazins. Man sollte vermuten, dass in der GQ, in der es teilweise bis zu zwei Fotostrecken mit Models gibt, die sich auf erotische Weise präsentieren, auch die Anzeigen erotisch gestaltet sind. In allen untersuchten Anzeigen der GQ fand ich allerdings nur 9 Anzeigen, in denen eine erotisch wirkende Frau ohne Partner abgebildet war. Natürlich gibt es viele Anzeigen, in denen ein Paar, das sich küsst oder gegenseitig auszieht, abgebildet ist. Aber der weibliche Körper ohne Bezug zum männlichen wird selten erotisch dargestellt. In der MC hingegen fand ich 60 Anzeigen, in der sich eine Frau erotisch gab (meist Anzeigen für Mode oder Kosmetik). Die Differenz zwischen den beiden Magazinen hängt auch damit zusammen, dass in der MC insgesamt mehr Frauen allein abgebildet sind als in der GQ und dass in der GQ keine Werbung für Kosmetik und kaum für weibliche Mode gemacht wird. Dennoch stellt sich die Frage, warum gerade in einem Magazin für vorwiegend weibliche Leser der weibliche Körper als erotisches Objekt dargestellt wird. Kaum eine dieser Anzeigen ist so arrangiert, dass sie lesbisches Publikum ansprechen würde, sie laufen also auf die Identifikation der Betrachterin mit der erotischen Frau hinaus. Somit konsolidieren diese Anzeigen das Bild von der Frau, die vor allem erotisch anziehend sein sollte, um ihre Ziele verfolgen zu können. Sie arbeitet mit den herkömmlichen Schemata von Weiblichkeit.
In den Anzeigen des Männermagazins wiederum wird der Frau keine „autarke“ Erotik zugestanden. Sie bezieht sich meistens auf einen Mann im Bild, der sie in den Armen hält, sie auszieht etc. Eine erotische Frau, die für ein Auto wirbt, wie es noch vor ein paar Jahren oft zu sehen war, gibt es kaum mehr. Die Anzeigen im Männermagazin (wie auch im Frauenmagazin) haben diese zusammenhangslose Zuordnung von Erotik und Autos und anderen neutralen Gegenständen weitgehend aufgehoben.
4.2 Vermittlung von Gefühlen
Wie eingangs beschrieben, ist die Abbildung des Körpers in seiner Privatheit ein beliebtes Mittel, um möglichst positive Gefühle hervorzurufen. Tatsächlich habe ich auch nur zwei Anzeigen gefunden, die eher abschreckend wirken könnten: In der GQ die Anzeige „Expedia“, die mit dem Slogan „irre günstig“ wirbt, und ein entsprechend wahnsinnig wirkendes männliches Gesicht, das mit schwarzem Sand beschmiert ist, zeigt.17 Die andere Anzeige wirkt auf junge Menschen wohl eher interessant, auf ältere könnte auch sie abschreckend wirken: Philips wirbt ebenfalls in der GQ mit einem männlichen Gesicht, das über und über tätowiert ist.18 Bezeichnend ist, dass es kein weibliches Gesicht in den untersuchten Anzeigen gibt, das auf ähnliche Weise „entstellt“ ist. Auf der anderen Seite sind es besonders die weiblichen Gesichter, welche extreme Gefühle zeigen: Sie lachen, teilweise mit weit geöffnetem Mund, zwinkern und schneiden Grimassen aller Art. Dadurch wirken die abgebildeten Frauen sehr viel mehr von ihren Emotionen abhängig als die Männer. Oft fällt es schwer, ein solches Gesicht ernst zu nehmen: Das Lächeln, das viele der Models aufgesetzt haben, wirkt „lieb“, um Verständnis heischend und nicht wie das eines ernstzunehmenden Kommunikationspartners. Es ist auffällig, dass dieser Typ Werbung fast nur in der MC zu finden ist. Die meisten Anzeigen der GQ zeigen ein anderes Bild der Frau.
Ein Großteil der Anzeigen beider Magazine zeigt Personen mit relativ unbewegtem Gesichtsausdruck. Die Models beiderlei Geschlechts blicken in die Ferne oder auch direkt in die Kamera, wecken aber den Anschein, als könnten sie sich für nichts interessieren:
Auch finden wir manchmal einen Gesichtsausdruck, der Abwehr gegen äußere Einmischung bekundet - ein subtiles Mittel, um dem Betrachter das Gefühl zu geben, er sei tatsächlich an der abgebildeten Szene beteiligt.19
In seiner Subtilität ist diese Mittel schwer zu fassen und ich denke auch, dass sich an der Art der Interpretation einiges geändert hat. Die ausdruckslosen Gesichter von Frauen wie von Männern gehen einher mit lässigen Posen in einer neutralen Umgebung. Es wird meist das Gefühl vermittelt, gar keine Gefühle zu haben oder haben zu wollen. Die Figuren der Anzeige mustern den/die BetracherIn ohne ihn/sie zu werten. Insofern findet tatsächlich eine Einladung statt, sich in die neutrale Welt der perfekten Körper und der Gefühllosigkeit zu begeben. Anzeigen dieser Art sind sowohl im Frauenmagazin als auch im Männermagazin zu finden und werben fast ausschließlich für Modedesigner und wollen vermitteln, dass die/der TrägerIn der Kleidung diese erstens an jedem beliebigen Ort tragen kann und zweitens über alle Gefühle erhaben ist. Sie/Er ist unantastbar. Die Werbung überspielt den Objektcharakter der abgebildeten Körper durch eine scheinbare Unnahbarkeit. Dabei werden die Körper nicht selten zu bloßen „Kleiderständern“.
Wie oben schon beschrieben, spielt die erotische Anziehung des weiblichen Körpers eine erstaunlich geringe Rolle dabei, bei einem männlichen Publikum für den Konsum eines Produktes zu werben. Im Vordergrund steht nicht mehr so sehr der Gedanke „Wenn ich dieses Produkt kaufe, dann bin ich für erotische Frauen begehrenswert“ oder „... dann kann ich mir Sexualität leisten“, sondern die eigene Erotik, die entweder auf sich selbst gerichtet ist20, oder auf andere Männer oder Frauen. Im Frauenmagazin hingegen, stellt sich der weibliche Körper als erotisch für den Betrachter dar. Die Sexualität findet also nicht innerhalb der Anzeige sondern in der Kommunikation mit dem/der BetrachterIn statt. Das Gefühl, das vermittelt werde soll, ist „ich bin erotisch“ oder zumindest „ich will auch so erotisch sein“. Da die Frau fast nie bei einer bestimmten Tätigkeit abgelichtet wird, reduziert sich der Wunsch auch nur darauf. Bezeichnend ist aber, dass sich die weibliche Erotik offensichtlich nicht auf sich selbst bezieht, sondern auf die Wirkung, die der Körper auf andere hat.
Das Kindchenschema, das, wie Schweiger und Schrattenecker beschreiben21, zu den wichtigsten Stimuluskategorien gehört, findet sich eher in der MC. Kinder treten etwas häufiger in den Anzeigen auf als in denen der GQ. Mit Babys oder Kindern wird in beiden Magazinen wenig geworben, in der MC etwas mehr, was vor allem auf die Werbung für die Zeitschriften „Eltern“ und „Eltern for family“ zurückzuführen ist.22 Allerdings wird der weibliche Körper selbst in den Anzeigen der MC desöfteren im Kindchenschema dargestellt: Er muss sehr jung sein (im Gegensatz zu den reiferen Männern sind die reiferen Frauen in der Werbung extrem unterrepräsentiert) und wird häufig mit Weichzeichner abgelichtet oder in eine rosafarbenen, strahlenden Umgebung gestellt. Auch diese Anzeigen werben hauptsächlich für Pflegeprodukte oder Kosmetikartikel und sind ausschließlich in der MC zu finden.
4.3 Der perfekte Körper und das Alter
In der Werbung sind fast alle Körper „perfekt“. Zur Vorstellung einer Traumwelt gehört in unserer Zeit besonders auch die Verherrlichung der Jugend, mit der Fitness, Erotik, und Freiheit verbunden sind. In seltenen Fällen wird zugestanden, dass ein Körper eventuell auch nicht schlank ist und dass er dem Prozess des Alterns nicht entgehen kann. In der GQ habe ich keine einzige Frau gefunden, die im Alter dargestellt wird oder die nicht dem Schlankheitsideal entspricht. Der weibliche Körper, der in den Anzeigen des Männermagazins entworfen wird, ist frei von jedem Alterungsprozess und erweckt den Eindruck, immer perfekt zu bleiben. Er wird somit seines eigentlichen Lebens beraubt und zum Schmuckstück degradiert. Der Mann hingegen darf auch in der Werbung altern und eine Entwicklung durchmachen.
Ein Beispiel verdeutlicht den Gegensatz: Über zwei Seiten verläuft am unteren Rand die Bildergalerie eines Mannes von jung bis alt. Auf dem ersten Bild sitzt der Mann bequem auf einem Stuhl und hat eine Frau auf seinem Schoß, die unter sein Hemd greift und ihn küsst. Auf dem zweiten Bild nimmt er eine ähnliche Pose mit einer anderen Frau ein, die sich an ihn schmiegt und den Arm um ihn legt. Auf dem dritten Bild sitzt eine weitere neue Frau in Abendgaderobe neben ihm und er legt den Arm um sie. Auf dem vierten Bild wird die Frau durch einen Hund ersetzt. Der Mann - inzwischen mit Brille - kniet bei dem Hund im Garten. Auf dem fünften Bild schließlich ist er ein reifer Mann mit einer neuen Freundin, die allerdings um einiges jünger ist. Sie schmiegt sich an ihn, schaut ihn lachend an, er sitzt bequem und blickt in die Kamera.23 Aus den Anzeigen in der MC wird das Altern der Frau auch fast gänzlich ausgeklammert, allerdings gibt es eine Werbung, die mit einer älteren Dame als Model arbeitet24, und eine Anzeige von Brigitte, die das Altern selbst thematisiert und Mut machen soll, sich dem Alter zu stellen25.
Der perfekte Körper ist ein großes Thema der Anzeigen in der MC: Sie werben für hautstraffende Produkte, Kosmetikutensilien etc. Bezeichnend ist, dass die Werbung für ein Abführmittel in fast allen untersuchten Ausgaben zu finden ist. Die Anzeige zeigt zwar nur das lachende Gesicht einer Frau, die eine Dose „Dulcolax“ vor sich hält, impliziert aber den Wunsch aller Frauen, schlank zu sein. Diese Werbung unterstützt auf subtile Weise die Angst vor Übergewicht und Alterungsprozess sowie in der äußersten Konsequenz Essstörungen.26
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Anzeigen einer Firma, die für Mode in Übergrößen werben. Die abgebildete Frau ist nicht mehr so jung wie all die anderen Models und hat eine relativ normale Figur. Auf einer der Anzeigen ist unter dem Kleid ein leichter Bauchansatz zu sehen. Die Modefirma Marina Rinaldi wirbt mit dem Slogan „Mode ist keine Frage der Größe“, jedoch ist keine übergewichtige Frau abgebildet, sondern eine mit Proportionen, wie man sie aus dem Alltagsleben her gewöhnt ist. Somit unterstützt diese Werbung doch wieder das Schönheitsideal, dem sie vermeintlich entfliehen wollte, denn eine Frau, die schlanker als das Model dieser Werbung ist, kommt der Figur der anderen Models am nächsten.27
Eine Besonderheit ist eine Anzeige der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention in der MC, die für die Früherkennung von Hautkrebs wirbt: „Solange Sie nicht beim Arzt waren, können Sie nur raten.“28 Hier wird direkt eine Krankheit thematisiert, d.h. es wird der Tatsache ins Auge gesehen, dass der Körper nicht ewig jung bleiben kann und nicht perfekt sondern sehr anfällig für Krankheiten ist. Es ist die einzige Anzeige, die in dieser Richtung arbeitet, aber es ist bezeichnend, dass sie in der MC und nicht in der GQ steht: Im Frauenmagazin ist der Körper das Objekt, mit dem sich am meisten beschäftigt wird.
4.4 Der künstliche Körper
Die Körper, die in der Werbung abgebildet werden, sollen möglichst perfekt sein. Einerseits weil die geltenden Schönheitsideale den makellosen Körper vorschreiben und andererseits, um die Traumwelt der Werbung nicht zu stören. Einige Werber sind dazu übergegangen, den Körper zu modellieren und für die Werbung neu zu schaffen. BP zum Beispiel wirbt mit einer Roboterfrau und dem Slogan „Give Live“29. Der Körper ist teilweise durchsichtig und lässt den Blick auf Metallgelenke und Plastikschläuche frei. Allein das Gesicht ist in sich geschlossen und ausmodelliert (Arme, Rücken und Brust sind hingegen dem Körper eher nachempfunden und hängen lose zusammen). Die Augen haben Wimpern und blicken direkt in die Kamera - und wirken realistisch. Ich finde es für eine Anzeige in der GQ bezeichnend, dass kein männlicher Roboter geschaffen wurde. Denn ein solcher wäre mit Sicherheit aggressiver bzw. weniger als Abbild des perfekten Körpers sondern viel technischer ausgefallen30 und würde als formbarer Körper weniger zur Konvention passen: Der weibliche Körper ist derjenige, der modelliert werden kann, sei es durch Korsagen oder Operationen. Deshalb kann auch nur der weibliche Roboter dem tatsächlichen Körper nachempfunden werden und die Erotik andeuten, die auch von einem künstlich hergestellten Körper ausgehen kann. Der Blick der Roboterfrau ist kühl und abschätzend, als würde sie den Betrachter prüfen wollen. Die Pose erinnert an das Verhalten vor einem Flirt, bei dem Desinteresse vorgetäuscht wird. In der MC läßt sich entsprechend kein Roboter finden - weder ein männlicher noch ein weiblicher.
Es gibt jedoch auch reale Körper, die in der Werbung so verfremdet werden, dass sie wie künstlich erschaffen wirken. Diese Körper sehen aus wie Puppen, wie Spielzeug also, über das nach Belieben verfügt werden kann. In der GQ wirbt Diesel Footwear mit einer eher witzigen Variante31: Eine junge Frau mit einem Gesicht und einem Körper wie aus Porzellan sitzt mit verschränkten Armen und Beinen in einer sehr unbequem anmutenden Position. Hinter ihr macht ein ebenso porzellanhaft aussehender junger Mann eine „Brücke“, indem er ins Hohlkreuz geht, Hände und einen Fuß auf den Boden stellt, das andere Bein in die Höhe reckt. Beide sind nur mit Schuhen bekleidet. Der Text dazu lautet:
Save Yourself / Yoga. „We haven’t moved for over 120 years. But it’s worth it - by enjoying the spiritual benefits of yoga, the bright flower of our youth can never die.“ Florence Canterbury & Tom Verne, born 1876.32
Diese Anzeige, so wie auch die ähnlich gestaltete zweite von Diesel footwear, thematisiert den formbaren Körper und den Körperkult auf ironische Weise. Die Figuren sehen nicht mehr aus wie reale Menschen und nehmen Posen ein, die kaum ein in der Gymnastik oder in Yoga ungeübter Mensch ohne größere Schmerzen nachahmen könnte. Der Körperkult wird in der Anzeige so auf die Spitze getrieben, dass die Absurdität deutlich wird.
Derart ironische oder witzige Anzeigen finden sich generell eher in der GQ. Jedoch sind auch in der MC zwei Anzeigen zu finden, die den Puppencharakter der Models inszenieren: Moschino wirbt in zwei Ausgaben mit verschiedenen Motiven von „Anziehpuppen“33. Die erste Anzeige wirbt mit einer Frau, die im Querformat auf rosafarbenem Hintergrund liegt und wegen ihrer roten langen Haare, die um sie ausgebreitet sind, an Venus- oder Hexendarstellungen erinnert. Auch sie hat eine Haut, die an Porzellan erinnert, oder aber auch an Wachs, trägt aber ein Kleid. Sie ist mit Schnüren um die Arme am Hintergrund befestigt, um sie herum sind Utensilien wie ein Feenhut, ein „Zauberstab“, ein Handtäschchen und Sandalen ebenfalls mit Schnüren am Hintergrund befestigt. Der Körper dieser Frau wird zum Spielzeug, das mit den beliebten Attributen einer Fee ausgestattet werden, ausgezogen oder als Schaustück in der Schatulle gelassen werden kann. Mit der Numerierung „Fashion Outfit N° 17“ erinnert die Anzeige sehr an die Schachteln, in denen Barbiepuppen verkauft werden.34 Die Ironie der Anzeige vermindert sich deutlich, wenn in Betracht gezogen wird, dass sie auf der anderen Seite auch ernsthaft mit der Puppe als Spielzeug des Mädchens, das die Betrachterin einmal war, arbeitet. Der Wunsch wird angesprochen, Elemente aus der Kindheit wiederzubeleben, um sich im Erwachsenenalter auch spielerischen Traumwelten hingeben zu können. Vergleicht man damit die Werbung für Versace35, in der mit einem Model geworben wird, das selbst an eine Barbiepuppe erinnert, erhärtet sich der Verdacht, dass die Ironie eine geringere Rolle spielt als in den Anzeigen der GQ.
4.5 Spiel mit der Nacktheit
In vielen Werbungen in beiden Magazinen soll möglichst viel Haut gezeigt werden oder zumindest die Vorstellung von Nacktheit als Option in Aussicht gestellt werden. Die natürliche Nacktheit, wie ich sie eingangs beschrieben habe, ist jedoch fast ausschließlich in der MC zu finden. Die abgebildeten weiblichen Körper beziehen sich meist nur auf sich selbst und posieren, als würden sie nicht beobachtet oder als wären sie gar nicht nackt. Das Gefühl des Sichwohlfühlens soll vermittelt werden, um die BetrachterInnen zu Kauf der Pflegeprodukte anzuregen.
Akte hingegen werden in beiden Magazinen abgebildet, und dann auch Akte beiderlei Geschlechts. In der GQ überwiegen jedoch die erotisch angehauchten Aktfotografien.
4.6 Rollenverhalten der Geschlechter
Die meisten Anzeigen beider Magazine folgen in der Darstellung der Geschlechter im Verhältnis zueinander den Konventionen, wie sie schon Goffman 197636 beschrieben hat. Deshalb möchte ich diese nicht im Einzelnen beschreiben. Es gibt jedoch immer mehr Ansätze, die aus dem Schema ausbrechen, und die Rollen der Geschlechter neu definieren. Eine Neuerung ist zum Beispiel, dass die männlichen und weiblichen Models auf gleicher Höhe und völlig gleichwertig abgebildet werden. Meist stehen die Figuren in solchen Anzeigen kaum in Bezug zueinander, die Körperlichkeit wird getrennt von Tätigkeiten oder erotischen Wünschen, der Körper wird zur Schaufensterpuppe.37 Solche Anzeigen sind jedoch selten und fast nur in der GQ zu finden. Sie wirken meist kühl und unnahbar und wecken kaum Emotionen. Der künstlerische Aspekt der Werbung wird betont.
Eine wichtige Abweichung von den Konventionen sind Anzeigen, auf denen die Models homosexuell wirken oder androgyn sind. Besonders in der GQ gibt es mehrere Anzeigen, die mit homoerotischen Anspielungen werben. Entweder arbeiten sie mit einer äußerst kitschigen Ästhetik, wie Jean Paul Gaultier, der für sein Parfum „Le male“ mit Matrosen wirbt, die sehr muskulös sind und den Betrachter schmachtend ansehen.38 Oder das abgebildete Model gibt sich in Posen der Verführung, die eindeutig auf das männliche Geschlecht fokussiert sind39, oder wie sie der Betrachter von den weiblichen Models her kennt. In solchen Anzeigen trägt das männliche Model zum Beispiel Kleidungsstücke, die bisher eigentlich nur Frauen getragen haben.40 Oder der Gesichtsausdruck zeigt Genuss bzw. Lust: Die Augen sind auf den Betrachter gerichtet, die Lippen leicht geöffnet und die Haltung ist insgesamt entspannt lässig.41 In solchen Posen ist auch der männliche Körper zum direkten Objekt geworden.
In der MC gibt es weniger homoerotisch anmutende Anzeigen, da diejenigen, welche Erotik zwischen Frauen thematisieren, den Konventionen der herkömmlichen Schönheitsideale angepasst sind, welche von der Heteroerotik bestimmt sind: Die Haare sind lang, die Röcke kurz, Attribute wie Taschen oder ähnliches Zubehör für „typische Frauen“ sind nicht aus dem Bild wegzudenken. Somit wirken diese Anzeigen weniger als homoerotisch für sich, sondern wie die berühmten Phantasien von Männern, die gerne mal beim Sex zwischen zwei Frauen zusehen würden. Ein besonders eklatantes Beispiel ist die Anzeige von Dior, die schon fast an Pornographie grenzt.42 Eine Anzeige, die gerade nicht dieser Konvention folgt, unterstützt die These, da sie zeigt, wie die Werbung auch funktionieren könnte: Zwei eher androgyn wirkende Frauen stehen nebeneinander in Posen, die nicht typisch für die Weiblichkeit in der Werbung sind. Sie sind in gewisser Weise ein Paar, weil sie im Partnerlook gekleidet sind, und sich dadurch aufeinander beziehen, dass die eine Frau sich auf die andere lehnt. Es „knistert“ im Bild, ohne dass offensichtlich etwas passiert.43 Androgyne Models sind insgesamt eher selten. Männliche Models, die androgyn wirken, gibt es nur in der GQ44, weibliche Models, die androgyn wirken, dahingegen nur in der MC45. Der/die BetrachterIn setzt sich also anscheinend lieber mit der Verwandlung des eigenen Geschlecht auseinander. Auf spielerische Art kann die Wirkung ausprobiert werden, jedoch sinkt das Interesse, wenn das andere Geschlecht auf ähnliche Weise versucht, sein Geschlecht zu überwinden.
Eine einzige Werbung habe ich gefunden, die sich explizit gegen die herkömmliche Verteilung der Geschlechterrollen wendet. Bezeichnenderweise ist diese Anzeige in der GQ abgedruckt, wendet sich aber an Frauen: VW wirbt mit dem Slogan „Natürlich braucht man Männer. Aber die Sterne vom Himmel holen wir uns lieber selbst.“46 und dem Bild zweier Frauen, die im Cabriolet unter dem Sternenhimmel sitzen.
5 Was bleibt vom Körper? - Ein Ausblick
Obwohl die herkömmlichen Muster in der Werbung weiter wirken, ist eine Veränderung zu erkennen. Gerade Männer werden häufiger in Posen dargestellt, die sonst den Frauen vorbehalten waren: Auch sie zeigen sich sehr erotisch und in einer Umgebung, die nur auf sie selbst bezogen bleibt. Dennoch bleibt die Frage: Ändert dies auch etwas an der Zuordnung Mann - Subjekt, Frau - Objekt? Es bleibt dabei, dass Frauen im Männermagazin auf sehr erotische Art dargestellt werden. Meist gibt es eine männliche Bezugsperson, auf die sich entweder die Erotik der Frau bezieht (wenn sich die Frau dem Mann zu Füßen legt oder sich für ihn auszieht), oder die gleichermaßen zur erotischen Wirkung des Bildes beiträgt (wenn etwa ein sich küssendes Paar in Unterwäsche gezeigt wird). Es gibt aber auch Einzeldarstellungen von Frauen, die nur für den Betrachter erotisch sind.
Im Frauenmagazin hingegen finden sich keine Männer, die in einer ähnlich erotischen Weise dargestellt sind. Abbildungen von Männern, die sich als erotisches Objekt präsentieren, gibt es nur in der GQ. Die Erotik des männlichen Körpers bezieht sich also entweder auf sich selbst: „Wenn ich dieses Produkt kaufe, steigert sich meine Lust und ich bestätige mich in meinem Selbstwertgefühl“. Oder aber die Anzeige zielt direkt auf ein homosexuelles Publikum, das sich in gewisser Weise wieder auf sich selbst bezieht, da der Körper des anderen dem eigenen gleicht. Erotik, die auf das eigene Geschlecht zielt, gilt immer auch dem Selbst. Erotische Darstellungen, die auf das andere Geschlecht zielen, geben dem Betrachter das Gefühl, das Model würde sich nur ihm darbieten, ja sogar anbieten.
Schwierig ist die Interpretation der erotischen Darstellungen im Frauenmagazin. Denn auch diese müssten sich gemäß meiner Ausführungen auf sich selbst beziehen. Dem steht jedoch die Konvention der Abbildung des weiblichen Körpers entgegen, nach der die Frau meist nur für Männer abgebildet wurde und nicht für ein weibliches Publikum. Die Ästhetik der Bilder entspricht zum Beispiel derjenigen der Fotostrecken aus der GQ. Diese sind eindeutig darauf angelegt durch die Inszenierung einer (halb-) nackten Frau beim männlichen Leser Lustgefühle hervorzurufen. Deshalb interpretiere ich die erotische Darstellung von Frauen im Frauenmagazin anders: Die Frau erkennt das Potential, das in der eigenen Erotik steckt, und macht sich den Objektcharakter des eigenen Körpers zunutze. Dies entspricht einer Bewegung, die auch im täglichen Leben zu betrachten ist. Sie rührt aus einer verdrehten Umbewertung der sowieso von den Männern diktierten Körperlichkeit der Frau, die wieder dort ankommt, wo sie begann: Der weibliche Körper war und bleibt Objekt.
Durch die Ausrichtung auf die Zielgruppen und deren Gewohnheiten, scheint es natürlich, dass in der MC die Anzeigen für Kosmetikartikel und Pflegeprodukte überwiegen, und dass es dementsprechend in der GQ mehr Werbungen gibt, die ohne Körper auskommen. Aber die Festlegung der Zielgruppe Frau auf Produkte, die nur zur Verschönerung des Körpers dienen, unterstützt wieder den Objektcharakter des weiblichen Körpers: Er muss immer herausgeputzt sein um wirken zu können. Das Wirkungsfeld der Frau beschränkt sich in der Werbung auf die Ausstrahlung ihres Körpers.
Andererseits gibt es Zeichen dafür, dass sich die Zuweisung der Geschlechter in diesem Bereich aufweicht: In der GQ wird ebenso für Parfums geworben und in der MC gibt es auch Anzeigen für Autos und Uhren. Dennoch überwiegen die Anzeigen, die in den herkömmlichen Rollenmustern verhaftet bleiben. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel, dass Frauen viel häufiger in unbequemen Positionen dargestellt werden als Männer, welche eher entspannt und lässig wirken. Die Werbung funktioniert bei der weiblichen Zielgruppe immer noch häufig nach dem Motto „Wer schön sein will, muss leiden“, lässt sich den Mann jedoch unverkrampft und locker darstellen. Seine Schönheit ist eine natürliche. (Die Anstrengungen, die der männliche Körper beim Muskelaufbau ertragen muss, sind ausgeblendet: Der muskulöse Körper ist zwar vor Kraft strotzend, aber die Kraft scheint ohne Mühen erworben worden zu sein.)
Trotz einiger Versuche, in Anzeigen aus den herkömmlichen Mustern der Darstellung von männlichen und weiblichen Körpern auszubrechen, bleibt es größtenteils bei der alten Rollenverteilung. Kaum eine Anzeige ironisiert diesen Wertekonservatismus. Es bleibt abzuwarten, ob die Werbung zunehmend ohne Darstellungen von Körpern arbeitet und ob die Rollen doch noch umbewertet werden. Schon jetzt gibt es in einigen Magazinen, die an kritischer denkende Zielgruppen gerichtet sind, Anzeigen, die männliche und weibliche Körper gleichwertig darstellen, Körper abbilden, die nicht klar als männlich oder weiblich erkannt werden können, oder die ganz ohne die Abbildung von Körpern auskommen.
Es bleibt zu untersuchen, wie weibliche und männliche Körper in anderen Magazinen und anderen Medien dargestellt werden. Ich vermute, dass die Fernsehwerbung auf ähnlich konservative Weise mit dem Körper umgeht, da gerade im Fernsehen in vielen Serien und Filmen die herkömmlichen Rollen der Geschlechter weiterhin gespielt werden.
Ob die Werbung tatsächlich das Verhätlnis der Geschlechter in der Wirklichkeit abbildet, sei dahin gestellt. Aber sie formt weiterhin das Bild einer Gesellschaft, die in tradierten Rollenmustern verhaftet bleibt und selten Versuche startet, auf diesem Gebiet Neuland zu betreten.
6 Bibliographie
Sekundärliteratur:
Berger, John u.a.: Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt. Hamburg 1998.
Goffman, Erving: Geschlecht und Werbung. Frankfurt am Main 1981
Schweiger, Günter; Schrattenecker, Gertraud: Werbung. Eine Einführung. Stuttgart, Jena 1995 4
Verwendete Zeitschriften:
Marie Claire, Gruner & Jahr München
Ausgaben: 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/20000, 7/2000, 8/2000, 9/2000, 10/2000, 11/2000, 12/2000, 3/2001, 4/20011, 5/2001, 6/2001, 7/2001, 8/2001, 9/2001, 12/2001
GQ, Condé Nast München
Ausgaben: 5/1999, 6/2000, 7/2000, 9/2000, 10/2000, 11/2000, 11/2000, 1/2001, 3/2001, 4/2001, 5/2001, 6/2001, 7/2001, 8/2001, 11/2001
[...]
1 Schwaiger, Schrattenecker 1995, S.9
2 vgl. Goffmann 1981, Kap.1/2
3 Berger 1998; die folgende Argumentation ist an seinen Text angelehnt.
4 Berger 1998, S. 138
5 Foucault 1995
6 im Folgenden „MC“
7 Der Umfang beider Zeitungen beträgt in etwa 215 Seiten (durchschnittliche Seitenzahl GQ: 220 S., MC: 211 S.). Die untersuchten Zeitungen erschienen zwischen Mai 1999 und Dezember 2001, bei MC untersuchte ich 18, bei GQ 14 Ausgaben.
8 vgl. Schweiger/Schrattenecker 1995, S. 187/188
9 vgl. Goffman 1981, der z.B. das Kindchenschema eindeutig der Frau zuordnet, und ihre untergeordnete Rolle betont.
10 Berger 1998, S.51
11 vgl. Goffman 1981, S.65
12 Schon Goffman hat gezeigt, dass Frauen in der Werbung mehr Gefühle zugestanden werden als Männern. vgl. Goffman 1981, S.224 ff.
13 Ein schönes Beispiel: GQ 9/2000, S.60/61. In dieser Werbung für Sisley liegt ein Mann in Jeans und mit freiem Oberkörper auf einem Bett und hält sich eine Sektflasche senkrecht über seinen Schambereich und macht sie somit zum Phallussymbol. Vgl. Anhang Abb.1
14 Vgl. dazu GQ 10/00, S.259: In dieser Werbung für Moët & Chandon kann die Sektflasche ebenfalls als Phallussymbol interpretiert werden, allerdings steht sie hier in Bezug zu einer Frau, die gewissermaßen über der Flasche hockt. Vgl. Anhang Abb.2
15 MC 5/2000, S.167, Anhang Abb.3
16 Ich möchte nicht zu sehr auf diese Kategorien eingehen, da sie den Geschlechterrollen in der Werbung entsprechen, die Goffman ausführlich beschrieben hat. Im Anhang sind Beispiele zu finden: Abb.32 ff.
17 GQ7/00, S.31, Anhang Abb.4
18 GQ 6/00, S.41, Anhang Abb.5
19 Goffman 1981, S.65
20 Ein gutes Beispiel für die Autoerotik ist die Uhrenwerbung von Calvin Klein in der GQ 4/01, S.25, und 5/01, S.75, Anhang Abb.6/7: Beide haben im Fokus ein überdimensional großes Handgelenk. Erst beim zweiten Hinsehen bemerkt man, dass die Hand sich in der ersten Anzeige unter das T-Shirt fährt und sich anscheinend Bauch oder Brust streichelt. In der zweiten Anzeige greift sich die Hand in die Hose. Die Uhr scheint äußerst anregend auf die eigene Sexualität des Mannes zu wirken...
21 Schweiger/Schrattenecker 1995, S.187 f.
22 Die Bedeutung der Anzeigen für die beiden Zeitschriften ist für meine Untersuchung relativ gering, da die Magazine im gleichen Verlag wie MC erscheinen, und somit davon ausgegangen werden kann, dass sie wegen der günstigen Bedingungen in der MC erscheinen.
23 Anzeige für Hennessy in der GQ 1/01, S.42/43, Anhang Abb.8
24 MC 3/01, S.6/7: Marithé + Francois Girbaud, Anhang Abb.9
25 MC 4/00, S.211, Anhang Abb.10: Brigitte special. Die Anzeige wirbt mit dem Text „Ich wär so gern noch mal dreißig.“ „Ich auch.“ „Ich auch.“ „Ich nicht!“
26 MC 7/00, S.69, Anhang Abb.11
27 MC 3/00 S.98/99, MC 4/00 S.35, Anhang Abb.12
28 MC 5/00, S.144, Anhang Abb.13
29 GQ 7/00, S.33, Anhang Abb.14
30 Ich denke an verschiedene Roboterfiguren, die ich aus den Medien kenne: Ist ein Roboter männlich, dann entweder eine Witzfigur oder der Bösewicht, der die Macht an sich reißen will. Geschlechtsneutrale Roboter verhalten sich je nach Programmierung und die weiblichen dienen v.a. der Verführung des Gegners.
31 GQ 8/00, S.109 und S.189, Anhang Abb.15
32 GQ 8/00, S.109, Abb.15
33 MC 3/00, S.80/81; MC 9/00, S.58/59, Anhang Abb.16a/b
34 In der zweiten Anzeige ist der Puppencharakter nicht mehr so deutlich, ja sogar nur zu erkennen, wenn man die vorhergehende Anzeige ein halbes Jahr früher gesehen hat Sie stellt eine an eine „Domina“ erinnernde Frau in Uniform, Strapsen und mit Patronengürtel, in dem Lippenstifte stecken, dar. Jedoch sind weder sie noch die Utensilien an den Hintergrund gebunden.
35 MC9/00, S.41, Anhang Abb.17
36 Erscheinungsjahr der Erstausgabe von Gender Advertisments
37 vgl. z.B. GQ 9/00, S.22/23, Anhang Abb.18
38 GQ 5/99, S.45; GQ 6/00, S.13, GQ 7/00, S.23 etc. Anhang Abb.19
39 Vgl. die oben erwähnte Sisley-Werbung GQ 9/2000, S.60/61 und andere autoerotisch angehauchten Anzeigen
40 vgl. GQ 9/00, S.67, Anhang Abb.20: Anzeige für Iceberg, auf der ein Mann im Pelzmantel abgebildet ist.
41 vgl. GQ 7/00, S.7: Versace; GQ 9/00, S.4-7: Gucci etc., Anhang Abb.21/22
42 MC 5/00, S.19; vgl. auch MC 8/00 S.97: Custo, Anhang Abb.23/24
43 MC 3/01, S.10/11: Armani, Anhang Abb.25
44 GQ 9/00, S.30/31: Kenzo; GQ 11/00, S.28/29: Hermés; GQ 1/01, S.115: Gucci, Anhang Abb.26-28
45 MC 9/00, S.20/21: Armani, MC 3/01, S.10/11: Armani; MC 5/01, S.67: Guggenheim Bilbao; Anhang Abb.25, 29, 30
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Körpers in der Werbung, insbesondere in Bezug auf Geschlechterrollen und die Ansprache von Gefühlen in Anzeigen. Sie vergleicht Anzeigen in den Zeitschriften GQ (Gentleman's Quarterly) und Marie Claire (MC), um zu analysieren, wie der Körper als Blickfang eingesetzt wird und welche Zielgruppen angesprochen werden.
Welche Zeitschriften wurden für die Analyse verwendet?
Für die Analyse wurden die Männermagazin GQ (Gentleman's Quarterly) und das Frauenmagazin Marie Claire (MC) ausgewählt. Diese Zeitschriften richten sich an klar definierte Zielgruppen und vermitteln unterschiedliche Lebensstile und Geschlechterrollen.
Welche Themen werden in Bezug auf den Körper in der Werbung untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem folgende Themen: Der Reiz der Werbung, das Spiel mit den Gefühlen, der Körper als Blickfang (weiblicher und männlicher Körper), der Vergleich der Anzeigen in GQ und MC (Zielgruppe, Vermittlung von Gefühlen, der perfekte Körper und das Alter, der künstliche Körper, Spiel mit der Nacktheit, Rollenverhalten der Geschlechter) und ein Ausblick auf die Zukunft der Körperdarstellung in der Werbung.
Wie wird der weibliche Körper in der Werbung dargestellt?
Der weibliche Körper wird oft in Teilen abgebildet, wobei Füße, Beine, Hände und Haare besondere Beachtung finden. Bei Abbildungen der ganzen Frau werden Bauch und Busen oft betont. Insgesamt wird die Nacktheit des weiblichen Körpers häufig inszeniert. Die Gefühle reichen von unbewegt bis zu Erstaunen und Schmerz. Der Körper wird oft auf seine Funktion als Körper reduziert und in einer Traumwelt ohne Bezug zur realen Welt dargestellt.
Wie wird der männliche Körper in der Werbung dargestellt?
Der männliche Körper zeigt im Allgemeinen weniger Haut als der weibliche Körper. Fokussierungen auf bestimmte Körperteile sind weniger erkennbar. Typisch sind Abbildungen des Kopfes oder Oberkörpers eines Mannes, der in die Ferne schaut. Die Gefühlspalette des Mannes ist weniger vielfältig als die der Frau. Der männliche Körper wird oft in Freizeit-Umgebungen gezeigt, aber weniger als Objekt angeboten.
Welche Rolle spielt die Erotik in den Anzeigen der GQ und MC?
In der MC wird der weibliche Körper häufig als erotisches Objekt dargestellt, um die Identifikation der Betrachterin mit einer erotisch anziehenden Frau zu fördern. In der GQ wird der Frau keine "autarke" Erotik zugestanden; sie bezieht sich meist auf einen Mann. Die Anzeigen im Männermagazin haben die zusammenhangslose Zuordnung von Erotik und neutralen Gegenständen weitgehend aufgehoben.
Wie werden Alter und der "perfekte Körper" in der Werbung behandelt?
In der Werbung werden fast alle Körper als "perfekt" dargestellt, wobei die Jugend verherrlicht wird. Der weibliche Körper wird im Allgemeinen frei von Alterungsprozessen dargestellt, während Männer auch altern dürfen. Es gibt jedoch auch Anzeigen, die sich mit älteren Models oder der Thematisierung des Alterns auseinandersetzen.
Welche Rolle spielt der "künstliche Körper" in der Werbung?
Einige Werber verwenden modellierte oder künstlich geschaffene Körper, um Perfektion darzustellen. Ein Beispiel ist eine Roboterfrau, die von BP verwendet wird. Es gibt auch reale Körper, die so verfremdet werden, dass sie wie künstlich erschaffen wirken.
Welche Rollenverhalten der Geschlechter werden in der Werbung dargestellt?
Die meisten Anzeigen folgen den konventionellen Rollenverhalten der Geschlechter. Es gibt jedoch zunehmend Ansätze, die aus dem Schema ausbrechen und die Rollen der Geschlechter neu definieren, z.B. durch die gleichwertige Abbildung von männlichen und weiblichen Models oder durch homoerotische Anspielungen.
Welche Schlussfolgerungen werden aus der Analyse gezogen?
Obwohl die herkömmlichen Muster in der Werbung weiterhin wirken, ist eine Veränderung zu erkennen. Frauen im Männermagazin werden auf sehr erotische Art dargestellt. Erotik, die auf das eigene Geschlecht zielt, gilt immer auch dem Selbst. Erotische Darstellungen, die auf das andere Geschlecht zielen, geben dem Betrachter das Gefühl, das Model würde sich nur ihm darbieten. Die Werbung formt weiterhin das Bild einer Gesellschaft, die in tradierten Rollenmustern verhaftet bleibt und selten Versuche startet, auf diesem Gebiet Neuland zu betreten.
- Quote paper
- Bettina Lang (Author), 2000, Körper in der Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106279