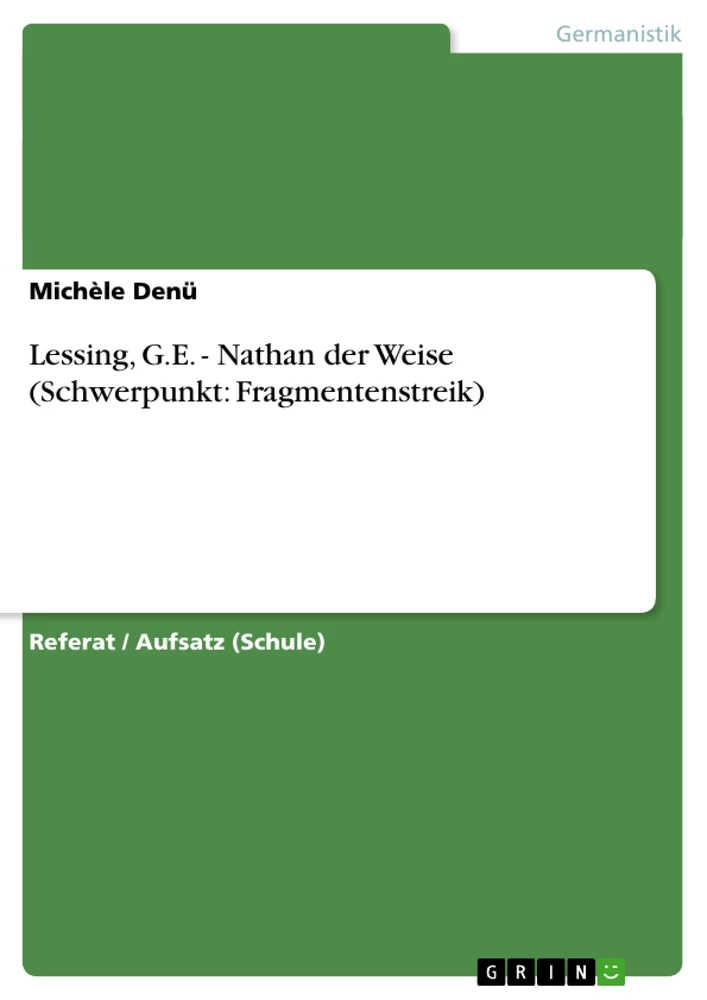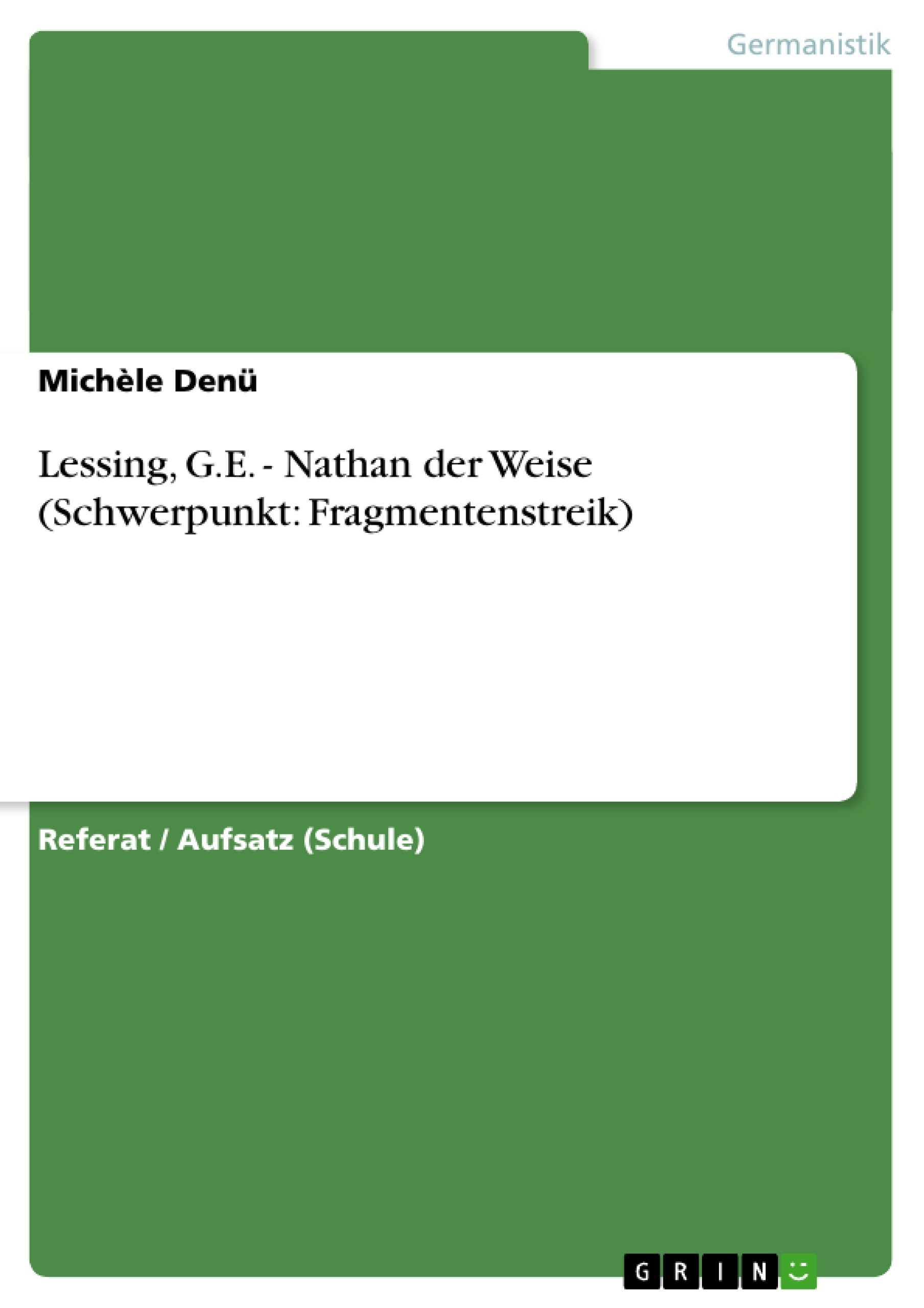Ein flammender Geist in einer Zeit des Umbruchs: Tauchen Sie ein in das Leben und Werk von Gotthold Ephraim Lessing, einem der einflussreichsten Denker und Dichter der deutschen Aufklärung. Diese umfassende Biographie beleuchtet Lessings Werdegang vom Pfarrerssohn zum gefeierten Dramatiker, Kritiker und Philosophen. Verfolgen Sie seine intellektuelle Entwicklung, von den frühen Lustspielen wie "Der junge Gelehrte" und "Minna von Barnhelm" bis hin zu seinen bahnbrechenden Trauerspielen "Miss Sara Sampson" und "Emilia Galotti", die das deutsche Theater revolutionierten. Erleben Sie die Kontroversen, die Lessings Leben prägten, insbesondere den Fragmentenstreit mit Goeze, der zur Entstehung seines berühmtesten Werkes führte: "Nathan der Weise", ein leidenschaftliches Plädoyer für Toleranz, Vernunft und Menschlichkeit. Entdecken Sie Lessings bedeutenden Einfluss auf die deutsche Literatur und Gesellschaft, seine Rolle als Wegbereiter der Emanzipation des Bürgertums und sein Engagement für die Befreiung der Dichtung von französischen Einflüssen. Diese Analyse ergründet Lessings kunsttheoretischen Schriften, seine Kritik an der französischen Klassik, seine Verteidigung Shakespeares und seine Auseinandersetzung mit den Grenzen von Malerei und Poesie im "Laokoon". Erfahren Sie, wie Lessing mit seinen Ideen die Kunstauffassung und -ausübung der Klassik maßgeblich beeinflusste und die deutsche Literatur nachhaltig prägte. Begleiten Sie ihn auf seinem Weg von Leipzig über Berlin und Hamburg bis nach Wolfenbüttel, wo er als Bibliothekar wirkte und seine letzten, von theologischem Streit und persönlichem Verlust gezeichneten Lebensjahre verbrachte. Lassen Sie sich von Lessings unerschütterlichem Glauben an die Kraft der Vernunft und die Notwendigkeit des kritischen Denkens inspirieren und entdecken Sie die zeitlose Relevanz seiner Werke für unsere heutige Gesellschaft. Diese tiefgründige Auseinandersetzung mit Lessings Leben und Schaffen bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über sein Werk, sondern auch eine faszinierende Reise in das Herz der Aufklärung und die Geburt der modernen deutschen Literatur. Analysen seiner bedeutendsten Werke wie "Nathan der Weise", "Emilia Galotti" und "Laokoon" werden in den Kontext seiner Biografie und des historischen Zeitgeschehens gesetzt, um ein umfassendes Verständnis von Lessings Denken und Wirken zu ermöglichen. Die Einordnung seines Schaffens in die Epoche der Aufklärung, seine Auseinandersetzung mit religiösen Dogmen und seine Verteidigung der Vernunft machen diese Biographie zu einer wertvollen Quelle für alle, die sich für deutsche Literaturgeschichte, Philosophie und die Ideale der Aufklärung interessieren.
1. Biographie
Der Schriftsteller, Dramatiker und Kritiker Gotthold Ephraim Lessing wurde am 22.1.1729 als 3 von 11 Kindern in Kamenz in der Oberlausitz (Dresden) geboren. Er war Sohn der Pfarrerstochter Justina Salome Lessing und des Pfarrers Johann Gottfried Lessing. Von 1737-1741 besuchte er die Lateinschule in Kamenz und von 1741-1746 die Fürstenschule St. Afra in Meißen. Danach studierte er Medizin, Philosophie und Theologie in Leibzig. Schon während dieser Zeit wurde er durch Lustspiele im Stile der Aufklärung wie „der junge Gelehrte“(1748), „die Juden“ und „der Freigeist“ bekannt, die von einer Theatergruppe erfolgreich aufgeführt wurden. Zahlreiche Gedichte, Fabeln, Erzählungen, philosophische und theologische Schriften sollten noch folgen. Nachdem er zwischenzeitlich in Wittenberg die Magisterwürde erhalten hatte, betätigte er sich in Berlin, wo er zwischen 1748 und 1755 vorwiegend lebte, als erfolgreicher und angesehener Theater- und Literaturkritiker. Unter anderem schloß er dort mit Moses Mendelssohn, Friedrich Nicolai und Johann Wilhelm Gleim Freundschaften und pflegte mit diesen fortan regen Briefkontakt. Mit seinem Trauerspiel „Miss Sara Sampson“, das Lessing im Frühjahr des Jahres 1755 schrieb, gelang ihm der Durchbruch als Theaterautor. Am 10.05.1756 tritt Lessing zu einer Bildungsreise an, muss diese aber aufgrund des Siebenjährigen Krieges abbrechen und gelangte er wieder nach Leipzig, wo er Ewald von Kleist kennenlernte. Nachdem dieser aber in den Krieg einbezogen wurde, verschlug es Lessing 1758 wieder nach Berlin. 1759 wurde sein Buch „Fabeln“ und das Trauerspiel „Philotas“ veröffentlicht. Zeitgleich gab er mit seinen Freunden, dem Philosophen Mendelssohn und dem Kritiker Friedrich Nicolai, die literaturkritische Zeitschrift „Briefe, die neuste Literatur betreffend“ heraus. Da er oft finanzielle Probleme hatte, arbeitete er von 1760-1765 als Sekretär des Kommandanten von Breslau. In dieser Zeit begann er auch das 1766 vollendete Lustspiel „Minna von Barnhelm“. Ebenfalls schrieb Lessing während dieser Zeit „Laokoon: Oder die Grenzen der Malerei und Poesie“. 1765 zog er nach Berlin zurück und 1767 wirkte Lessing als Kritiker und Dramaturg an dem neu gegründeten Nationaltheater in Hamburg. Dennoch scheiterte das „Vorhaben: Nationaltheater in Hamburg“ an finanziellen und materiellen Nöten. Daraufhin nahm er im April 1770 eine Stelle als Bibliothekar in Wolfenbüttel an. Ein Jahr später ließ sich Lessing mit Eva König, die Witwe eines Freundes, verloben, die er 1776 auch heiratete. Seine Frau gebar 1777 einen Sohn namens Traugott, welcher aber schon an seinem ersten Lebtag starb. 1772 ist das in fünf Akten eingeteilte bürgerliche Trauerspiel „Emilia Galotti“ von Lessing fertiggestellt worden. Die Handlung wurde von ihm mit Absicht nach Italien verlegt, weil er in Deutschland die Zensur fürchtete. Die letzten Jahre seines Lebens, die Lessing in Wolfenbüttel verbrachte, waren geprägt durch den theologischen Streit mit Goeze, einem Hamburger Hauptpastor, nachdem Lessing in seinen Schriften „Zur Geschichte und Literatur“ Teile einer rein auf Verstand begründeten Bibelkritik veröffentlich hatte. Durch eine Zensur zur Fortführung des Streites entstand Lessings wohl bekanntestes Werk „Nathan der Weise“ von 1779. Am 15. Februar 1781 starb Gotthold Ephraim Lessing in Braunschweig.
2. Werke
Schon während seiner Studienzeit schrieb Lessing einige Lustspiele. Diesen folgten noch Gedichte, Fabeln, Erzählungen und einige philosophische und theologische Schriften.
- Einige Stücke sind:
- Der junge Gelehrte: Ein Lustspiel aus dem Jahre 1748
- Der Freigeist: Ebenfalls ein Lustspiel. Aus dem Jahre 1749
- Die Juden(1749)
- Samuel Henze(1749)
- Die Theatralische Bibliothek(1754)
- Schriften(1753-55)
- Briefe (1753)
- Rettungen(1754)
- Miss Sara Sampson(1755)
- Vademekum(1754)
- Literaturbriefe(1759)
- Abhandlungen über die Fabel(1759)
- Philotas:Trauerspiel aus dem Jahre 1759
- Laokoon(1766)
- Briefe antiquarischen Inhalts(1768-69)
- Wie die Alten den Tod gebildet(1769)
- Minna von Barnhelm(1767)
- Hamburgische Dramaturgie(1767-68)
- Emilia Galotti(1772)
- Über den Beweis des Geistes und der Kraft(1778)
- Eine Dublik(1778)
- Eine Parabel(1778)
- Anti Goeze(1778)
- Nathan der Weise(1779)
- Ernst und Falk(1778)
- Die Erziehung des Menschengeschlechts
Die Juden: Lustspiel
Ein Reisender bewahrt einen Gutsbesitzer, einen Baron, vor einem Raubüberfall. Daraufhin wird er von diesem als Gast aufgenommen. Die beiden Räuber, Bedienstete des Barons können entkommen und versuchen den Verdacht auf die in der Nähe des Guts lagernden Juden zu lenken. Martin Krumm(einer der Räuber), entwendet dem Reisenden eine Silberdose während eines Gesprächs.
Die Tochter des Gutbesitzers hat inzwischen lebhaftes Interesse an dem Fremden gefunden und so wird eine Zofe vom Baron beauftragt näheres über den unbekannten Reisenden herauszufinden. Diese hat wiederum von Martin Krumm die silberne Dose als Geschenk erhalten und würde sie Christoph, dem Bedienten des Gastes geben, wenn er eine falsche Aussage machen würde. Als der Reisende seinen Verlust bemerkt, beschuldigt er Martin Krumm. Dieser lässt sich durchsuchen, weil er sie ja nicht mehr bei sich hat. Dennoch findet man bei ihm zwei falsche Judenbärte. Als der Reisende seine Dose bei Christoph wiederfindet, können beide Übeltäter durch Zurückverfolgung des Tauschweges überführt werden. Der Baron bietet dem Fremden dankbar sein Vermögen und seine Tochter an, doch der lehnt dankend ab als er das Geheimnis um seine Person lüftet: Er ist Jude!
Briefe:
Hier brachte er seine Kritik an der französischen Klassik und deren Dramen zum Ausdruck und wies auf die Bedeutung Shakespeares auf das deutsche Drama hin.
Miss Sara Sampson:
Dieses Stück gilt als das erste Trauerspiel in Deutschland. Es ist Lessings einziges empfindsames Trauerspiel, alle anderen Versuche kamen über den ersten Akt nicht hinaus. „Miss Sara Sampson war sehr erfolgreich und fand viele Nachahmer, die aber weit nicht so bedeutend sind.
Laokoon: Ästhetische Schrift
Darin schreibt er über den Unterschied zwischen Poesie und bildender Kunst. Diese kritische Untersuchung verwickelte ihn jedoch in eine Auseinandersetzung vor allem mit dem Altphilologen Klotz, aus der „Die Briefe antiquarischen Inhalts“ hervorgingen.
Minna von Barnhelm: Lustspiel
Gilt bis heute als klassisches deutsches Lustspiel.
Hamburgische Dramaturgie: ästhetische Schrift
Er schrieb dazu in Hamburg 104 Stücke, mit denen er das deutsche Theater von der Vorherrschaft des französischen Dramas und seiner starren Regeln befreite.
Emilia Galotti: Trauerspiel
Das Stück spielt im absolutistischen Italien. Es ist ein Theaterstück in Dialogform geschrieben, es ist 5 Aufzüge gegliedert. Das Drama beginnt bei Sonnenaufgang und endet am Abend des selben Tages: Ein Maler bringt einem Prinzen ein Porträt der Gräfin Orsina, seiner ehemaligen Geliebten und eines von Emilia Galotti, dem neuen Objekt seiner Begierde. Als der Prinz erfährt, dass Emilia am selben Tag noch den Grafen Appiani heiraten solle, ist er entsetzt und übergibt seinem Kammerherren Marinelli alle Vollmachten, um die Heirat zu verhindern. Der Prinz stellt Emilia nach und gesteht ihr seine ,,Liebe". Daraufhin flieht das Mädchen in das Haus ihrer Eltern. Auch seine Versuche, den Verlobten loszuwerden scheitern und so heuert er Halunken an, die die Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg zu ihrem Landsitz überfallen sollen. Emilias Verlobter wird ermordet. Sie selbst wird auf das Lustschloss des Prinzen gebracht. Nachdem Odorado Galotti, Emilias Vater, von dem Überfall erfährt, begibt er sich auf das Schloss, wo er Gräfin Orsina antrifft, die ihm vom Tode Appianis und von der Verwicklung des Prinzen in das Verbrechen berichtet. Sie gibt ihm einen Dolch, damit er sich rächen kann. Er will den Prinzen überzeugen, Emilia mit ihm gehen zu lassen, um sie in ein Kloster bringen zu können, der Prinz lässt dies jedoch nicht zu. Als der Vater Emilia zum Abschied noch einmal spricht, bittet sie den Vater, nachdem sie um den Tod ihres Verlobten weiß, sie zu töten. Nach langem Zögern sticht der Vater ihr den Dolch ins Herz.
Dieses Stück lässt stark die aufklärerische Haltung und deren Motive erkennen. So wird der Prinz- die Verkörperung des abgelehnten absolutistischen Herrschers- in diesem Stück als sehr wankelmütig dargestellt. Lessing schrieb das Stück in einer einfachen und- im Stile der Aufklärung- schnörkellosen Form, was wohl die große Beliebtheit damals begründet, da es auf diese Weise auch den weniger gebildeten Menschen verständlich war.
Das Stück war auch für die einfachen Leute interessant, da Lessing ja über ihren Stand schrieb, der durch die Galottis- hauptsächlich jedoch durch Emilia verkörpert wird, die lieber stirbt, als zu riskieren, ihre Unschuld zu verlieren.
Nathan, der Weise: Dramatisches Gedicht in 5 Aufzügen. Es ist in Dialogform geschrieben und weißt durchgehend einen fünffüßigen Jambus auf. In diesem Stück bringt Lessing die Ideale der Aufklärung - Toleranz, Offenheit, Vernunft, Menschlichkeit- zum Ausdruck. Das Gleichnis der Ringe zeigt sehr anschaulich Lessings Einstellung: die drei großen Religionen streiten sich darum, wer Recht habe und wer der wahre Nachfolger Gottes sei. Darüber vergessen sie komplett den Sinn, den die von Gott bestimmte Nachfolge eigentlich haben sollte. Lessing plädiert für Verständnis und Toleranz unter den Religionen. Er wertet keine als die richtige oder wahre Religion, sondern spricht jeder das gleiche Recht zu, sich Gottes Nachfolge zu nennen.
Der Schluss, an dem alle erkennen, dass sie aus derselben Familie stammen, spricht offensichtlich Lessings Hoffnung aus, dass die drei großen Religionen eines Tages in Frieden miteinander leben.
Die Erziehung des Menschengeschlechts:
Lessing stellte 100 Thesen auf, die die Entwicklung des Menschen beschreiben sollen. Dabei überdeckt er die Bedeutung (und Berechtigung) der Offenbarungsreligion. Er sieht in der Offenbarungsreligion eine Erzieherrolle, die die Entwicklung des Menschen in drei Stufen zur Reife und Vollendung führen soll:
Die Kindheit steht dabei unter der Führung durch das Alte Testament:
- Erkenntnis und Monotheismus durch ein System von Strafe und Belohnung Die Jugend durch das Neue Testament:
- Unsterblichkeitsaussicht führt zu moralischem Handeln
Das Erwachsenenalter unter der Führung eines Zeitalters der Vernunft, der Humanität und der Vollendung:
- Die Offenbarungsreligion wird entbehrlich
3. Nathan der Weise
3.1 Der Fragmentenstreit (Die Entstehung)
Von 1767-1770 lebte Lessing in Hamburg und lernte dort die Familie Reimarus kennen. Der Gymnasiallehrer Samuel Reimarus verteidigte in seiner „Apologie oder Schutzschrift der vernünftigen Verehrer Gottes“ den Deismus gegen orthodoxe Angriffe und stellte die dogmatischen Lehrmeinungen der lutherschen Kirche in Frage. Nach dessen Tod gab seine Schwester das Manuskript an Lessing.
Dieser nahm 1774 eine Stelle als herzoglicher Bibliothekar in Wolfenbüttel an, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten (und des gescheiterten Theaterexperimentes in Hamburg). Er forderte die Freiheit, religionskritische Thesen in der Öffentlichkeit diskutieren zu dürfen. Deshalb schaffte er ein Forum für die Diskussion von herausfordernden religiösen Fragen und plante die Zeitschrift ,,Beiträge zur Geschichte und Literatur“ in der er die Bücher aus der herzoglichen Bibliothek teilweise der Öffentlichkeit zugänglich machen konnte.
1777 veröffentlichte er im vierten Beitrag Teile aus der christentumskritischen Schutzschrift seines Freundes Reimarus unter dem Titel ,,Fragmente eines Unbekannten“. Er tarnte diese als Funde aus der Bibliothek und stellte seine eigene Auffassung in den ,,Gegensätzen des Herausgebers“ dar. Seine Meinung richtete sich vor allem gegen die unantastbaren Wahrheiten der Religion und die Verknüpfung von Theologie und Philosophie, wie es bei der Neologie der Fall war. Die Neologen versuchen biblische Aussagen durch rationalistische Argumente zu verteidigen. Lessing hingegen forderte entweder Theologie oder Philosophie.
Daraufhin publizierte der Hauptpastor Goeze eine Kritik an Lessings Gegensätzen und machte ihn als Herausgeber zur Zielscheibe der Orthodoxen. Als Goeze sich während den Auseinandersetzungen zum Wortführer der Orthodoxie machte nutzte Lessing die Gelegenheit seine Autorität anzugreifen und bloßzustellen. Es entwickelte sich ein großer Streit, in dem Lessing seine Position in den Anti-Goeze Briefen darlegte.
Die Brisanz des Streits, war dass Lessing den Disput in der Öffentlichkeit austrug. Er schrieb seine Pamphlete in Deutsch und nicht in Latein, so dass sie für jedermann verständlich waren. Die Publikation der Fragmente verstieß gegen die akademischen Spielregeln, denn wer früher die Gelehrtenschule und Universität besuchte garantierte sozusagen, dass er nicht aus den Konventionen und Denkschablonen ausbrach.
Obwohl Lessing Goeze stilistisch und argumentativ überlegen war und Goeze nicht mit Lessings brillanter Polemik mithalten konnte, sondern immer an Lessing vorbeiredete (Kanzeldialog), hatte er die Mächtigen auf seiner Seite und seine Argumentation blieb für soziale und politische Entwicklungen bestimmend, während Lessing in der Welt der Gelehrten der ,,Komödienschreiber“ blieb. Als Lessing dann in seiner ,,Duplik“ erklärte, dass er nicht im Besitzt der Wahrheit, sondern auf ihrer Suche sei, und dass es auf diesen Weg nichts gäbe, das man nicht in Frage stellen dürfte (,in den Reimarus-Fragmenten zweifelte er sogar an der Person Jesu selbst) dehnte Goeze den Disput auf die Politik aus und bezeichnete Lessing als Rebell. Für Goeze gab es Gewissheit und unantastbare Wahrheiten. Er stützte sich auf geistige sowie politische Autoritäten, während Lessing alles kritisierte.
Als sich die Auseinandersetzungen schließlich so zuspitzten und der Fragmentenstreit ein Zusammenstoß Lessings mit der geistlichen und weltlichen Obrigkeit wurde, verhängte der Herzog von Braunschweig am 13.7.1778 die Zensur über Lessing. Daraufhin druckte dieser seine Schrift ,,Nötige Antwort auf eine sehr unnötige Frage des Herrn Hauptpastor Goeze“ in Hamburg und Berlin. So wurde am 3.8.1778 das herzogliche Verbot ausgeweitet und untersagte Lessing nun auch eine Publizierung auswärts.
Die Lösung hierzu fand Lessing in der Wiederaufnahmen und Vollendung eines alten Entwurfs. Er schrieb am 6.9.1778 an Elise Reimarus: ,,Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel dem Theater wenigstens, noch ungestört will predigen lassen.“ Lessing wollte seine Gedanken zu Grundfragen menschlichen Glaubens und gesellschaftlichen Zusammenlebens im Theaterstück ,,Nathan der Weise“ veröffentlichen. Im November 1778 begann er seine Arbeit und stellte das Stück im Mai 1779 fertig. Uraufgeführt wurde es am 14.3.1783, zwei Jahre nach Lessings Tod.
3.2 Inhalt
Der weise Jude Nathan, der durch die Verfolgung der Christen seiner eigenen Familie beraubt wurde, adoptiert Recha, die Tochter eines verstorbenen Freundes, welche ihm vom Klosterbruder Bonafides überbracht wurde. Eines Tages kehrt Nathan von einer Geschäftsreise zurück und muss erfahren, dass seine Recha fast bei einem Feuer ums Leben gekommen wäre. Diesem ist sie nur knapp durch die Hilfe eines Tempelherrn entgangen, welcher sich in das schöne Mädchen verliebt und beabsichtigt sie zu heiraten. Nathan jedoch erklärt sich damit nicht einverstanden. In seiner Verzweiflung sieht der Tempelherr seine einzige Chance darin, Nathan anzuklagen, nachdem er in Erfahrung bringen konnte, dass Recha nur seine Adoptivtochter und im Gegensatz zu Nathan Christin ist. Doch der Patriarch, welcher die Anklage entgegen nimmt, beabsichtigt den Juden Nathan zu finden um ihn zum Tode zu verurteilen, da er die Christin Recha nicht in ihrem eigenen Glauben aufgezogen hat. Von seinem schlechten Gewissen geplagt, beschließt der Tempelherr mit dem Sultan zu reden, der sich bereiterklärt das Problem zu lösen und sofort ein Treffen zwischen allen Beteiligten in seinem Palast arrangiert. Vor dem Aufbruch Nathans erhält dieser Besuch von dem Klosterbruder, der vor vielen Jahren Recha zu ihm gebracht hatte. Von diesem erhält Nathan Aufzeichnungen über die Familienverhältnisse Rechas, durch die sich beim Treffen im Palast herausstellt, dass Recha und der Tempelherr Curd Halbgeschwister und Kinder des verstorbenen Bruders von Saladin, dem Sultan sind.
3.3 Wirkung
Als das Stück 1779 publiziert wurde, war es mit einer Auflage von 3000 Exemplaren ein großer Bucherfolg. Das Stück spaltete das Publikum. Obwohl es als Meisterwerk Lessings angekündigt wurde, ließ der Druck, den die Orthodoxie auswirkte die öffentlichen Zustimmungen für das Stück dürftig ausfallen. Die Befürworter lobten nur die poetischen Qualitäten des Stückes, wie zum Beispiel die Charakterzeichnung und die Sprache. Sie betonen aber, dass sie mit diesem Lob nichts über die Religionsfrage aussagen wollen. Wie Mendelssohn richtig erkannte, wurde Lessing von seinen Freunden und Bekannten verlassen und den Nachstellungen seiner Feinde bloßgestellt. Anhänger der Orthodoxie warfen Lessing eine Beschimpfung des Christentums, sowie Gehässigkeit gegen die christliche Religion vor. Lessing habe die christliche Kirche herabgesetzt um das Judentum zu verherrlichen.
Lessing sowie Mendelssohn begründeten die Publikumspaltung damit, dass das Publikum überfordert und noch nicht reif für das Stück sei.
Auch bei der Uraufführung am 14. März 1783 in Berlin fiel das Lob des Stückes spärlich aus. Der Andrang war bei weitem nicht so groß, wie sie es sich erhofft hatten. Erst als Schillers Inszenierung des Stückes 1801 in Weimar aufgeführt wurde konnte man von der ersten erfolgreichen Theateraufführung sprechen.
4. Lessings Einfluss auf die Gesellschaft
Gotthold Ephraim Lessing ist einer der bedeutendsten Autoren deutscher Literaturgeschichte, welcher er Anfang des 18.Jahrhunderts zum Durchbruch verhalf. In vielen Bereichen der literarischen Entwicklung war Lessing Mitgestalter oder hat sie gar entscheidend geprägt. So förderte er durch verstandesmäßige theoretische Arbeit die Entwicklung des Schrifttums.(u.a. die der natürlichen, kolloquialen und individuellen Prosa (Redestil) oder der lehrhaften Dichtung (Fabeln etc.)).
Seine Texte setzten Maßstäbe und trugen wesentlich dazu bei, dass bei der Aristokratie das Interesse an deutscher, statt französischer, Literatur geweckt wurde. Seine kunsttheoretischen Schriften machten ihn zu einem der bedeutendsten Vertreter der Ideale und Aktivitäten der deutschen Aufklärung, die er als unabschließbaren Erziehungs- und Erkenntnisprozess des Menschen verstand. So ging Lessing mit Vernunft, Toleranz, Freiheit und Menschlichkeit gegen kirchliche Bevormundung, Vorurteile und Fürstenwillkür vor. Lessing übte mit seinem dramatischen Werk und seinen kritischen Essays eine große Auswirkung auf nachfolgende deutsche Schriftsteller aus und verlieh der deutschen Literatur ein neues Gepräge.
Hinzu wird Lessing als literarischer Wegbereiter der Emanzipation des Bürgertums verstanden, denn er befreite die deutsche Dichtung aus ihrer Abhängigkeit französischer Einflüsse, rechtfertigte Shakespeares bis dahin weitgehend unverstandene Werke vor dem künstlerischen Gewissen seiner Zeit und verteidigte griechische Tragiker. Dadurch wurde er zum Wegbereiter der Klassik. Durch seine Theorien über Drama, Poesie, die bildende Kunstmalerei und Schauspielkunst beeinflusste er die Kunstauffassung und -ausübung der Klassik in hohem Maße.
5. Worterklärungen
Apologie: (besonders in religiösen Auseinandersetzungen) Verteidigungs-, Rechtfertigungsrede
Deismus: Religionsphilosophische Anschauung, die aus Vernunftgründen einen Weltschöpfer anerkennt, aber den Glauben an sein weiteres Einwirken auf das Weltgeschehen ablehnt
Orthodoxe, Orthodoxie: Rechtgläubigkeit, Strenggläubigkeit
Dogmatisch, Dogma: festgelegte Meinung, die nicht angezweifelt wird (werden darf)
Lutherschen: Luther und seine Lehre betreffend
Fragment: Unvollendetes literarisches oder musikalisches Werk
Theologie: Wissenschaft von Gott, Glaube, Religion und dem Wesen der Kirche
Neologie: versucht biblische Aussagen mit rationalistischen Argumenten zu verteidigen
Pamphlete: Streitschriften
Publikation: Veröffentlichung, im Druck erschienene Schrift
Polemik: Wissenschaftlicher, meist publizistischer, ausgetragener Streit
Kanzel: erhöht gelegenes Rednerpult für den Pfarrer, Priester in der Kirche Inszenierung: die technische und künstlerische Vorbereitung, Gestaltung und Leitung einer Theateraufführung
kolloquial: für die Redeweise im Gespräch charakteristisch (auch: Sprachweise)
Prosa: geradeaus gerichtete, schlichte Rede in ungebundener Form
Aristokratie: adelige Oberschicht mit besonderen Privilegien
Emanzipation: Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung
Klassik: Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche
Satire: ironisch-witzige literarische oder künstlerische Darstellung menschlicher Schwächen und Laster
Ästhetik: Wissenschaft vom Schönen; Lehre von der Gesetzmäßigkeit und Harmonie in Natur und Kunst
Lustspiel: Komödie
Trauerspiel: Ein ernstes Theaterstück mit tragischem Ausgang = Tragödie Altphilologe: Einer der die Sprache und Literatur der klassischen Antike studiert
6. Literaturliste
- ,,Lessing Handbuch: Leben-Werk-Wirkung“
Monika Fick
Verlag J.B.Metzler Stuttgart Weimar 2000
- ,,Deutsche Dichter Band 3: Aufklärung und Empfindsamkeit“
Gunter E. Grimm und Frank Rainer Max
Philipp Reclam jun. Stuttgart
- ,,Lessing Kommentar Band 1: zu den Dichtungen und ästhetischen Schriften“
Otto Mann und Rotraut Straube-Mann
Winkler-Verlag München
1971
- ,,Gotthold Ephraim Lessing: Poesie im bürgerlichen Zeitalter“
Manfred Durzak
Ernst Klett Verlag
1. Auflage 1984
- ,,Lessing: Epoche-Werk-Wirkung“
Wilfried Barner, Gunter Grimm, Helmut Kiesel, Martin Kramer
Verlag C.H. Beck München
4. Auflage 1981
- ,,Literatur Geschichte“
Lechner Verlag
1995
- ,,Das Dudenbuch der Allgemeinbildung“
Encarta Enzyklopädie von 1998
Encarta Enzyklopädie von 1999
- Die Internetsuchmaschienen:
www.yahoo.de
www.fireball.de
www.lycos.de
- Die Internetseite:
Häufig gestellte Fragen
Wer war Gotthold Ephraim Lessing?
Gotthold Ephraim Lessing war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Kritiker der Aufklärung. Er wurde am 22. Januar 1729 in Kamenz geboren und starb am 15. Februar 1781 in Braunschweig.
Was sind einige von Lessings bekanntesten Werken?
Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Minna von Barnhelm", "Emilia Galotti", "Nathan der Weise" und "Laokoon: Oder die Grenzen der Malerei und Poesie". Er schrieb auch "Der junge Gelehrte", "Die Juden", "Miss Sara Sampson" und viele andere.
Worum geht es in "Nathan der Weise"?
"Nathan der Weise" ist ein dramatisches Gedicht, das die Ideale der Aufklärung wie Toleranz, Vernunft und Menschlichkeit thematisiert. Es behandelt den Fragmentenstreit und die Frage nach der wahren Religion anhand des Gleichnisses von den drei Ringen.
Was war der Fragmentenstreit?
Der Fragmentenstreit war eine theologische Auseinandersetzung, die durch Lessings Veröffentlichung von Fragmenten aus der Schrift von Reimarus ausgelöst wurde. Dabei ging es um Religionskritik und die Infragestellung dogmatischer Lehrmeinungen.
Welche Bedeutung hatte Lessing für die deutsche Literatur?
Lessing gilt als einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Literaturgeschichte. Er förderte die Entwicklung des Schrifttums, setzte Maßstäbe für die deutsche Literatur und befreite sie von französischen Einflüssen. Er gilt außerdem als Wegbereiter der Emanzipation des Bürgertums.
Was sind einige wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Lessing und seiner Zeit?
Wichtige Begriffe sind Apologie, Deismus, Orthodoxie, Dogma, Neologie, Pamphlete, Polemik, Kanzeldialog, kolloquial, Prosa, Aristokratie, Emanzipation, Klassik, Satire und Ästhetik.
Was ist die Handlung von Emilia Galotti?
Emilia Galotti handelt von einem Prinzen, der besessen von Emilia ist und versucht ihre Hochzeit mit Graf Appiani zu verhindern. Der Prinz heuert Halunken an und Appiani wird ermordet. Emilia wird auf das Lustschloss des Prinzen gebracht. Um ihre Unschuld zu bewahren, bittet Emilia ihren Vater sie zu töten, was dieser schließlich tut.
Was ist die Aussage in Die Erziehung des Menschengeschlechts?
Lessing stellt in "Die Erziehung des Menschengeschlechts" 100 Thesen über die Entwicklung des Menschen auf. Er sieht die Offenbarungsreligion als Erzieherrolle, die den Menschen zur Reife führt. Dabei werden drei Stufen durchlaufen, die vom Alten Testament, Neuen Testament, bis hin zum Zeitalter der Vernunft unterteilt werden.
Was ist die Handlung von Die Juden?
"Die Juden" ist ein Lustspiel in dem ein Reisender einen Gutsbesitzer vor einem Raubüberfall bewahrt und als Gast aufgenommen wird. Räuber versuchen den Verdacht auf Juden zu lenken, die in der Nähe lagern. Am Ende stellt sich der Reisende selbst als Jude heraus.
Was ist die Handlung von Miss Sara Sampson?
Dieses Stück gilt als das erste Trauerspiel in Deutschland und somit Lessings einziges empfindsames Trauerspiel.
- Quote paper
- Michèle Denü (Author), 2002, Lessing, G.E. - Nathan der Weise (Schwerpunkt: Fragmentenstreik), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106268