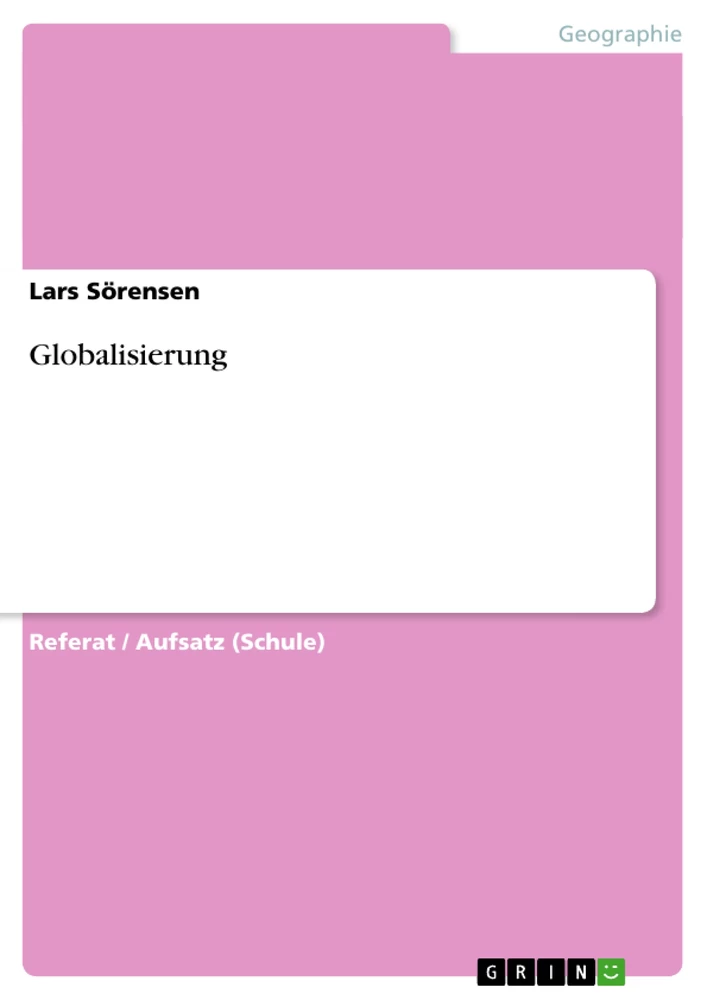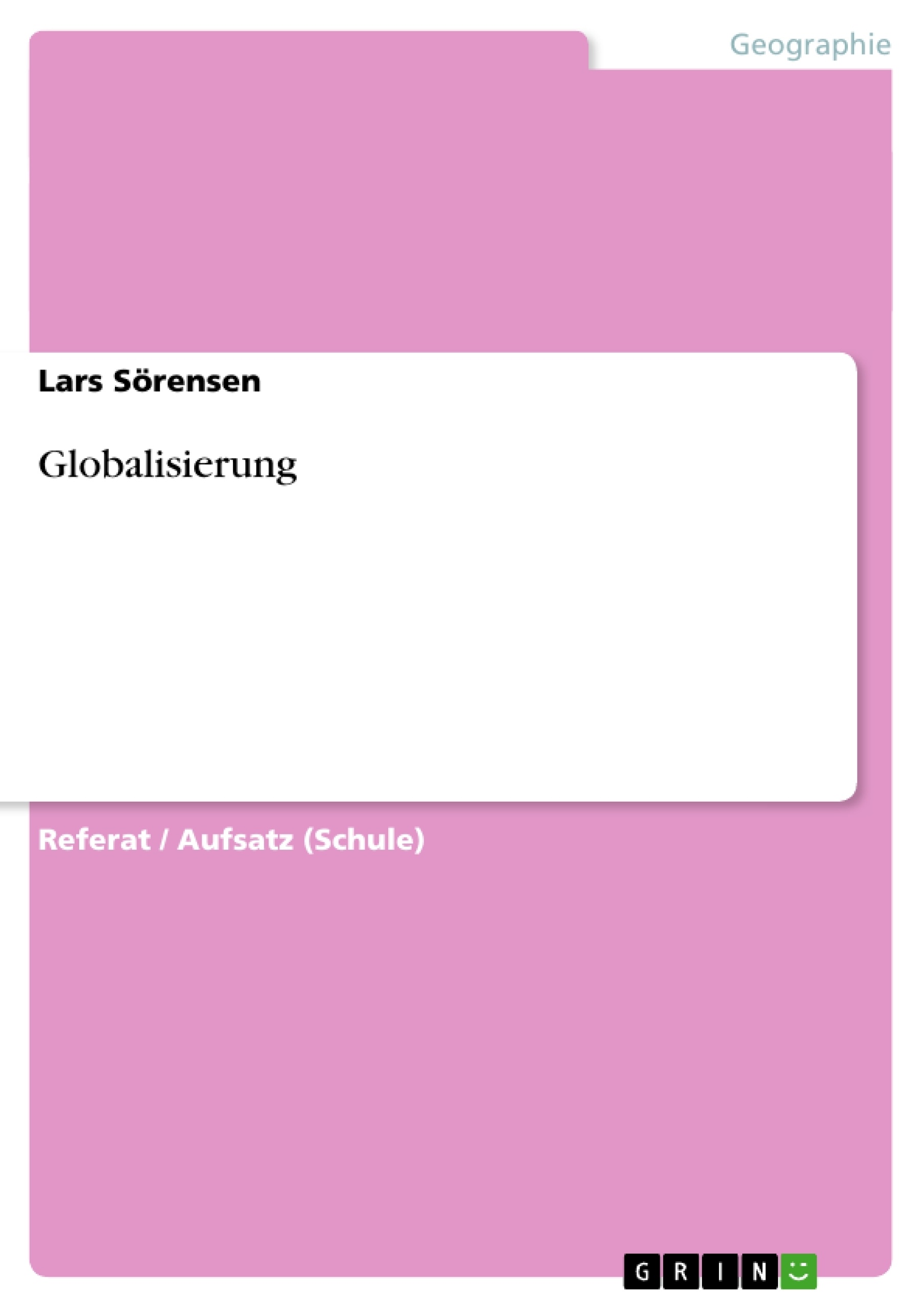Was treibt die Weltwirtschaft an, und wohin steuert sie? Tauchen Sie ein in die komplexen Mechanismen der ökonomischen Globalisierung, einer treibenden Kraft, die unsere Welt in ihren Grundfesten verändert. Diese aufschlussreiche Analyse beleuchtet die Grundlagen der Globalisierung, von der zunehmenden Flexibilität der Unternehmen bis hin zu den unaufhaltsamen Treibkräften, die diesen globalen Wandel befeuern. Erfahren Sie, wie die Internationalisierung der Wirtschaft, die weltweite Produktion und der unerbittliche Wettbewerb die Spielregeln neu definieren. Doch welche Folgen hat dieser Prozess für Nationalstaaten, die zunehmend unter den Einfluss transnationaler Konzerne geraten? Am Beispiel der Automobilindustrie, insbesondere anhand von Volvo und VW, wird die Vielschichtigkeit der Globalisierung greifbar. Während Volvo im globalen Wettbewerb zu kämpfen hat, demonstriert VW, wie man durch strategische Expansion und Anpassung an neue Märkte erfolgreich sein kann. Entdecken Sie die Herausforderungen und Chancen, die sich für Unternehmen und Staaten gleichermaßen ergeben. Ist die Globalisierung eine Bedrohung für etablierte Industrien und Arbeitsplätze, oder bietet sie die Chance auf Wachstum und Innovation? Diese Untersuchung bietet fundierte Einblicke und regt zur kritischen Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Globalisierung auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft an. Ein Muss für alle, die die globalen Zusammenhänge verstehen und die Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Lassen Sie sich fesseln von einer Reise durch die Welt der globalen Märkte, Kapitalströme und strategischen Entscheidungen, die unser Leben täglich beeinflussen. Werden Sie Zeuge, wie Unternehmen sich neu erfinden, Staaten ihre Rolle überdenken und die Weltwirtschaft in einem ständigen Wandel begriffen ist. Dieses Buch ist Ihr Schlüssel zum Verständnis der Globalisierung – ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die in einer globalisierten Welt erfolgreich sein wollen.
Gliederung
Vorwort
Begriffsklärung
1. Ökonomische Globalisierung
1.1. Grundlagen der Globalisierung
1.2. Flexibilität der Unternehmen
1.3. Treibkräfte für die Globalisierung
1.4. Folgen der Globalisierung für den Staat
2. Globalisierung am Beispiel Automobil
2.1. Autohersteller Volvo aus Schweden
2.2. Großkonzern VW aus Deutschland
3. Fazit
4. Quellen
Vorwort
Globalisierung ist ein Schlagwort, das nicht nur in aller Munde ist, sondern in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, da Globalisierung die Weltwirtschaft und die Weltpolitik dominiert. Es ist meiner Meinung nach deshalb unumgänglich über die Gründe, die Funktionsweisen sowie die Folgen der Globalisierung bescheid zu wissen. Im folgenden Text möchte ich daher über einige Aspekte Aufschluss geben, zur Meinungsbildung beitragen und der Frage nachgehen, ob der florierende Weltmarkt eine Bedrohung oder eine Chance für die Menschheit ist.
Begriffsklärung
Der Begriff Globalisierung wird in verschiedenen Bereichen, zu denen Ökonomie, Ökologie, Soziologie, Kultur und Ethik gehören, verwendet. Er bezeichnet die transnationale Vernetzung der Systeme, Gesellschaften und Märkte. Um Missverständnisse aufgrund dieser Mehrdeutigkeit zu vermeiden, sei vorweg gesagt, dass ich mich in meiner Ausarbeitung ausschließlich auf ökonomische Aspekte beschränken werde.
1. Ökonomische Globalisierung
1.1. Grundlagen der Globalisierung
Kernbestandteil der Globalisierung ist die Internationalisierung der Wirtschaft. Im Allgemeinen bezeichnet Internationalisierung die wirtschaftliche Verflechtung und die sich daraus ergebenden Interdependenzen verschiedener Länder in unterschiedlichen Bereichen und Ausmaßen. Die momentane Entwicklung hat die Tendenz, zu einer noch stärkeren weltweiten Integration von Märkten zu führen. Das heißt vereinfacht:
- weltweite Produktion
- weltweite Konkurrenz
- weltweiter Handel
Mit ausschlaggebend für diesen Trend ist eine noch nie da gewesene Mobilität des Kapitals. Es ist jedoch nicht nur die Internationalisierung der Kapitalströme, sondern vielmehr die Internationalisierung der Produktionsstätten, die das Geschehen auf dem entstandenen Weltmarkt nachhaltig bestimmt. Den Unternehmen kommt zugute, dass die Orte ihrer Produktionsstätten nie eine geringere Rolle gespielt haben als heutzutage.
1.2. Flexibilität der Unternehmen
Die Transportkosten von Gütern werden zunehmend geringer und mit ihnen sinkt ihre Bedeutung bei der Entscheidung für die Produktionsstandorte. Außerdem sind die Kosten für moderne, schnelle Informations- und Kommunikationstechnologien auf ein Minimum zurückgegangen, was die genaue Überwachung von Produktionsprozessen an jedem Ort der Welt zulässt.
Wir wissen nun, dass eine fortschreitende Globalisierung Unternehmen die Möglichkeit gibt, Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verfrachten. Was jetzt bleibt ist die Frage, warum der erheblich größere Teil der Firmen von dieser Möglichkeit gebrauch macht, obwohl sie sich über die negativen Auswirkungen für ihre Herkunftsländer bewusst sind.
1.3. Treibkräfte für die Globalisierung
Antrieb der Globalisierung ist der ,,Kapitalismus ohne Grenzen". Ein Markt wird wie das Wort schon sagt von Angebot und Nachfrage bestimmt. Das gleiche Prinzip gilt auf dem Weltmarkt. Seit dem Zusammenbruch der Planwirtschaft in den Ostblockländern ist die Anzahl der Anbieter und Abnehmer, die sich auf dem Welthandelsmarkt tummeln, gleichermaßen gestiegen. Außerdem haben ökonomische Erfolge und Anpassungsprozesse des asiatischen Kontinentes zu mehr Teilnehmern an der Weltwirtschaft geführt. Auch Entwicklungsländer haben sich für ausländische Investoren geöffnet und damit Joint Ventures ermöglicht.
Die Attraktivität der Ostblockländer, des asiatischen Kont inentes und der Entwicklungsländer für profitorientierte Unternehmen liegt auf der Hand. Neben kostengünstigen Arbeitsstätten, billigen und willigen Arbeitskräften und niedrigen Steuern herrscht in diesen Staaten eine verhältnismäßig geringe Bürokratie. Diese Chance neue Märkte zu errichten haben die transnationalen Wirtschaftsimperien genutzt, so dass sie heute rund ein Drittel der globalen Industrieproduktion direkt kontrollieren. Indirekt ist ihr Einfluss vermutlich doppelt so hoch. Das führt dazu, dass die westlichen Staaten mit schweren Folgen zu kämpfen haben.
1.4. Folgen der Globalisierung für den Staat
Die nahezu alleinige Kontrolle des Weltmarktes durch riesige transnationale Konzerne, hat die Entmachtung des Staates zur Folge. Profitorientierte Unternehmen wählen die für sie wirtschaftlichsten Produktionsstandorte unabhängig von ihrem Herkunftsland und unabhängig von der Bevölkerung. Der Staat schlüpft in die Rolle des Bittstellers, denn ein Nichtgerechtwerden der Forderungen (z.B. niedrige Lohnnebenkosten, Steuerbegünstigungen, Ausbau der Infrastruktur) kann zum Abwandern eines Unternehmens führen. Arbeitslosigkeit und fehlende Steuergelder in der betroffenen Region wären unabwendbar. Die Regierungen sind also überspitzt formuliert erpressbar, da sie beim Ringen um die Zusage eines Betriebes durch die Konkurrenz der Niedriglohnländer stark in Zugzwang geraten.
2. Globalisierung am Beispiel Automobil
Das Streben nach Profit durch billige Arbeitskräfte und Massenproduktion, nach der Erschließung neuer Märkte und Ausweitung der Handelsbeziehungen sowie den Kampf ums Überleben auf dem Weltmarkt kann man in nahezu allen Branchen der Wirtschaft beobachten. Nachdem ich die Grundstrukturen erklärt habe, möchte ich die Globalisierung nun anhand einer Branche darstellen. Nach reichlicher Überlegung habe ich mich für die Automobilbranche entschieden, da über die Verflechtungen verschiedener Länder und Hersteller oftmals in den Medien berichtet wird und sie deshalb meiner Ansicht nach außerordentlich interessant ist. Außerdem wirkt das Automobil besonders anschaulich auf mich, da heutzutage fast jeder erwachsene Europäer selber Auto fährt.
2.1. Autohersteller Volvo aus Schweden
Obwohl die Nachfrage an den weltweit angesehenen Qualitätsautos von Volvo ungetrübt ist, fällt der schwedische Automobilkonzern aller Voraussicht nach dem Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt zum Opfer.
Um Kosten einzusparen haben die Schweden seit einigen Jahren bestimmte Teile ihrer Produktion nach Osteuropa und nach Belgien verlagert. Dort sind die Löhne und die Lohnnebenkosten im Vergleich zu Schweden geringer. Aus Angst vor einem Imageverlust werden die verschiedenen Elemente der Automobile jedoch in Schweden zusammengefügt. So dürfen sie auch weiterhin das Prädikat ,,Made in Sweden" tragen. Trotz dieser Sparmaßnahme reicht der Umsatz für Volvo nicht aus, um alleine auf dem Automobilmarkt zu überstehen. Eine Lösung für dieses Problem schien die beantragte Fusionierung mit dem schwedischen Lastwagenproduzenten Scania zu bieten. Die EU Kommission lehnte den Antrag jedoch ab, da die beiden Lastwagenhersteller sonst einen Marktanteil von 90% an der schwedischen LKW-Produktion inne gehabt hätten. Bei der Entscheidung blieb die Tatsache unberücksichtigt, dass Schweden ein kleines Land ist und somit der Marktanteil im eigenen Land hoch sein mag, jedoch der Anteil am europäischen Markt winzig ist. Aus den gleichen Gründen ist eine Fusion mit dem zweiten schwedischen Automobilkonzern Saab nicht möglich, wobei Saab selbst schon zu 50% an General Motors verkauft ist. Zurzeit bekommt Volvo nach eigenen Angaben täglich zehn Fusionsvorschläge von Investmentbankern. Alles läuft darauf hinaus, dass Volvo entweder der Macht von General Motors oder dem VW-Konzern zum Opfer fallen wird. An dem Beispiel der Schweden wird deutlich, dass in der Automobilbranche der Kampf ums Dasein zunehmend härter wird und nur eine globale Unternehmenspolitik zum Überleben beiträgt.
Es gibt aber auch Fälle in denen Automobilhersteller Nutzen aus der länderübergreifenden Zusammenarbeit ziehen können. Beispielsweise kommen positive Meldungen im Zusammenhang mit Globalisierung aus Wolfsburg.
2.2. Großkonzern VW aus Deutschland
Das heutige Automobilimperium Volkswagen hat schon frühzeitig erkannt, dass der Markt durch sehr wenige Teilnehmer mit sehr vielen Anteilen bestimmt werden wird. Dies sind gestandene Größen im Automobilgeschäft, die durch kluge Fusionen und Aufkäufe immer mehr Dominanz erlangt haben. Zu diesen ,,global playern" in der Automobilbranche gehört neben Daimler-Chrysler und General Motors eben auch Volkswagen. Das Wolfsburger Unternehmen hat bisher unter anderem Audi, Seat, Skoda, die Supersportler Lamborghini und Bugatti und die Edelmarke Rolls-Royce aufgekauft.
Beim Blick auf den VW-Konzern wird aber nicht nur deutlich, dass die Regeln auf dem Weltmarkt härter geworden sind und die großen Unternehmen sich durch Aufkäufe noch mehr vergrößern, sondern man erkennt, wie wichtig eine international ausgerichtete Unternehmensführung ist. Volkswagen vertraut nicht auf die Stabilität des westeuropäischen Marktes allein, sondern erschließt neue Märkte in den USA und in Osteuropa. Anfangs verlagerten die Wolfsburger Teile ihrer Produktion nach Mexiko und Brasilien um Lohnkosten einzusparen. Nun produzieren die mexikanischen Standorte zusätzlich zu den Fahrzeugen und Teilen für den europäischen Markt noch eigens für den amerikanischen Markt designte Fahrzeuge. Volkswagen ging bei der Entwicklung dieser Automobile flexibel auf die Vorlieben und Bedürfnisse der amerikanischen Käuferschaft ein.
Die Chance auf einen neuen Absatzmarkt haben die Macher der VW-Automobile auch in Osteuropa und Asien gesehen. Seit einigen Jahren setzt der VW-Konzern verstärkt auf Plakat- und Fernsehwerbung in Polen und Russland mit der Folge, dass dort ein Image vom VW als Traumwagen entstanden ist. Auch wenn die potentielle Käuferschaft noch gering ist, hat Volkswagen damit einen Spatenstich für die Zukunft gesetzt.
Neben dieser Flexibilität bei der Erschließung neuer Absatzmärkte ist ein weiteres Aushängeschild von Volkswagen der Zusammenbau der Fahrzeuge. Einzelteile und vorgefertigte Elemente erreichen die jeweiligen Produktionsstätten, in denen sie zusammengefügt werden, immer ,,just in time". Das heißt Autoteile werden ohne Zwischenlagerung aus verschiedensten Teilen der Erde ins Werk gebracht und direkt verarbeitet. Das spart Lagerhallen und damit auch Arbeitskräfte, erfordert jedoch ein hohes Maß an logistischer Perfektion.
Ich hoffe an den genannten Beispielen ist ersichtlich geworden, wie sich Globalisierung auf die Automobilindustrie auswirkt. Zum einen haben wir die weltweite Konkurrenz im Falle von Volvo, die das Unternehmen untergehen lässt, zum anderen lauern die ,,global player" wie Volkswagen, die sich durch Aufkäufe noch weiter entwickeln können.
3. Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Globalisierung Vorteile und Nachteile gleichermaßen mit sich bringt. Sie ist das Resultat eines weltweiten Strukturwandels, der wiederum durch eine technische Revolution und die Integration Osteuropas und Asiens beschleunigt wurde. Durch die Globalisierung wurden die Karten gewissermaßen neu gemischt. Traditionelle Branchen verlieren ihre Bedeutung und Arbeitsplätze, dafür bekommen Niedriglohnländer und Schwellenländer eine zweite Chance.
Diese Vor- und Nachteile sind auch an den genannten Beispielen festzumachen. Unternehmen bleiben auf der Strecke, dafür schaffen einige ihre Leistungen und Fähigkeiten auszubauen und zu steigern. Auch wenn man denken mag, dass die Schere zwischen arm und reich, zwischen stark und schwach immer größer wird, kann man die Globalisierung nicht verurteilen, da sie ein Trend dieser Zeit ist.
Ich finde man sollte Globalisierung als Chance sehen. Die Politik und die Wirtschaft sollten aber das Ziel verfolgen, dass Globalisierung auch eine Chance ist.
4. Quellen
- div. Lexika
- Encarta Enzyklopädie
- Unterrichtsmaterialien Erdkunde und WiPo
- Informationen zur politischen Bildung Heft 263
- Zeitungsartikel
- www.spiegel.de
- www.faz.de
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments zur Globalisierung?
Dieses Dokument konzentriert sich auf die ökonomischen Aspekte der Globalisierung. Es beleuchtet die Grundlagen, Triebkräfte und Folgen der Globalisierung, insbesondere für den Staat.
Was versteht das Dokument unter ökonomischer Globalisierung?
Ökonomische Globalisierung wird hier als die Internationalisierung der Wirtschaft verstanden, die zu einer stärkeren weltweiten Integration von Märkten führt, gekennzeichnet durch weltweite Produktion, Konkurrenz und Handel. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Mobilität des Kapitals und die Internationalisierung der Produktionsstätten.
Welche Faktoren treiben die Globalisierung voran?
Der Hauptantrieb wird als "Kapitalismus ohne Grenzen" beschrieben. Der Zusammenbruch der Planwirtschaft in den Ostblockländern sowie die ökonomischen Erfolge und Anpassungsprozesse in Asien haben zu einer Zunahme von Anbietern und Abnehmern auf dem Weltmarkt geführt. Entwicklungsländer haben sich ebenfalls für ausländische Investoren geöffnet.
Welche Folgen hat die Globalisierung für den Staat?
Die Kontrolle des Weltmarktes durch transnationale Konzerne führt zur Entmachtung des Staates. Unternehmen wählen die für sie wirtschaftlichsten Produktionsstandorte, was Staaten erpressbar macht, da sie um die Zusage von Betrieben konkurrieren müssen und Arbeitslosigkeit sowie fehlende Steuergelder drohen, sollten sie die Forderungen der Unternehmen nicht erfüllen.
Welches Beispiel wird verwendet, um die Globalisierung zu veranschaulichen?
Die Automobilbranche dient als Beispiel, um die Auswirkungen der Globalisierung zu verdeutlichen. Es werden die Situation von Volvo aus Schweden und des VW-Konzerns aus Deutschland betrachtet.
Wie wirkt sich die Globalisierung auf Volvo aus?
Trotz der hohen Nachfrage nach Volvo-Fahrzeugen wird der Konzern durch den Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt gefährdet. Kostenreduzierungen durch Verlagerung von Produktionsanteilen nach Osteuropa und Belgien reichen nicht aus, um langfristig zu überleben. Eine Fusion scheiterte, und es besteht die Gefahr der Übernahme durch andere Konzerne.
Wie profitiert der VW-Konzern von der Globalisierung?
VW hat frühzeitig erkannt, dass der Markt von wenigen, dominanten Teilnehmern bestimmt wird. Durch Fusionen und Aufkäufe (z.B. Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti) konnte VW seine Position stärken. Zudem erschließt VW neue Märkte in den USA und Osteuropa und passt seine Produkte flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse an. Das "Just-in-time"-Prinzip beim Zusammenbau spart Kosten.
Welches Fazit zieht das Dokument zur Globalisierung?
Die Globalisierung bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich und ist das Ergebnis eines weltweiten Strukturwandels. Traditionelle Branchen verlieren an Bedeutung, während Niedriglohn- und Schwellenländer eine zweite Chance erhalten. Die Globalisierung sollte als Chance gesehen werden, wobei Politik und Wirtschaft darauf hinwirken sollten, dass diese Chance auch tatsächlich genutzt wird.
Welche Quellen wurden für dieses Dokument verwendet?
Zu den Quellen gehören verschiedene Lexika, die Encarta Enzyklopädie, Unterrichtsmaterialien (Erdkunde und WiPo), Informationen zur politischen Bildung (Heft 263), Zeitungsartikel sowie die Webseiten www.spiegel.de, www.faz.de und www.volkswagen.de.
- Quote paper
- Lars Sörensen (Author), 2002, Globalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106239