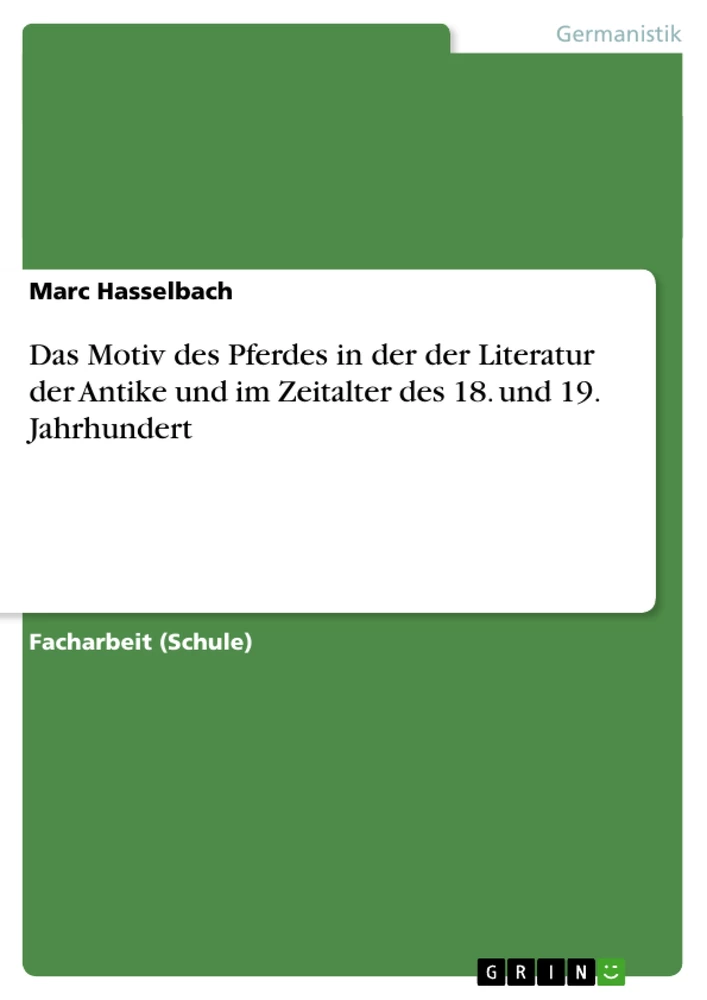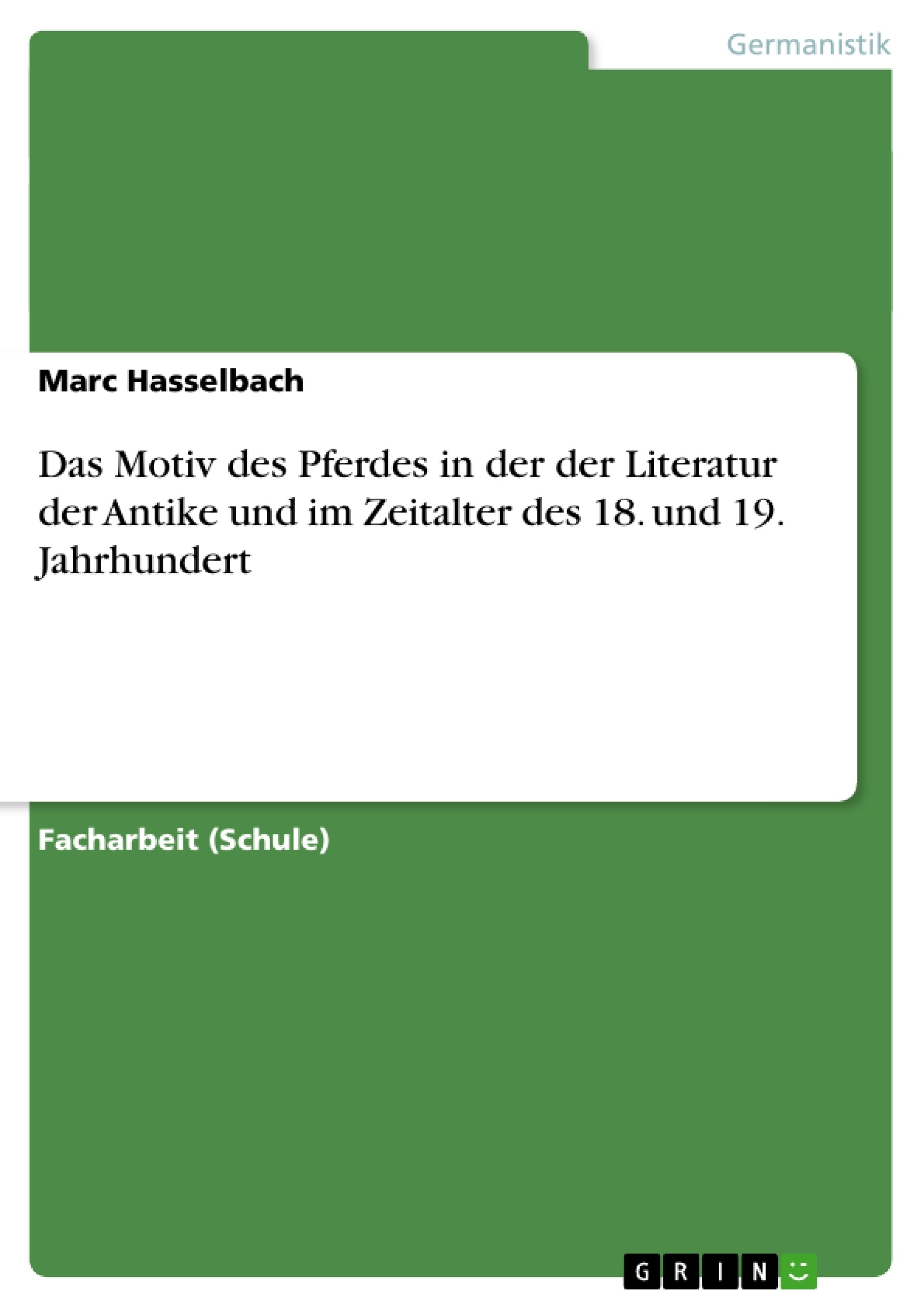Was bedeutet das Pferd wirklich für uns? Jenseits von Sattel und Zaumzeug, von Dressur und Leistungssport, enthüllt diese tiefgründige Analyse die vielschichtige Beziehung zwischen Mensch und Pferd durch die Linse der Literatur. Von den antiken Mythen um Pegasus und die Kentauren, die den Himmel bevölkern, bis hin zu den düsteren, abergläubischen Vorstellungen in Storms "Schimmelreiter", verfolgen wir die wechselnde Bedeutung des Pferdes als göttliches Symbol, unheilvoller Vorbote oder Spiegelbild menschlicher Ängste und Sehnsüchte. Die Reise führt weiter zu Kafkas verstörenden Parabeln, die die Entfremdung und Instrumentalisierung des Pferdes in der modernen Zirkuswelt thematisieren, und beleuchtet gleichzeitig dessen Potenzial als Wegbereiter für Freiheit und Selbstfindung. Tauchen Sie ein in Homers Odyssee, wo das Trojanische Pferd List und Täuschung verkörpert, und erkunden Sie, wie das Pferd in Kafkas "Landarzt" zu einem geheimnisvollen, fast übernatürlichen Helfer in der Not wird. Diese literarische Erkundung ist nicht nur eine Analyse von Texten, sondern eine Reflexion über unser eigenes Verhältnis zur Natur und die zunehmende Entfremdung in einer technisierten Welt. Entdecken Sie, wie die Kunst des "Pferdeflüsterns" uns lehren kann, die Stimmen der Natur wieder zu hören und ein tieferes Verständnis für uns selbst und unsere Umwelt zu entwickeln. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Literatur, Mythologie, Mensch-Tier-Beziehungen und die Suche nach Sinn in einer modernen Welt interessieren. Erleben Sie die Transformation des Pferdes von einem treuen Begleiter zu einem Symbol für die komplexen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit, eine Reise, die Sie dazu anregen wird, Ihre eigene Verbindung zur Natur neu zu bewerten.
1.1 Einleitung
,,Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde" So dichtete schon der Stürmer und Dränger Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1771 und der dem Gedicht unterlegte Jambus imitiert den dahin stürmenden Hufschlag des Pferdes und damit das Programm der Epoche: ,,Aufbruch". Nicht zufällig ist die Fahrt zum Liebesabenteuer an den treuen verlässlichen Begleiter, das Pferd, gebunden. Von jeher war das Pferd der Weggefährte des Menschen auf der Erde von dem mythischen Zeitalter bis an den heutigen Tag. Daher liegt es nahe, den Ursprung dieses Verhältnisses einmal genauer in den Blick zu bringen, denn je mehr wir in unser postmodernes Zeitalter rücken, desto mehr nistet sich in dieses anfänglich vertrauensvolle Verhältnis Entfremdung ein, die auf die Entfremdung des Menschen in eine volltechnisierte moderne Welt zurückweist. Diesen Prozess möchte ich anhand einiger literarischer Zeugnisse darstellen. Dabei möchte ich zuerst auf die mythischen Ursprünge zurückgehen. Danach soll das Verhältnis von Aufklärung und Aberglaube, wie es sich angesichts der Deutung eines Schimmels darstellt, entwickelt werden. Mit einer Interpretation von verschiedenen Parabeln Kafkas sollen die Paradoxien der modernen Welt, die sich auch im Verhältnis zum Pferd widerspiegeln, angedeutet werden. Schließlich geht es um einen Wandel dieses Verhältnisses, dass den Menschen wieder zu einem angemessenen Bezug zum Pferd und darüber hinaus zur ganzen Natur bringt.
2.1 Hesiod ,,Pegasus"
Aus der Theogonie von Hesiod geht der mythische Ursprung des Pegasuspferdes hervor. Zunächst wir die allgemeine Situation, beschrieben, woraus deutlich wird, dass Pegasus mit den Gorgonen und den singenden Hesperiden, Sthenno, Aryaale und der sterblichen Medusa jenseits des Okeanos wohnte. Des weiteren wird gesagt, dass das Pegasuspferd und Chrysaor durch die Enthauptung der Medusa durch Perseus befreit wurden. Der namentliche Ursprung von Pegasus wird hier dadurch hergeleitet, dass es ,,an des Okeanos Quellen ist geboren, [...]"(*) Aber das Pegasuspferde blieb nicht auf der Erde, sondern es entflog dieser und wohnte beim waltenden Herrscher Zeus und war Träger von Blitz und Donner, wodurch es sicherlich mit seine Berühmtheit erlangte.
2.2 WOLFGANG SCHADEWALDT STERNSAGEN ,,Pegasus"
Schadewaldt greift die Situation von Pegasus ebenfalls so auf, Hesiod, so beschreibt er ihn in seinen Sternsagen ebenfalls als göttliches Ross. So zeigt er ebenfalls auf, wie Pegasus die Flucht von der Erde in den Himmel gelingt.
Pegasus war kein gewöhnliches Pferd, er war weiß und hatte Flügel, in seinem Ursprung war er ein göttlich dämonisches Wesen, das in dem Morgenland geboren wurde, wie es aus den Texten hervorgeht. (*) Pegasus ist also nicht nur das wohlbekannte Dichterpferd, sondern auch ein Mythos in der Geschichte, doch das ist nicht alles; Die Götter setzten ihn wegen seines starken Charakters und seinen wundersamen Fähigkeiten als Sternenbild an den Himmel. Pegasus ,,[...] wurde, weil es ein so wundersames Tier war, am Ende als göttliches Roß nicht weit entfernt von der Gruppe jener fünf Sternbilder, über die wir gehandelt haben bis auf den heutigen Tag als das Wunderroß, das es einmal war, an den Himmel versetzt." (**)
Wahrscheinlich mit ein Grund für die Bewunderung der heutigen Pferderassen ist die Stärke die diese wie auch Pegasus ausstrahlen. Denn Pegasus wohnte beim Zeus und war Träger von Blitz und Donner, wie es auch schon Hesiod beschreibt. Blitz und Donner ist gleichzeitig etwas Unheimliches und Gewaltiges, was bei einigen Menschen Bewunderung hervorruft, wie auch Pegasus selbst.
2.3 WOLFGANG SCHADEWALDT STERNSAGEN ,,Die Kentauren"
Das Wesen dieses Pferdes und den Mythos, wie es als Sternbild an den Himmel gelangte, hat der Altphilologe W. Schadewaldt in seinen Sternsagen dargestellt. Nachdem ein König namens Aison den Tod seines Sohnes Iason vortäuscht und ein Totenfest für diesen vorbereitet, wird der Sohn von seinem Vater heimlich in die Wildnis des Pelion- Gebirges zu dem Kentauren Cheiron geschickt. ,,Dieser Cheiron war zwar, wie alle anderen Kentauren, halb Menschen, halb Pferd, allein - anders als diese wilden, weingierigen und weibertollen Burschen - war er von sanfter, freundlicher Gemütsart, ein Jäger und Arzt und noch in vielen anderen Dingen so wohlbewandert, dass man ihn den Weisen nannte und so manchen Heldenväter ihre Söhne bei ihm erziehen ließen." (*) Er erzog verschiedene Götter, wie Achill, Aktion und Asklepios, den Gott der Ärzte. Doch der eigentliche Grund, warum er als Sternenbild im Himmel von den Göttern verewigt wurde, ist der, dass er als er durch einen Pfeil vergiftet, seine Unsterblichkeit aufgibt und durch seinen Tod Prometheus von ähnlichen Qualen erlösen konnte. Die guten Eigenschaften von Cheiron haben sicherlich mit Anteil an der positiven Sichtweise des Pferdes. Dadurch, dass die Götter das Pferd in Form der Kentauren als Sternenbild im Himmel aufgenommen haben, ist die Gestalt des Pferdes mit den Göttern auf einer Ebene gleich gestellt und vertritt nicht nur den chthonischen Bereich Erde sondern auch den göttlichen Bereich Himmel, wodurch seine Einzigartigkeit und seine mythische Gestalt zum Ausdruck kommt.
3.1 Das Pferd: Zeichen der Götter oder ein Fluch ?
In der Odyssee von Homer, nämlich speziell bei der Zerstörung von Troja durch den genialen Einfall von Odysseus mit dem hölzernem Pferd, bekommt das Pferd als solches das erste Mal in der Geschichte der Antike eine Doppeldeutigkeit. So wissen die Troer nämlich zunächst nicht, was sie mit dem hölzernen Ross machen sollen: ,,Seis, das hohle Gebäude mit wildem Erz zu durchschlagen, oder zur Burg zu ziehen und dort vom Felsen zu stürzen, oder es zu schonen als Zauberweihwerk der Götter." (*) Diese Situation erforderte von den Troern die rechte Deutung. Allerdings entschieden sie sich, das Pferd als ein Geschenk der Götter zu sehen und brachten dieses in ihre Stadt, vermutlich auch wegen der, wie schon im vorherigen Text positiven Eigenschaften, die das Pferd bis dahin immerfort an sich hatte. Das war jedoch der größte Fehler den die Troer begehen konnten, denn so konnten die Argeier, mit der Unterstützung von Odysseus, wartend im Bauch des hölzernes Pferdes, so lange ausharren, bis die Troer durch den guten Wein kampfunfähig geworden waren. ,,War doch das Schicksal der Stadt zu sterben, sobald sie das große, hölzerne Ross in sich umschloss, in dem der Argeier Beste saßen und sannen, wie sie die Troer verdürben" (**)
Schließlich konnten die Truppen der Argeier in Troja einmarschieren und die Stadt zerstören: ,,Weiter sang er, wie dann die Söhne Achaias die arge Höhlung verließen, dem Roß entströmte und Troja zerstörten;" (*) So leitete der Irrtum der Troer das hölzerne Ross als göttliches Geschenk anzusehen die eigene Zerstörung ein. Es siegte also die schlaue List von der Athene und Odysseus über den Glauben der Troer. Durch diesen Vorfall hat das Pferd eine Doppeldeutigkeit gewonnen, von nun an war es nicht mehr nur das göttliche Wunderross, sondern es war auch Träger des Unheimlichen und hatte einen Hauch von einem Fluch.
4.1 Das Pferd: mythischer Zeuge oder unheimlicher Begleiter des Teufels, verdeutlicht an der Literatur ,,Der Schimmelreiter"
In dem Auszug aus der Novelle ,,Der Schimmelreiter" von Theodor Storm (**), geht es um zwei Jungen, nämlich um Carsten, einem Dienstboten des Deichgrafen, und um den Knecht des Deichgrafen Hauke Haien, namens Iven Johns. Die beiden treffen sich zufällig auf dem Deich. Die Atmosphäre ist unheimlich, denn beide bemerken, dass ein Pferdsgerippe, was sonst zusammen mit einigen Schaafgerippen daliegt, verschwunden ist.
Allerdings sehen sie, dass etwas weiter, eine Gestalt, vermutlich ein Pferd, ein Schimmel, weidet.
Sie sind verwundert, da sie die Gestalt nicht genau erkennen können, ein Wiehern ist auch nicht zu hören. Doch sie gehen davon aus, dass die Gestalt kein Pferd sein kann, da die Boote zu klein sind, die zu dieser Insel führen, um ein Pferd dorthin transportieren zu können. Schließlich beschließt einer der beiden auf die Insel zu fahren, um sich zu vergewissern. Zwar sieht Carsten Iven auf die Gestalt zugehen, doch als Iven zurückkommt, berichtet er davon, dass nichts zu sehen gewesen sei. Diese Tatsache verunsichert die beiden Bediensteten so sehr, dass beide beschließen, unverzüglich nach Hause zu gehen. Zu Hause angekommen, berichtet Hauke Haien, der Deichgraf, von seinem Kauf eines vierjährigen Schimmels, der unterernährt und ungepflegt aussah.
Nach einem Ausritt von Hauke, der ein rechtes Verständnis für das Tier hat, soll sich der Knecht Iven auf den Schimmel setzen. Doch dieser fällt sofort herunter und verflucht das Pferd. Danach kommen Iven, Carsten und Hauke auf das Pferdesgerippe zu sprechen, das nicht mehr dort ist. Hauke meint aus Spaß, dass das Gerippe logischerweise nicht mehr dort sei, weil es ja jetzt schließlich in seinem Stall stehe. Die beiden Bediensteten aber sind nach dieser Aussage nur noch mehr verunsichert und wissen nicht, was sie glauben sollen.
Die Erklärung von Hauke Haien allerdings scheint ihnen plausibel. Hauke dagegen verspottet den Aberglauben der beiden jungen Bediensteten. In diesem Teil der Novelle kommt die Zweideutigkeit, die sich auf die Gestalt des Pferdes bezieht, zum Vorschein: Die beiden Jungen, angezogen von der Begier etwas Unheimliches zu sehen, erstarren in der unheimlichen Situation vom Spuk und vom Aberglauben, der sich hinter der Gestalt und dem fehlenden Pferdsgerippe verbirgt. Sie scheinen das Unheimliche darin regelrecht zu suchen und steigern sich so in die realitätsfremde Wahrnehmung hinein.
,,Das Pferdsgerippe, das sonst dabeilag, wo ist es? Ich kann´s nicht sehen!" ,, Ich sehe es auch nicht! Seltsam!" (*) Beide denken sofort in einer abergläubischen Dimension, ohne ein aufgeklärtes Verhältnis für das Einfache, die Realität, auszubilden. ,,Da geht ein Pferd - ein Schimmel - das muss der Teufel reiten - wie kommt ein Pferd nach Jevershallig"? -,, Weiss nicht, Carsten; wenn´s nur ein richtiges Pferd ist!" (**) So sehen Iven und Carsten in der Gestalt, die ihnen mysteriös erscheint, kein "normales Pferd" sondern einen unheimlichen Begleiter des Teufels. Sie scheinen somit unaufgeklärt zu sein, und übernehmen unreflektiert gewisse Vorurteile des Aberglaubens, der eher in die Zeit des Mittelalters passt. ,,Der Junge starrte ihn an; ein Entsetzen lag plötzlich auf seinem sonst so kecken Angesicht, das auch dem Knechte nicht entging. ,, Komm" sagte dieser ,, wir wollen nach Haus: von hier aus geht´s wie lebig, und drüben liegen nur die Knochen- das ist mehr als Du und ich begreifen können." (***)
Die Situation gerät aus den Fugen und beide, die, zuvor von der Neugierde angetrieben, bleiben mussten, sind so verunsichert und geschockt, dass sie nur noch das Weite suchen. Die Gestalt des Pferdes erhält in den Augen der beiden Jungen in dieser Szenerie also eine unheimliche, spukhafte und mysteriöse Ausstrahlung. Für Hauke, der ein sehr realitätsnahes und somit aufgeklärtes Verhältnis, besitzt, erscheint das Pferd als ein schutzsuchendes dankbares Wesen, das schicksalhaft an ihn gebunden ist. Allerdings scheint es das nur in den Augen des Deichgrafen zu sein.
Denn anders als die beiden Knechte hat Hauke ein offenes Verständnis für das Schicksal des Pferdes. Das dankt der abgemagerte junge Schimmel Hauke mit seinem Vertrauen. ,,Er klopfte und streichelte ihm den blanken Hals, aber es bedurfte dieser Liebkosung schon nicht mehr; das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter, [...] dann legte er den Kopf auf seines Herren Schulter und duldete behaglich dessen Liebkosung." (*). Der Knecht hingegen kann kein positives Verhältnis zu dem gleichen Pferd aufbauen, er bleibt weiter von seinen Vorurteilen gefesselt. ,,Als aber der Knecht sich jetzt auf seinen Rücken schwingen wollte, sprang er mit einem jähen Satz zur Seite und stand dann wieder unbeweglich, die schönen Augen auf seinen Herren gerichtet." (**) Hauke kann dem Wahrnehmungsvermögen seiner Bediensteten allerdings nichts abgewinnen und verurteilt diesen als ,, Altweiberjunge " mit ,,Weiberglauben " (***) Das Geschehen ist typisch für die Moderne, denn für diese gilt, dass die Realität perspektivisch geworden ist, was bedeutet, dass ein Ereignis auf verschiedene Weise wahrgenommen und gedeutet wird, genau wie hier auch. Das gleiche Pferd wird einmal aus der Optik von Hauke dargestellt und einmal aus der der Jungen. So ist das Pferd für Hauke ein wundersames Wesen, das ihm sehr nahe steht, fast wie ein Freund. Gegenteilig ist es für die Knechte ein unheimliches Wesen, das den Teufel begleiten könnte. Hiermit wird die in diesem Auszug aus der Novelle gezeigte Doppeldeutigkeit, die dem Pferd zuteil wird, deutlich.
5.1 Die doppelte Optik: Das Pferd in der artifiziellen Welt des Zirkus.
Kafkas Parabel ,,Auf der Galerie" besteht lediglich aus zwei Sätzen. Es fällt auf, dass in beiden Sätzen das gleiche Geschehen, nämlich ein Zirkusauftritt, allerdings aus zwei verschieden Optiken, beschrieben wird. Bei dem Zirkusauftritt handelt es sich um eine Pferdedressur mit einer Kunstreiterin, die auf verschiedene Weise gesehen wird. So wird vom Erzähler im ersten Satz ausschließlich im Konjunktiv berichtet. ,,Wenn irgendeine [...] Kunstreiterin [...] im Kreise rundum getrieben würde"(x), was darauf schließen lässt, dass es sich um einen imaginären Text handelt.
Des weiteren fällt die negative Wortwahl des Autors auf, wodurch der Mensch, also die Reiterin, enthumanisiert und das Pferd verdinglicht wird. ,,irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd" (*) Der zweite Satz hingegen wird aus der entgegengesetzen Sichtweise beschrieben, denn hier ist die Reiterin nicht nur irgendeine Reiterin, sondern: ,,eine schöne Dame, weiß und rot" (x) Und das Pferd ist auch nicht nur irgendeins, sondern ein ,,Apfelschimmel" (**).
Ein Apfelschimmel steht für ein unschuldiges genügsames Wesen und nicht etwa wie in dem ersten Satz beschrieben, als ,,schwankend" (*), was sicherlich für alt, gebrechlich und schwach steht. Generell fällt die Wortwahl des Autors im zweiten Satz durchaus positiv aus, denn so verwendet dieser zum Beispiel positive Adjektive, wie ,,hingebungsvoll",,,vorsorglich" (**). Die gleiche Situation, die im ersten Satz sehr gereizt, gezwungen und brutal dargestellt wird, wird jetzt als ein wunderbares Ereignis, wo alles stimmig ist, vom ,,stolzen Livrierten"(***) bis zum ,,großen Salto mortale" (****) angesehen und dargestellt. Wie schon bei Theodor Storm gerät das Pferd in zwei verschiedene Sichtweisen. So wird es von dem Liebhaber als ein schönes und stolzes Tier geachtet, vom Kritiker und Laien allerdings wird es als ein normales Pferd, wie jedes andere auch, gesehen. Es gilt festzuhalten, dass das Pferd lange nicht mehr, wie zuvor in der Antike nur als ein nützlicher Begleiter und Freund angesehen wird, sondern mehr und mehr in die Kritik gerät und missachtet wird. Das geschieht sicherlich auch deswegen, weil das Pferd zunächst immer mehr, dann aber immer weniger für die Arbeit benötigt, vielmehr mit zunehmender Industrialisierung durch die Maschinen verdrängt wird. In den letzten Wörtern der Parabel, ,,weint er, ohne es zu wissen." (*****), wird durch den Autor die Doppeldeutigkeit noch einmal deutlich herausgearbeitet. So weint er einerseits, was zur Stimmung und Beschreibung des Erzählers im ersten Satz passt.
Weinen ist nämlich ein Ausdruck von Trauer und Hilflosigkeit. Andererseits weiß er nicht, dass er weint, was zu der Erzählperspektive des zweiten Satzes passt. Denn im zweiten Satz handelt es sich um einen begeisterten und enthusiastischen Zuschauer, der durch die Vorführung regelrecht verführt wird.
5.2 Das Pferd als unheimlicher aber dennoch vertrauensvoller Begleiter:
In der Kurzgeschichte von Franz Kafka ,,ein Landarzt" (*) nimmt das Pferd wie auch schon bei Theodor Storm eine unheimliche Gestalt an. Denn der Landarzt, der unbedingt ein Pferd braucht, um einem erkrankten Patienten zu helfen, schickt sein Dienstmädchen los um, eines zu suchen, da seines umgekommen war. Doch die Suche ist vergeblich und so stößt er, eher durch Zufall, auf einen Mann in seinem Schweinestall: ,,zerstreut, gequält stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenützten Schweinestalles. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte drin an einem Seil. Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes blauäugiges Gesicht." (**) Doch das war nicht alles: ,,» Soll ich anspannen?« fragte er, auf allen vieren hervorkriechend.
Ich wußte nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab" (*). Der Mann ruft durch sein geheimnisvolles Auftreten eine unheimliche Stimmung hervor, besonders durch das "hervorzaubern" der Pferde: ,,»Holla, Bruder, holla, Schwester!« rief der Pferdeknecht, und zwei Pferde, mächtige flankenstarke Tiere, schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper" (**) Die beiden Pferde nehmen eine mysteriöse Gestalt an, denn ein Schweinestall ist viel zu niedrig, als würden dort Pferde hinein passen. Aber auch die ganze Gestalt der Pferde scheint nicht irdisch zu sein. Sie erscheinen einem eher wie die Begleiter einer übermenschlichen Kraft. Doch nicht nur die Gestalt macht dies deutlich, sondern auch das Geschehen: Die 10 Meilen lange Fahrt dauert nur ,, einen Augenblick" (***).
Des weiteren scheinen die Pferde magische Kräfte zu haben: ,,Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben; die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen? jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und, unbeirrt durch den Aufschrei der Familie, den Kranken betrachten"(****). In dieser Kurzgeschichte tritt das Pferd nicht in die Rolle eines gewöhnlichen Pferdes, sondern ihm werden überdimensionale Fähigkeiten zugesprochen, außerdem wird es detailliert und vorteilhaft beschrieben.
Zusammenfassend wirkt das Pferd zwar unheimlich und geheimnisvoll, aber es strahlt dennoch keine negativen Eigenschaften aus.
5.3 Das Pferd als Möglichkeit zum Ritt in die Freiheit
In der Parabel,,,Der Aufbruch" (*), von Franz Kafka, geht es um einen Herren, der seinem Diener befiehlt, sein Pferd zu satteln. Doch der Diener scheint ihn nicht zu verstehen und so sattelt der Herr sein Pferd selber und will wegreiten, wonach ihn sein Diener aufhält, um ihn nach dem Ziel zu fragen. Der Herr hat zwar ein Ziel, aber der Diener kann dieses nicht verstehen, denn sein Herr möchte den Hof vermutlich für immer verlassen, was auch durch seine Antwort, nämlich dass er keine Essensvorräte benötigt, weil es eine zu weite Reise ist, deutlich wird. Bereits im ersten Satz der Parabel wird die Schwellensituation, in der sich der Ich-Erzähler befindet deutlich. Denn hier beginnt sein Vorhaben, dass er jedoch nicht alleine durchsetzen kann, denn er benötigt ein Pferd dafür: ,,Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen"(**) Vom Denkprinzip der Dialektik her gedacht, könnte man diesen Satz als These bezeichnen. ,,Der Diener verstand mich nicht" (***) Allerdings versteht sein Diener diese nicht und negiert diese Aussage.
Das Nichtverstehen kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen, entweder versteht er ihn akustisch oder vom Sinn her nicht, was nicht genauer beschrieben wird. Das Verhältnis der beiden wird deutlich aufgezeigt, so befielt der Herr seinem Diener etwas zu tun, aber durch seine Negation scheint das Verhältnis zu schwinden und der Herr löst sich aus dem Verhältnis zu seinem Knecht und nimmt die Sache selbst in die Hand, er handelt somit frei von der bisherigen Bindung. ,,Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es"(*)
Durch das Besteigen des Pferdes erweitert sich sein Horizont , denn so nimmt er scheinbar erstmals Dinge aus der Ferne war, die für ihn vorher unerreichbar waren: ,,In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute"(**) Die ,,Ferne" (***) steht in diesem Fall zeichenhaft als Indikator für Freiheit. Denn er scheint diesen Schritt wagen zu wollen, indem er eine weitere Schwelle, hier metaphorisch ,,das Tor", zu durchqueren versucht. ,,Beim Tore hielt er mich auf und fragte: "Wohin reitest du, Herr?" (****) Einzig sein Knecht versucht ihn davon abzuhalten. Doch sein Nichtgelingen ihn aufzuhalten, löst in dem Diener eine Krise in seinem Selbstverständnis aus. ,, Wohin reitest du, Herr?" (*****) Um dieser Krise zu entgehen, stellt er dem Herren gezielte Fragen, welche die Intention haben, bei dem Herren gleichermaßen eine Krise auszulösen, um diesen in den Grenzen des höfischen Leben zu halten. Des weiteren treten Verständnisschwierigkeiten zwischen dem Diener und dem Herren auf, wobei der Diener wahrscheinlich die Situation von seinem Herren nicht verstehen will, da er sich sonst darum kümmern müsste, ein neues Verständnis seines Daseins zu entwickeln. ,,Du kennst also dein Ziel? fragte er. Ja, antwortete ich, ich sagte es doch: »Weg-von-hier«, das ist mein Ziel." (*)So scheint der Herr endgültig seinen Alltag hinter sich lassen zu wollen. Was auch dafür spricht, dass es keinen Essensvorrat benötigt, denn ein Vorrat ist etwas Typisches für einen Hof, beziehungsweise eine Festung. Er braucht viel mehr Nahrung, die er während seiner Reise zusammensammelt. ,,Du hast keinen Essvorrat mit," sagte er. "Ich brauche keinen," sagte ich, "die Reise ist so lang, dass ich verhungern muss, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Essvorrat kann mich retten" (**) außerdem sieht er das Ziel, dass er hat, nicht wie sein Diener als örtliche Gegebenheit, sondern er sieht es als eine Bewegung an.
,,Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise."(***) Diese ungeheure Reise wird aber erst durch den notwendigen Begleiter, dem Pferd, ermöglicht.
6.1 Schlussteil
Durch die moderne Technik, welche die Natur beständig angreift und herausfordert, hat sich im Verhältnis von Mensch und Natur ein eigenartiger Wandel vollzogen. So versteht der Mensch die Natur in ihrem vielfältigen Leben nicht mehr, wodurch er auf der Erde ein "Fremder" zu werden droht. Daher hat das Verhältnis zum Pferd, welches in eigentümlicher Weise Natur darstellt, eine besondere Bedeutung, da der Mensch hier wieder lernen kann, ein gewandeltes Verständnis für die Natur zu entwickeln.
Beispielhaft dafür ist der Film ,,Der Pferdeflüsterer", in dem durch einen besonderen Menschen ein unfallgeschädigtes Mädchen und dessen Mutter durch den Heilungsprozess eines Pferdes selber einen solchen Prozess durchmachen.
Damit wir angedeutet, dass die Menschen von Poeten solcher Art lernen müssen, um sich auf dieser Erde zu verstehen. In diesem Film heißt es:
,,Eine Million Jahre vor unserer Zeit
weideten sie auf weiten leeren Prärien
begleitet von Stimmen, die nur sie verstanden.
Den Menschen lernten sie kennen als Jäger.
Lange bevor es begann, sie zur Arbeit einzusetzen,
hatte er sie ihres Fleisches wegen getötet.
[...]
Seit jenem Moment ... gab es unter den Menschen einige,
die um diese Furcht wussten.
Sie hatten Einblick in die Seelen der Tiere und waren in der Lage, ihre Schmerzen zu lindern.
Geheimnisvolle Worte drangen sanft in verwundete Herzen.
Man nannte diese Menschen die Flüsterer." (*)
[...]
(*) WOLFGANG SCHADEWALDT STERNSAGEN; Perseus und Andromeda
(*) WOLFGANG SCHADEWALDT STERNSAGEN; Herakles
(**) siehe op.cit.
(*) WOLFGANG SCHADEWALDT STERNSAGEN; Herakles
(*) Homer Odyssee; Achter Gesang: Odysseus` Aufenthalt bei den Phaiaken
(**) siehe op.cit.
(*) Homer Odyssee; Achter Gesang: Odysseus` Aufenthalt bei den Phaiaken
(**) Der Schimmelreiter von Theodor Storm
(*) Der Schimmelreiter von Theodor Storm
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
(*) Der Schimmelreiter von Theodor Storm
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
(*) Auf der Galerie Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(*) Auf der Galerie von Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
(****) siehe op.cit.
(*****) siehe op.cit.
(*) Der Landarzt von Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(*) Der Landarzt von Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
(****) siehe op.cit.
(*) Der Aufbruch von Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
(*) Der Aufbruch von Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
(****) siehe op.cit.
(*****) siehe op.cit.
(*) Der Aufbruch von Franz Kafka
(**) siehe op.cit.
(***) siehe op.cit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die Beziehung zwischen Mensch und Pferd von mythischen Ursprüngen bis zur modernen Entfremdung, illustriert anhand literarischer Zeugnisse. Sie erwähnt Goethes Gedicht und den Aufbruchsgedanken der Epoche, um die enge Verbindung zwischen Mensch und Pferd hervorzuheben und die zunehmende Entfremdung in der technisierten Welt zu problematisieren.
Was wird im Abschnitt über Hesiods ,,Pegasus" behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt den mythischen Ursprung des Pegasus-Pferdes gemäß Hesiods Theogonie. Er beschreibt Pegasus' Herkunft aus der Enthauptung der Medusa und seine Rolle als Träger von Blitz und Donner für Zeus.
Was wird im Abschnitt über Wolfgang Schadewaldts Sternsagen ,,Pegasus" behandelt?
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Schadewaldts Interpretation von Pegasus als göttliches Ross, das von der Erde in den Himmel flieht. Schadewaldt betont Pegasus' göttlich-dämonische Natur und seine Erhebung zum Sternbild.
Was wird im Abschnitt über Wolfgang Schadewaldts Sternsagen ,,Die Kentauren" behandelt?
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Kentauren Cheiron, der als weise Figur dargestellt wird, die Helden erzieht. Cheiron wird als Sternbild verewigt, weil er seine Unsterblichkeit opfert, um Prometheus zu erlösen, was zur positiven Wahrnehmung des Pferdes beiträgt.
Welche Doppeldeutigkeit des Pferdes wird in Homers Odyssee verdeutlicht?
In Homers Odyssee wird das Pferd durch die Geschichte des Trojanischen Pferdes erstmals doppeldeutig. Die Troer sind unsicher, ob sie das Pferd als Geschenk der Götter betrachten oder als Gefahr sehen sollen. Ihre falsche Entscheidung führt zur Zerstörung Trojas, wodurch das Pferd sowohl göttlich als auch unheilvoll erscheint.
Wie wird das Pferd in Theodor Storms ,,Der Schimmelreiter" dargestellt?
In einem Auszug aus ,,Der Schimmelreiter" wird die Zweideutigkeit des Pferdes durch die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Hauke Haien und seinen Knechten verdeutlicht. Die Knechte sehen in einem Schimmel ein unheimliches Wesen, möglicherweise eine Teufelsgestalt, während Hauke es als ein schutzbedürftiges Tier betrachtet.
Wie wird das Pferd in Kafkas Parabel ,,Auf der Galerie" dargestellt?
In Kafkas Parabel wird das Pferd in einer Zirkusvorstellung aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet: einmal als Teil einer gereizten, brutalen Zurschaustellung und einmal als Teil eines wunderbaren Ereignisses, das Begeisterung hervorruft.
Wie wird das Pferd in Kafkas Kurzgeschichte ,,Ein Landarzt" dargestellt?
In Kafkas Kurzgeschichte nimmt das Pferd eine unheimliche, aber dennoch vertrauensvolle Gestalt an. Es wird als übernatürlich und mit magischen Kräften ausgestattet dargestellt, die dem Landarzt helfen, einen Patienten zu erreichen.
Wie wird das Pferd in Kafkas Parabel ,,Der Aufbruch" dargestellt?
In Kafkas Parabel ,,Der Aufbruch" symbolisiert das Pferd die Möglichkeit zur Freiheit. Der Herr sattelt sein Pferd, um den Hof zu verlassen, und das Pferd ermöglicht ihm, eine lange Reise anzutreten und sich von den Beschränkungen des höfischen Lebens zu befreien.
Welche Schlussfolgerung wird im Schlussteil gezogen?
Der Schlussteil betont, dass die moderne Technik die Beziehung zwischen Mensch und Natur verändert hat. Das Verhältnis zum Pferd kann dem Menschen helfen, ein neues Verständnis für die Natur zu entwickeln. Der Film ,,Der Pferdeflüsterer" wird als Beispiel genannt, in dem ein Pferd zur Heilung von Mensch und Tier beiträgt, wobei die Notwendigkeit betont wird, von den Flüsterern zu lernen.
- Citar trabajo
- Marc Hasselbach (Autor), 2002, Das Motiv des Pferdes in der der Literatur der Antike und im Zeitalter des 18. und 19. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106225