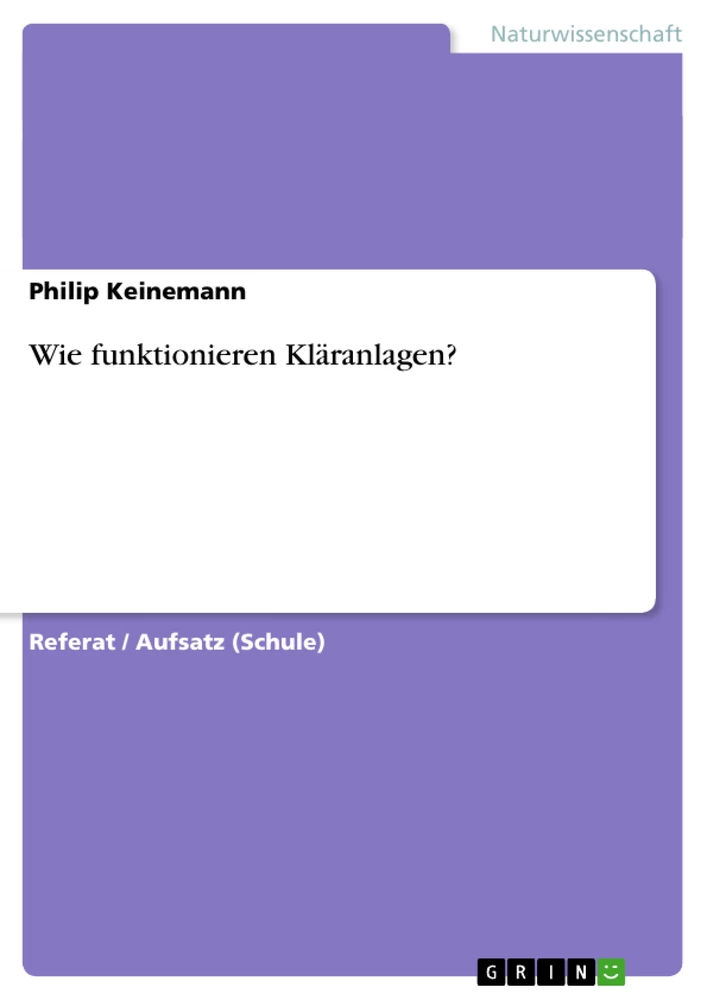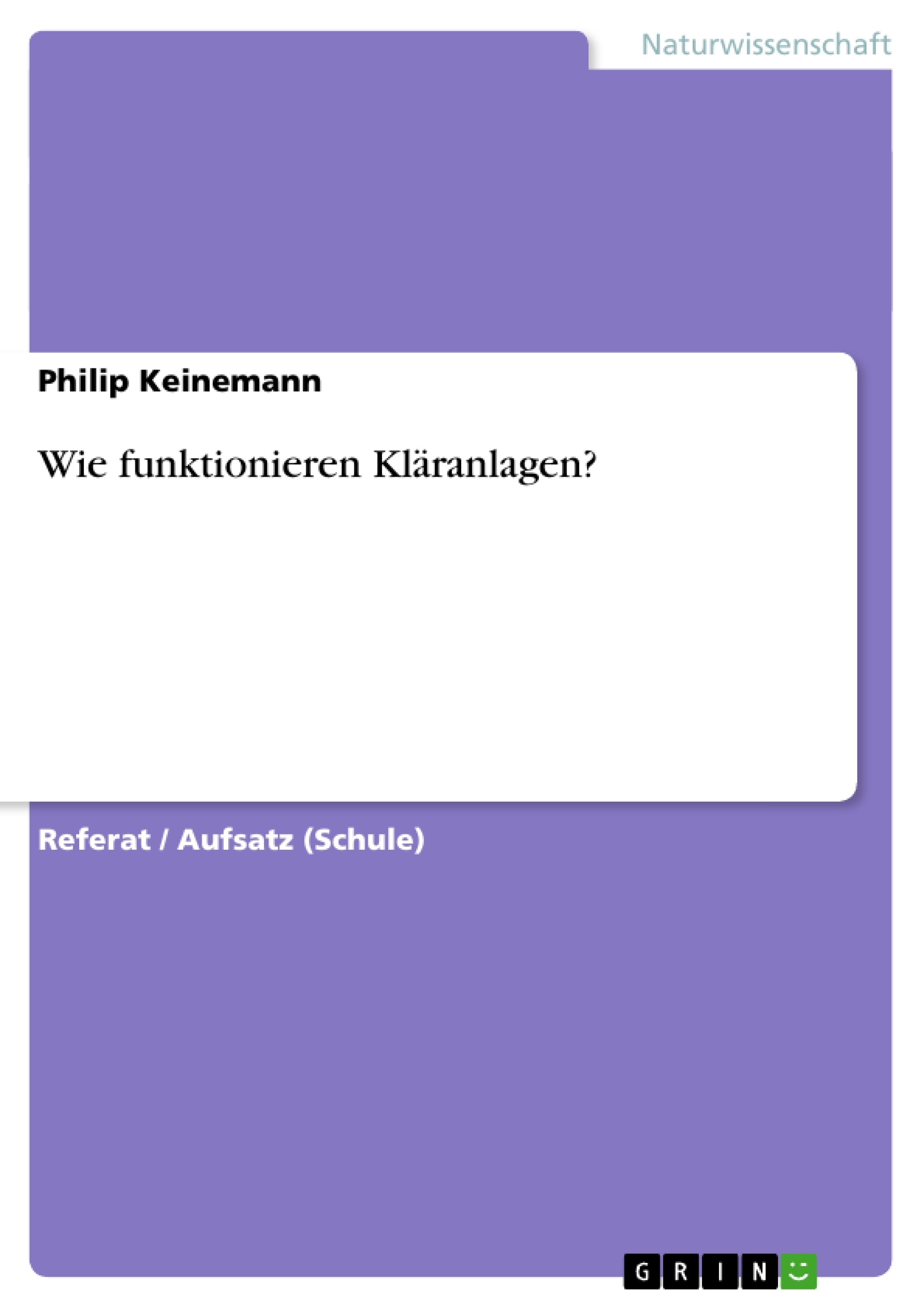Inhaltsverzeichnis:
Allgemeine Daten und Fakten zum Thema Kläranlagen
Die Geschichte des Klärens
Die verschieden Arten Abwässer zu reinigen
Die einzelnen Schritte des Klärens
Die Verwertung des Klärschlamms
Das chemische Verfahren
Welche Abwasserarten gibt es
Schmutzwasser
Niederschlagswasser
Funktion und Eigenschaft der Pflanzenkläranlagen
Quellen
1. Allgemeine Daten und Fakten zum Thema Kläranlagen
Einem Artikel aus dem Westfälischen Anzeiger vom 17.12.19981 ), ist zu entnehmen, daß die Gewässergüteklasse in der Lippe in schon 5-7 Jahren durchgehend "gut" sein werde. Sogar heute erreiche der Fluß diese Gewässergüte auf weiten Strecken, berichtete der Lippeverband einen Tag zuvor in Essen. Eine Ausnahme sei jedoch immer noch ein stärker belastetes Teilstück zwischen Lünen und Dorsten, das derzeit nur in die niedrige Gewässergüteklasse "befriedigend" eingestuft werden könne. Dies soll aber durch den Bau von weiteren Kläranlagen geändert werden. Zahlreiche bedrohte Tierarten von der Teichnapf- und Kahnschnecke bis zur gebänderten Prachtlibelle seien an der Lippe mittlerweile wieder heimisch geworden. Rund 125 Arten seien mit Ausnahme des Fischbestands im Bereich des Gewässers nachgewiesen worden. Auch Fischarten wie Lachs, Meerforelle und Flußneunauge seien dort wieder zu finden.
750.000m³ Klärschlamm erzeugen allein die Haushalte im Einzugsgebiet des Lippeverbandes in einem Jahr. Wenn man dann noch Gewerbe- und Industrieabwässer mitzählt, müsste man 30.000 Lkws mit jeweils 25t Schlamm dazurechnen.² Die Bedeutung von gut funktionierenden Kläranlagen ist für eine saubere Umwelt besonders hoch. Die biologische Reinigung ist nicht mehr möglich. Es ist ein Überbelastung der Natur die nur mit Kläranlagen bereinigt werden kann.
2. Die Geschichte des Klärens
Die Methoden zur Abwasserentsorgung existieren schon seit der Antike. Besonders ausgefeilt, waren die erbauten Abwasserkanäle, die teilweise noch heute in Betrieb sind. Damals entleerte man den Hausmüll auf der Straße, damit sie später mit dem abfließenden Regenwasser weggespült werden konnten. Gegen Ende des Mittelalters entstanden in Europa unterirdische Sammelgruben in Kellergewölben, später dann Jauchegruben. Waren diese Behälter gefüllt, entfernten Abortentleerer die Ablagerungen auf Kosten des Grundbesitzers. Die Abfälle wurden meist als Dünger für die Felder genutzt.
Einige Jahrhunderte später baute man erneut Abwasserkanäle, meistens in Form von breiten, offenen Kanälen oder schmaleren Rinnsteinen. Anfangs war es untersagt, den Abfall in die Rinnsteine zu entsorgen. Seit dem 19.Jahrhundert, war dies aber mehr und mehr erwünscht. Man hatte erkannt, daß so Seuchen vermieden werden konnten.
Die Installation von Wasserleitungen in den Häusern führten zum Bau von Spülklosetts und den ersten modernen Abwasser- und Kanalisationssystemen.
Zu Beginn des 20.Jahrhunderts erkannten einige Städte und Industriezweige, daß das Entsorgen von Abfällen in Flüsse das ökologische Gleichgewicht erheblich schadet. Aus diesem Grunde wurden nun Kläranlagen gebaut. Etwa zur gleichen Zeit konnten biologische Klärgruben Abwässer aus Einzelhaushalten in Vorstädten und ländlichen Gebieten entsorgen. Seit den siebziger Jahren werden in den Industrieländern verfeinerte Methoden der chemischen Klärung angewandt. Die neueste Entwicklung sind so genannte Pflanzenkläranlagen, bei denen verschiedene Sumpfpflanzen zur Reinigung eingesetzt werden.
3. Die verschiedenen Arten Abwässer zu reinigen
In einer Kläranlage werden Rohabwässer der Haushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe gesäubert. In der mechanischen Kläranlage Hamm - Mattenbecke ca. 500m Luftlinie vom Landschulheim Schloß Heessen entfernt, werden die Abwässer mit chemischen sowie biologischen Zusätzen behandelt bzw. gesäubert. Es gibt unterschiedliche Arten von Kläranlagen. Der bekannteste Typ ist die mechanischen Kläranlage, die man als graue, quadratische und aus dem Boden gestampfte Anlage kennt. Ebenfalls eine gute Art zu klären aber längst nicht so bekannt und angewendet, ist die Pflanzenkläranlage.
Heute gibt es im wesentlichen folgende Kläranlagentypen.:
1. Mechanische Kläranlagen
2. Chemische Kläranlagen
Die verschiedenen Aufbereitungssysteme werden auch in Kombinationen miteinander eingesetzt, um die optimalen Reinigungsergebnisse zu erzielen.
Nachfolgende Ausführungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die mechanische Kläranlage, die heute die wesentliche Grundeinheit für die Abwässerklärung bietet. Um bei starken Regenfällen eine Überlastung der Kläranlagen vorzubeugen erbaut man Regenüberlaufbecken. Dies verhindert dann das Abfließen von ungereinigten Abwasser.
Ein solcher Kläranlagentyp befindet sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Schule. Dort werden in der Kläranlage Mattenbecke die häuslichen und gewerblichen Abwässer der Stadt Hamm, bzw. aus einem Teil davon gereinigt, um so aufbereitet der Lippe zugeführt zu werden.
Das Schaubild verdeutlicht die Lage der Anlage Mattenbe>
4. Die einzelnen Schritte des Klärens
Das Klären von Wasser läuft in vielen Schritten ab:
1.) Primärstufe
- Sandfang
- Absetzung und Ausfällung
- Schwimmabschneidung
- Bakterielle Zersetzung
- Trocknung
2.) Sekundärstufe
1. Belebtschlammverfahren
2. Abwasserteich
3.) Tertiärreinigung
- Fortgeschrittene Wasseraufbereitung
4.) Wiederverwendung
Zunächst wird das Abwasser durch Rechen und Siebe von den sogenannten Sperrstoffen wie Holz, Steine, Tücher etc. Sowie von feineren Feststoffen wie Rückstände von Hygieneartikeln, Papier, Zigarettenstummeln etc. befreit.Die gefangenen und herausgefilterten Stoffe werden dann gepresst. Anschließend werden sie getrocknet und auf die Mülldeponie gefahren, um dort verbrannt zu werden.
Nachdem sich der von den Straßen gespülte Sand im Sandfang abgesetzt hat und den weiteren Klärprozeß nicht mehr beeinträchtigt, werden Öle und Fette mit einem Ö labschneider entfernt. Die Schwimmschicht wird abgeschöpft oder über eine Rinne abgeführt. Dann gelangen die Abwässer in das Vorklärbecken. In der Vorklärung bleibt der größte Teil der ungelösten Bestandteile zurück. Im Vorklärbecken bleibt das Wasser mindestens 30 Minuten. In der Zeit setzen sich 20% der Schmutzstoffe am Boden ab.Sie bilden den "Primärschlamm".
Nach dem Vorklären wandert das Abwasser in die biologische Reinigung. In sogenannten Belebungsbecken bauen Mikroorganismen die organischen Schmutzstoffe ab. Das heißt, sie fressen sie regelrecht auf und vermehren sich dabei vehement (sehr schnell).Durch ein Belüftungsgitter wird dem Wasser Sauerstoff in genauer Dosierung hinzugegeben. Bakterien nehmen gelöste Schmutzstoffe auf und Urtierchen strudeln sich Bakterien und Schmutzstoffe ein. Dem wasser wird ebenfalls Stickstoff entzogen. Dazu dienen Behälter, die nur dann wirken, wenn das Wasser nicht belüftet ist. Anschließend entweicht der Stickstoff in die Atmosphäre. Die gewaltig große Menge von Mikroorganismen bilden den Belebtschlamm.
In Kläranlagen benutzt man für diesen Vorgang offene, mit Kies und Sand, auch mit belebtem Schlamm gefüllte Behälter, über denen das Schmutzwasser durch Drehsprenger gleichmäßig verteilt wird. Oder man verwendet hohe Behälter die sogenannten "Faultürme", die mit Schlacke oder Koks gefüllt sind. Der Belebtschlamm wird in der Nachklärung vom gereinigten Abwasser abgetrennt und wieder in den biologischen Reinigungsprozeß zurückgeführt.Bei der Nachklärung steht das Wasser ruhig im Becken, damit sich die Bakterien und Kleinstlebewesen absetzen können. Die Nachklärung entfernt den Bakterienschlamm. Ein Teil dieses Belebtschlammes wird als Ü berschußschlamm dem Prozeß entnommen.
In den dafür erbauten Faultürmen werden Primär- und Überschußschlamm (Rohschlamm) wiederum von Mikroorganismen soweit verarbeitet, daß dadurch eine Geruchsbelästigung bei der Entsorgung vermieden wird.
Der Belebtschlamm wird entweder getrocknet oder kompostiert, verbrannt oder in Faultürmen verfault, wobei durch Gärung verwertbares Methangas (Biogas) entsteht.
Der Ausfaulungsprozeß geht unter Luftabschluss vor sich und erfordert eine konstante Temperatur von ca. 37°C. Nach etwa drei Wochen Aufenthaltsdauer hat sich der größte Teil der organischen Bestandteile in organisches Material umgewandelt. Die Faulbehälter werden kontinuierlich mit Klärschlamm beschickt und auch das Abpumpen des Schlamms aus dem Behälter ist ein ständiger Prozeß.
In der Schlammentwässerung wird dem Klärschlamm dann Wasser entzogen, so daß er kostengünstiger verwertet werden kann.
Das geklärte Abwasser, zu mehr als 95% in der Kläranlage gereinigt, kann jetzt problemlos in den Fluß (in diesem Beispiel in die Lippe) geleitet werden. Der Überschuß an Belebtschlamm wird in Faultürmen entwässert. Wenn er zu stark belastet ist oder eine zu große Menge hat wird er auf die Deponie gebracht oder zu Düngezwecken weitergegeben. Um die Felder nicht zu überdüngen, wird das Phosphat durch Zugabe von chemischen Mitteln entzogen. In einem Me ß - und Steuerungssystemraum, werden die Koordinationen der verschiedenen Reinigungsstufen von einem speziellen Meß- und Steuerungssystem überwacht. Bei Eintritt und Verlassen der Kläranlage werden zum Beispiel die Zusammensetzung, sowie die chemischen Eigenschaften des Abwassers gemessen und registriert. Durch die biologische- und mechanische Reinigung werden ca. 97% der Schmutzstoffe dem Wasser entzogen.Bei der Reinigung von Abwässern fällt Klärschlamm an.
5.Die Verwertung des Klärschlamms
Nun muß man sich die Frage stellen:
Was soll man mit dem Abfallprodukt Klärschlamm machen?
Da die Substanzen in dem Klärschlamm weitgehend aus organischem Dünger bestehen, wie zum Beispiel Stallmist, eignet dieser sich hervorragend zu Düngezwecken. Vorher muß aber gründlich untersucht werden, ob keine Boden-, Wasser- oder pflanzengefährliche Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle, enthalten sind.
Es gibt auch andere Möglichkeiten Klärschlamm weiter zu verarbeiten. Die Schlämme aus einem stärker industriell geprägten Gebiet werden entwässert und u.a. Kohle als Filterhilfsmittel hinzugegeben. Dadurch erhöht sich der Heizwert des Klärschlamms und das Produkt wird auf dem Wärmemarkt nutzbar.
Durch dieses Verfahren wird Energie geschaffen und wertvoller Deponieraum gespart. Man spricht hier von Recycling.
Eine weitere Nutzung des Schlamms, aber denkbar ungünstiger, wäre die Verbrennung. Hier kann man nur von einer Notlösung sprechen, da das Deponieproblem allenfalls kleiner aber nicht gelöst wird. Außerdem fehlt der Effekt des Recycling ganz.
6. Das Chemische Verfahren
Chemische verfahren dienen der Entfernung gelöster, feinstverteilter oder in kolloidaler Form anfallender Stoffe, die mechanisch nicht geklärt werden können. Als Fällungsmittel werden z.B. Kalkhydrat, Natronlauge oder Eisensalze verwendet. Organische Kolloide oder kolloidale Stoffe werden durch Zugabe von Flockungsmitteln (z.B. Eisenhydroxid) gebunden.
7. Welche Abwasserarten gibt es
Wasser fließt zu Tal, das ist ein Naturgesetz. Aber nicht nur sauberes Wasser, auch Abwasser fließen zu Tal. Dieses gelangt dann in Flüsse, Ströme und Seen. Die kontinuirlich ansteigenden Abwassermassen überfordert die in Gewässern lebenden Selbstreinigungskräte. Sie reichen nicht mehr aus , um alle im Abwasser enthaltenen Schmutzstoffe abzubauen. Bei vielen Seen und Bächen kippt das biologische Gleichgewicht. Aber wissenschaftliche Versuche und Erfahrungen haben gezeigt, daß alles Abwasser unschädlich gemacht werden kann. In mechanischen und biologischen Kläranlagen. Je nach Art und weise seines Entstehens unterscheiden wir zwischen:
a) Schmutzwasser
b) Niederschlagswasser
8. Schmutzwasser
Unter dem Begriff Schmutzwasser muß man sich ein Gemisch aus Wasser und Schmutzstoffen jeglicher Art vorstellen. Es fällt größtenteils in Gemeinden und auch großen Betrieben in Niederschlagslosen Zeiten an. Dabei setzt sich dieses Gemisch aus den Schmutzwasserabflüssen der Gewerbe- und Industriebetriebe und Schmutzwasser aus den öffentlichen Gebäuden verschiedener Art z.B. Schulen, Krankenhäuser etc. zusammen. Auch das Fremdwasser wird zum Schmutzwasser gerechnet.
9. Niederschlagswasser
Unter dem Begriff Niederschlagswasser muß man Regen Schnee, Hagel, Raureif, Nebel und Tau verstehen. Die Menge die an Niederschlagswasser anfällt, ist um ein bedeutendes größer als die Schmutzwassermenge. Aus diesem Grund spielt bei der Bemessung, von Mischwasserleitungen die Schmutzwassermenge eine untergeordnete Rolle.
Man kann sich vorstellen, daß die Spülwirkung eines Regenschauers nicht unbeträchtlich ist und daß daher zu Beginn eines Regens die Verschmutzung des Wassers durch Abschwemmung von den Straßen z.B. von feinem Sand, Öl und Feststoffen usw. sowie durch Ausspülung der Kanäle besonders hoch ist, um erst dann allmählich im Verhältnis zur Verdünnung abzunehemen. Der Abfluß der atmosphärischen Niederschläge (Schnee, Hagel) verteilt sich in folge des Schmelzprozesses auf einen größeren Zeitraum und bringt keinen bedeutenden Wasseranfall.
10. Funktion und Eigenschaften der Pflanzenkläranlagen
Nicht nur mechanische Kläranlagen können Abwässer filtrieren, sondern auch die Natur. Die sogenannten Pflanzenkläranlagen werden besonders bei Privathäusern angewendet. Diese Säuberungsart hat viele Vorteile.
Durch den Einsatz von Pflanzen die dieser Funktion gerecht werden, kann man verschmutzte Gebiete wieder bewohnbar machen. Man muß keine Abwassergebühren zahlen und es bildet sich kein stechender Geruch. Durch die Pflanzen wird das Wasser sehr gründlich gesäubert. Die Betriebsdauer solcher Pflanzenkläranlagen ist sehr hoch. Bis zu 20 Jahre laufen sie einwandfrei.
Ü berlegen Sie nun einmal, warum Sie noch nicht auf eine Pflanzenkläranlage umgestiegen sind!
1)Siehe anliegende Kopie
2)Diese Angaben habe ich der Broschüre des Lippeverbandes "Klärschlamm ein Rohstoff mit Wert" entnommen (September1991).
Einige weitere wichtige Informationen entnahm ich der Quelle des Lippeverbandes "Kläranlage Hamm-Mattenbecke" (Mai 1996).
Quellen:
1. Lippeverband, Kläranlage Hamm-Mattenbecke, Mai 1996
2. Lippeverband, Klärschlamm - ein Rohstoff mit Wert, Mai 1996
3. Westfälischen Anzeiger vom 17.12.1998
4. Encarta 99
Häufig gestellte Fragen
Was sind die allgemeinen Daten und Fakten zum Thema Kläranlagen?
Laut einem Artikel aus dem Westfälischen Anzeiger vom 17.12.1998 sollte die Gewässergüteklasse in der Lippe innerhalb von 5-7 Jahren durchgehend "gut" sein. Der Lippeverband berichtete, dass der Fluss diese Qualität bereits auf weiten Strecken erreicht. Der Bau weiterer Kläranlagen soll auch ein stärker belastetes Teilstück verbessern. Zahlreiche Tierarten sind an der Lippe wieder heimisch geworden. Die Kläranlagen im Einzugsgebiet des Lippeverbandes produzieren jährlich große Mengen Klärschlamm. Gut funktionierende Kläranlagen sind für eine saubere Umwelt unerlässlich.
Wie sieht die Geschichte des Klärens aus?
Methoden zur Abwasserentsorgung existieren seit der Antike. Im Mittelalter wurden Sammelgruben und Jauchegruben genutzt. Später wurden Abwasserkanäle gebaut, um Seuchen zu vermeiden. Die Installation von Wasserleitungen führte zu Spülklosetts und modernen Kanalisationssystemen. Im 20. Jahrhundert wurden Kläranlagen gebaut, um die Umweltbelastung durch Abwässer zu reduzieren. Pflanzenkläranlagen sind eine neuere Entwicklung.
Welche verschiedenen Arten der Abwasserreinigung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Kläranlagen, wobei die mechanische Kläranlage am bekanntesten ist. Es gibt auch chemische Kläranlagen und Pflanzenkläranlagen. Oft werden verschiedene Aufbereitungssysteme kombiniert, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Regenüberlaufbecken verhindern die Überlastung der Kläranlagen bei starken Regenfällen.
Welche einzelnen Schritte sind beim Klären erforderlich?
Das Klären von Wasser erfolgt in mehreren Schritten. Die Primärstufe umfasst Sandfang, Absetzung und Ausfällung, Schwimmabschneidung, bakterielle Zersetzung und Trocknung. Die Sekundärstufe beinhaltet Belebtschlammverfahren und Abwasserteiche. Die Tertiärreinigung umfasst fortgeschrittene Wasseraufbereitung. Schließlich kann das gereinigte Wasser wiederverwendet werden. Sperrstoffe und Feststoffe werden entfernt, Sand wird abgesetzt, Öle und Fette werden abgeschieden, und im Vorklärbecken setzen sich Schmutzstoffe ab. In der biologischen Reinigung bauen Mikroorganismen die organischen Schmutzstoffe ab. Der Belebtschlamm wird in der Nachklärung vom gereinigten Abwasser getrennt und wieder in den Reinigungsprozess zurückgeführt. Der Klärschlamm wird in Faultürmen verarbeitet. Das gereinigte Abwasser kann dann in Flüsse geleitet werden.
Wie erfolgt die Verwertung des Klärschlamms?
Klärschlamm kann zu Düngezwecken verwendet werden, sofern er keine boden-, wasser- oder pflanzengefährlichen Stoffe enthält. Er kann auch entwässert und mit Kohle vermischt werden, um den Heizwert zu erhöhen und ihn auf dem Wärmemarkt nutzbar zu machen (Recycling). Die Verbrennung ist eine weniger günstige Notlösung. Phosphat wird durch Zugabe von Chemikalien ausgefällt, um die Felder nicht zu überdüngen.
Was beinhaltet das chemische Verfahren der Abwasserreinigung?
Chemische Verfahren dienen der Entfernung gelöster, feinstverteilter oder in kolloidaler Form anfallender Stoffe, die mechanisch nicht geklärt werden können. Fällungsmittel wie Kalkhydrat, Natronlauge oder Eisensalze werden verwendet. Organische Kolloide werden durch Zugabe von Flockungsmitteln (z.B. Eisenhydroxid) gebunden.
Welche Abwasserarten gibt es?
Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Abwasser: Schmutzwasser und Niederschlagswasser.
Was ist Schmutzwasser?
Schmutzwasser ist ein Gemisch aus Wasser und Schmutzstoffen jeglicher Art, das hauptsächlich in Gemeinden und Betrieben anfällt. Es setzt sich aus Abflüssen aus Gewerbe-, Industrie- und öffentlichen Gebäuden zusammen.
Was ist Niederschlagswasser?
Niederschlagswasser umfasst Regen, Schnee, Hagel, Raureif, Nebel und Tau. Die Menge an Niederschlagswasser ist bedeutend größer als die Schmutzwassermenge.
Wie funktionieren Pflanzenkläranlagen und welche Eigenschaften haben sie?
Pflanzenkläranlagen nutzen die natürlichen Reinigungskräfte von Pflanzen, um Abwasser zu filtern. Sie werden oft bei Privathäusern eingesetzt. Vorteile sind, dass verschmutzte Gebiete wieder bewohnbar gemacht werden können, keine Abwassergebühren anfallen, keine Geruchsbelästigung entsteht und das Wasser gründlich gereinigt wird. Die Betriebsdauer ist sehr hoch.
- Quote paper
- Philip Keinemann (Author), 2002, Wie funktionieren Kläranlagen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106210