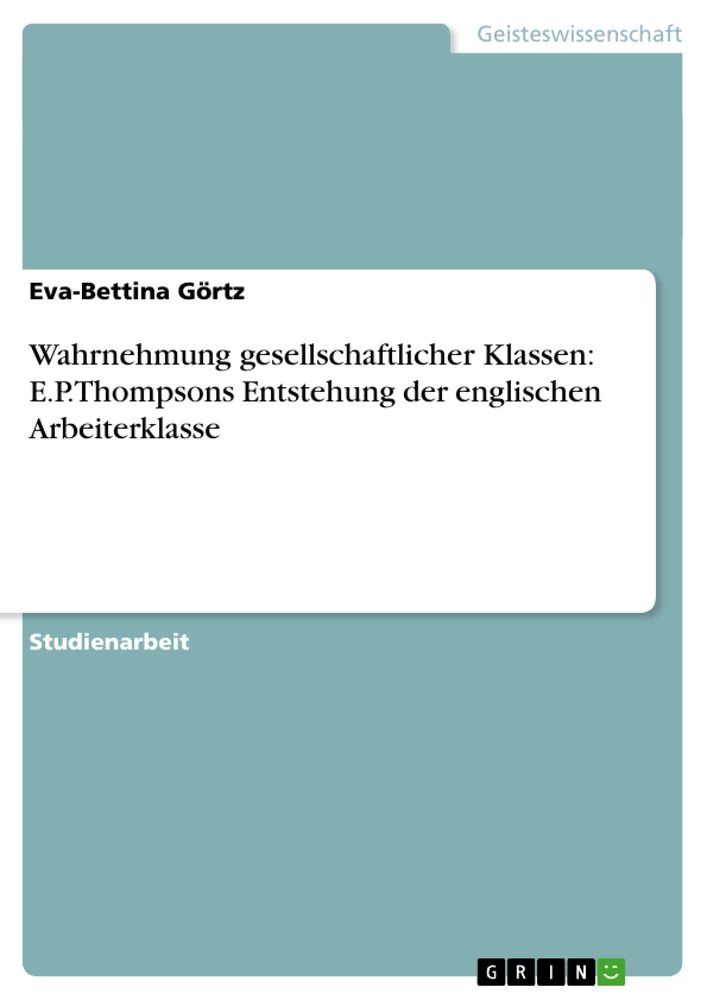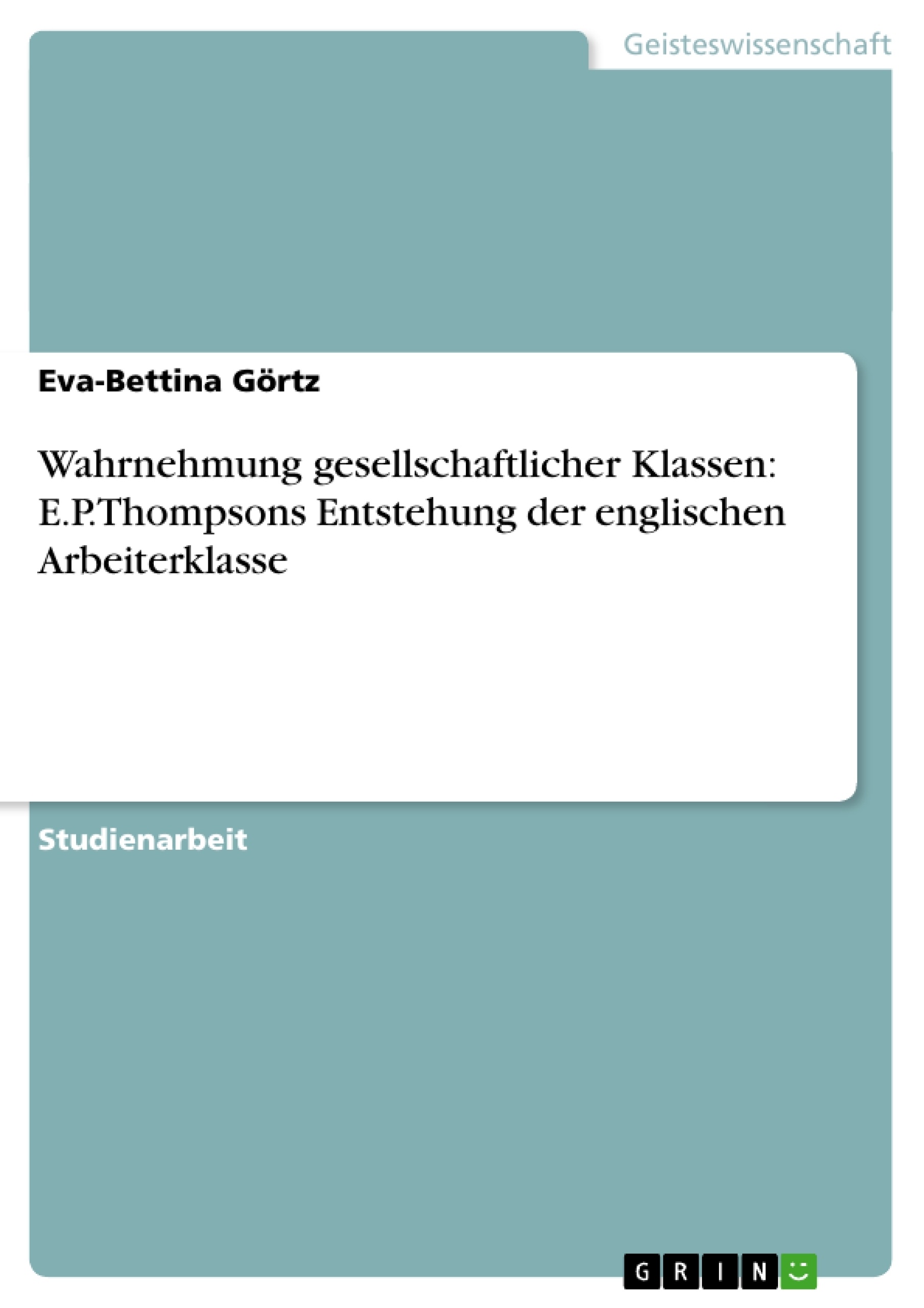Inhalt
1. Einleitung
2. „The Making of the English Working Class” im biographischen und gesellschaftlichen Kontext
3. Anmerkungen zur Thompson-Rezeption in Deutschland
4. „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse”
a) Darstellungsweise
b) Kursorischer Überblick
c) Quellen
5. Thompsons Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen in „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse”
6. Literatur
1. Einleitung
„ Wissenschaftsgeschichte. Die Geschichte der Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen ” lautete der Titel eines Seminars an der Universität Bremen im Wintersemester 1999/2000, in dessen Rahmen die vorliegende Beschäftigung mit der deutschen Übersetzung von E.P. Thompsons „ The Making of the English Working Class ” (MEWC) ihren Platz fand1. Gegenstand des Seminars war die Untersuchung von beispielhaften Textauszügen politischer Denker, Philosophen und Wissenschaftler von der Antike bis in die jüngste Vergangenheit hinsichtlich der Frage, inwieweit darin eine soziale Gliederung eines gesellschaftlichen Ganzen in zwei oder mehr Großgruppen, die als Klassen bezeichnet werden könnten oder werden, thematisiert wird. Nachgegangen werden sollte ihrer Benennung und Beschreibung, den zugrunde liegenden Kriterien und Begriffen sowohl für die Gesellschaft als Ganzes als auch für ihre Einteilung, den Urteilen des Autors über einzelne Großgruppen bzw. Klassen sowie einer möglicherweise in den Texten zum Ausdruck kommenden Fortschrittskonzeption. Den Schwerpunkt des Seminars bildete die Beschäftigung mit Quellentexten, die im Zuge der entscheidenden Entwicklungen im 18.und 19. Jahrhundert verfaßt wurden, wie beispielsweise Schriften von Adam Smith, Anne-Robert-Jaques Turgot, Emmanuel Joseph Siestes, François Noël Babeuf, Claude Henri Saint-Simon, Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels und Max Weber. Den Abschlußdes Seminars bildete eine exemplarische Beschäftigung mit einigen Historikern und Soziologen des 20. Jahrhunderts und ihrer Betrachtung gesellschaftlicher Klassen nun im Medium der Zeit, in ihrer Geschichtlichkeit. Explizit nicht Gegenstand des Seminars war eine Beschäftigung mit den Quellen unter klassentheoretischen Fragestellungen, d.h. es ging nicht um die Frage, inwieweit es sich bei der in den Quellen zum Ausdruck kommenden Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen um in sich logische und die Wirklichkeit adäquat erfassende und erklärende Theorien handelt. Dementsprechend war es also nicht Ziel des Seminars, die Geschichte der Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen als Fortschrittsgeschichte von Klassentheorie zu konstruieren. Vielmehr sollte mit der „Geschichte der Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen“ als Wissenschaftsgeschichte eine Bestandsaufnahme, Beschreibung und Verortung der Klassenthematik sowie Veränderungen der Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen im jeweiligen konkreten historischen und gesellschaftlichen Kontext erarbeitet werden.
In diesem Sinne zielt die Beschäftigung mit Thompsons „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” weder auf die konkrete empirische Geschichte der Entstehung der englischen Arbeiterklasse noch auf die Überprüfung der von Thompson rekonstruierten historischen Entwicklungen im einzelnen, sondern leitende Fragestellungen sind auch hier die oben genannten. Mit anderen Worten: Nicht die Entstehung der englischen Arbeiterklasse als solche ist Thema der vorliegenden Arbeit, sondern Thompsons Wahrnehmung derselben. Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über den biographischen und politisch-gesellschaftlichen Kontext, in dem MEWC produziert wurde, erarbeitet werden. Da die vorliegende Arbeit nicht das englische Original, sondern die deutsche Übersetzung zur Grundlage nimmt, folgt eine Skizze der Rezeptionsgeschichte von MEWC in Deutschland. Daran anschließend werden nach einigen einleitenden Bemerkungen zum Charakter von MEWC die wichtigsten Thematiken und einige zentrale Thesen anhand der deutschen Übersetzung zusammengefaßt, um schließlich nach einigen knappen Bemerkungen zu den von Thompson verwendeten Quellen im letzten Abschnitt zum zentralen Anliegen, nämlich Thompsons Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen zu gelangen. Vorweg jedoch noch eine Anmerkung: Zwar sind die konkreten von Thompson beschriebenen historischen Entwicklungen im einzelnen nicht Thema der vorliegenden Arbeit, dennoch kann meiner Meinung nach eine Beschäftigung mit Thompsons „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ nicht völlig darauf verzichten, sich in einem gewissen Rahmen auf die konkrete empirische Geschichte der Entstehung der englischen Arbeiterklasse einzulassen. Dies ist im Folgenden v.a. im Abschnitt vier und z.T. in Abschnitt fünf der Fall. Warum das so ist, sollte dort ebenfalls deutlich werden.
2. „The Making of the English Working Class” im biographischen und gesellschaftlichen Kontext
1959 hatte die prekäre finanzielle Situation Thompson dazu bewogen, das Angebot eines Verlages, einen Abrißüber die Geschichte der englischen Arbeiterklasse von 1790 bis1921 zu verfassen, anzunehmen. Was 1963 auf den Markt kam, war das auf knapp tausend Seiten angeschwollene erste Kapitel des ursprünglichen Vorhabens, nämlich „ The Making of the English Working Class ”, das die Formierung der englischen Arbeiterklasse im Zeitraum von 1790 bis 1830 beschreibt.2 Wer war der Mann, den selbst die Ebbe im Portemonnaie nicht hinderte, sich zugunsten eines offenen Forschungsprozesses über die Absprachen mit dem Arbeitgeber hinwegzusetzen?
Edward Palmer Thompson (1924-1993) wuchs in einem liberalen Elternhaus auf, das eng mit der indischen Befreiungsbewegung verbunden war. Sein Vater war nach Thompsons eigenen Worten ein „ entschiedener Liberaler ”, Kritiker des britischen Imperialismus und Freund Nehrus sowie anderer Führer der antikolonialen indischen Befreiungsbewegung. „ So wuchs ich mit der Einstellung auf, daßRegierungen lügen und imperialistisch sind und daßmeine Haltung regierungsfeindlich zu sein habe. ” 3 1941 bis 1946 studierte Thompson, unterbrochen vom Kriegsdienst in Italien, Geschichte an der Universität Camebridge. 1942 trat Thompson achtzehnjährig in die Kommunistische Partei Großbritanniens ein.
Die kommunistische Partei Großbritanniens war im Gegensatz etwa zur KP Italiens oder Frankreichs niemals eine Massenpartei. Zwar verfügte sie in den 1920er und 30er Jahren über eine solide Basis in der Arbeiterbewegung und gewann durch die antifaschistische Popular Front landesweite Unterstützung. Im wesentlichen blieb sie jedoch „ eine Partei der ‚ Hochintellektuellen ‘ , die an führenden akademischen Institutionen in Camebridge oder Oxford und an der London School of Economics arbeiteten oder studierten ”.4 Die politischen Perspektiven, die Thompson mit seiner Entscheidung für die kommunistische Partei verknüpfte, waren demgegenüber vor allem „ an der KP der Massenbewegungen orientiert, die er von 1942 bis 1946 in Südosteuropa real sah und an denen sein Bruder Frank direkt und er selber vermittelt teilnahm. ” 5 Frank Thompson war ebenfalls Kommunist und starb als antifaschistischer Widerstandskämpfer in Bulgarien, was bedeutenden Einflußauf Edwards politisches und moralisches Engagement ausübte: „ Die Briefe meines Bruders passenüberhaupt nicht zu dem schematischen Bild vom Stalinismus. Sein Engagement galt dem Volk und vor allem dem Heroismus der südeuropäischen Partisanenbewegung. ” 6 1947 engagierte sich E.P. Thompson als Freiwilliger beim Eisenbahnbau im jungen, kommunistischen Jugoslawien.
In Großbritannien arbeitete Thompson in der Historians ’ Group of the Communist Party, zu der u.a. auch Maurice Dobb, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, John Saville, George Rudé, und Raphael Samuel gehörten und aus der heraus 1952 die Zeitschrift Past and Present hervor ging. Die Historians ’ Group of the Communist Party verstand wissenschaftliche Arbeit und wissenschaftliche Erkenntnis vor allem als einen kollektiven Prozeß. So resümiert Thompson 1978 rückblickend, daßihm „ die kritische und solidarische Hilfe “ und der „ formelle und informelle Austausch mit anderen Sozialisten “ bezüglich seines Werdegangs zum Historiker „ mehr als alles, was ich in Camebridge kennengelernt habe “ , half. Als „ Teil eines Kollektivs [...], in dem der eineüber den Sozialstaat, ein andererüber Erziehung und ein dritterüber Imperialismus schreibt “ , will Thompson auch sein MEWC verstanden wissen: „ Ich habe Genossen und Kollegen, die sehr gründliche Wirtschaftshistoriker sind, wie etwa John Saville und Eric Hobsbawm und viele andere. Sie sind auf diesem Gebiet besser als ich, und ich glaube daher eher, daßmeine Arbeiten in einem gr ößeren Diskussionszusammenhang ihren Platz haben. “ 7 Neben der Kollektivität verpflichtete das marxistische Selbstverständnis dieser Gruppe desweiteren dazu, Geschichte aus der Perspektive der Massen als Subjekt der Geschichte zu schreiben sowie zum Bemühen um eine demokratisierende Geschichtsschreibung, die ihre Adressaten jenseits akademischer Eliten verortet. Ein Ansatzpunkt für letzteres war u.a. die während der Zwischenkriegszeit und in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf ihrem Höhepunkt stehende Bewegung für Arbeiterbildung. Thompson beispielsweise war als Dozent in der Erwachsenenbildung bei der Workers’ Education Association (WEA) tätig, was nach seinem eigenen Bekunden im Vorwort zur MEWC Ausgabe von 1980, die Grundlage der deutschen Übersetzung war, eine erhebliche Bedeutung für den Produktionsprozess von MEWC hatte: „ Sowohl die Diskussionen in diesen Kursen [der Erwachsenenbildung, E.G.] als auch praktische politische Arbeit [im Rahmen der New Left, E.G.] haben mich zweifellos dazu bewogen, die Probleme von politischem Bewußtsein und Organisation in einer bestimmten Weise wahrzunehmen. ” 8 Das Engagement professioneller Historiker im Rahmen von Arbeiter- bzw. Erwachsenenbildung hatte maßgeblichen Anteil an der in den sechziger Jahren entstehenden „ History Workshop ” - Bewegung.9
Nach den Enthüllungen der menschenverachtenden Vorgänge in der Stalinära und ihrer offiziellen Verurteilung durch den XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 kam es in den folgenden Monaten zu einer tiefgreifenden Krise des Realsozialismus und den kommunistischen Parteien Westeuropas, von der auch die britische KP nicht verschont blieb. Im Juli 1956 veröffentlichten Thompson und John Saville die erste unabhängig vom Parteiverlag erscheinende Ausgabe der Zeitschrift The Reasoner, worin sie eine ernsthafte, umfassende offene Debatte über die Ursachen des Stalinismus und das lange Schweigen der britischen KP sowie eine Demokratisierung derselben forderten. Mit der Namensgebung der Zeitschrift sollte an spezifische Traditionen der frühen englischen Arbeiter- und Handwerkerbewegung erinnert werden, denn The Reasoner hießursprünglich die Zeitschrift des Sekretärs der jakobinischen London Corresponding Society (LCS), John Bone.10 Im September 1956 wurden die beiden Herausgeber vom Parteivorstand dazu angehalten, die Zeitschrift einzustellen. Als überzeugte Kommunisten und langjährige engagierte Mitglieder der KP fiel die Entscheidung anfänglich gegen die weitere Veröffentlichung „ zum Wohle der Partei ”. Mit den Ereignissen in Ungarn im Oktober 1956 jedoch gaben Saville und Thompson die Hoffnung auf, die Parteilinie verändern zu können. Die letzte Ausgabe des The Reasoner ging zum Zeitpunkt der sowjetischen Intervention in Druck: „‘ Angesichts der Rauchwolken in Budapest ‘ schrieb Thompson, daßkein Kapitel in der Geschichte des internationalen Sozialismus tragischer sein könne als eine Situation, in der das ungarische Volk durch die Vergehen einer kommunistischen Regierung in die Arme der kapitalistischen Mächte getrieben würde. Er appellierte an die ‚ Kommunistische Partei, meine Partei ‘ , die ungarischen Arbeiter zu unterstützen: ‚ Unsere Führer sollten sich ihres Schweigens schämen! ‘” 11 Einem Parteidisziplinarverfahren kamen Thompson und Saville durch Austritt aus der KP zuvor.
Im Sommer 1957 gründeten Thompson und Saville den The New Reasoner, eine Vierteljahreszeitschrift mit dem Untertitel „ A Journal of Socialist Humanism ”. Stalinismuskritik, die Erneuerung des Marxismus und die Solidarität mit den östlichen Dissidenten waren zentrale Themen von The New Reasoner. Neue Perspektiven für die heimatlos gewordenen, ihrem Selbstverständnis nach „ demokratischen Kommunisten ” oder „ sozialistischen Humanisten ” eröffnete die sich 1958 formierende Campaign for Nuclear Disarmament (CND), von der man sich als populäre Protestbewegung sozialistisches Potential versprach. 1960 schloßsich der New Reasoner mit der Zeitschrift Universities and Left Review (ULR) zusammen. Letztere war ebenfalls 1957 gegründet worden, ihre Herausgeber - im Durchschnitt zehn Jahre jünger als die des New Reasoner - entstammten weitgehend dem Spektrum der studentischen Linken. Die Zielsetzung der ULR war weniger die Aufarbeitung des Stalinismus als vielmehr der Versuch, Kapitalismuskritik mit moderner Kulturkritik zu verbinden. Auf der anderen Seite hatten Kulturanalyse und Kulturpolitik im Kreis um den New Reasoner als Konsequenz aus den Enthüllungen über den Stalinismus und der Kritik am ökonomischen Reduktionismus eine Aufwertung erfahren. Lin Chun beschreibt die Unterschiede der beiden Zeitschriften wie folgt: „ Auf der einen Seite die kommunistische Tradition und die antifaschistische Bewegung, zu der sich eine von den Industriegebieten des Nordens (hauptsächlich Yorkshire) geprägte Politik der Arbeiterklasse gesellte (The New Reasoner), auf der anderen Seite die Politik des Oxbridge-Mittelschichtsradikalismus in Kombination mit der Londoner Metropolenkultur, die zu einem gewissen Teil die ULR- Gruppe kennzeichnete. Die zuerst genannte Haltung kann als ‚ klassisch ‘ bezeichnet werden, die letztere als ‚ modernistisch ‘ . ” 12 Die maßgebliche Initiative zum Zusammenschlußder beiden Zeitschriften als New Left Review ging nicht zuletzt auch von Thompson selbst aus, der auf der Gründungsveranstaltung seiner Hoffnung auf eine künftige Massenbewegung, die auf dem neuen Zeitschriftenprojekt und ihren Clubs basieren würde und mit der die Mentalität und vielleicht sogar die Organisation der Labour Party revolutioniert werden könne, Ausdruck verlieh. Tatsächlich versprach der Zusammenschlußmit der ULR das notwendige Potential an Anziehungskraft und Einfluß, um die angestrebte marxistische Erneuerung mit neuem Leben zu füllen. Denn die ULR bediente mit ihrer auch Jugendkultur, avantgardistische Kunst und Lebensstil umfassenden Themenpalette ein Netzwerk ‚eigener‘, gut besuchter Clubs und erreichte mit über 8000 Exemplaren pro Ausgabe eine wesentlich höhere Auflage als der New Reasoner (nur 2500-3000). Zum Herausgeber der New Left Review wurde einstimmig Stuart Hall gewählt. Die Debatten, die im Rahmen der New Left Review geführt wurden, drehten sich um die Kultur der Arbeiterklasse, die Auswirkungen von Massenkultur auf die Arbeiterschaft, um die Frage, ob es überhaupt noch eine Arbeiterklasse gibt, um die Frage, wie spezifisch englische Traditionen und Denkformen im Verhältnis zum Klassenantagonismus zu gewichten seien, ebenso wie um Probleme von Klassenkampf, gesellschaftlicher Veränderung und der Rolle der Labour Party, von Antimilitarismus und Blockfreiheit usw.13
1961/62 geriet die New Left Review in eine Krise. „ Von Anfang an litt die Qualität der Review unter beträchtlichen Unklarheiten hinsichtlich ihres Zwecks und ihrer Ausrichtung. In endlosen Diskussionen setzten sich die Mitglieder der Redaktion mit der Frage auseinander, ob sie nun eine politische Bewegung organisierten oder eine Zeitschrift herausgaben. Die zunehmenden Spannungen zwischen den Generationen spiegelten sich in der fehlenden Kohärenz der NLR, die versuchte, zwischen den verschiedenen Auffassungen eine Balance herzustellen. Der Druck auf denüberarbeiteten Stuart Hall war enorm ” . 14 Die Krise der New Left Review, die Übergabe der Herausgeberschaft an den 22jährigen Perry Anderson und die damit einhergehende komplette Umbildung der Redaktion sind Ausdruck des Übergangs von der älteren zur jüngeren Neuen Linken in Großbritannien, der von heftigen innerlinken Auseinandersetzungen begleitet war. Thompson verließim tiefgreifenden Dissens mit Perry Anderson und Tom Narin, bei dem in der Folgezeit nicht nur über das Politikverständnis der Neuen Linken in England, sondern darüber hinaus über die Grundlagen des historischen Materialismus und die Methode einer marxistischen Geschichtsschreibung gestritten wurde15, 1963 die Redaktion der New Left Review.
Die jüngere Neue Linke der 1960er mit ihrem Höhepunkt 1968 blieb Thompson fremd. 1978 bemerkte Thompson rückblickend zu den innerlinken Umbrüchen in Großbritannien Anfang der 1960er Jahre: „ Dann kam der Übergang zu einer zweiten neuen Linken. Gleichzeitig trat ein intellektueller Wandel ein, der in meinen Augen unglücklich war. Expressive Praxis, Praxis als Selbstdarstellung wurde höher bewertet als eine rationalere, mehr kommunikative Praxis, und gleichzeitig entwickelte sich - besonders in Westeuropa- eine Anzahl hochreflektierter Marxismen, die wie mir schien, einen theologischen Charakter annahmen. [...] Dem folgte eine besonders turbulente Periode in den späten sechziger Jahren, als eine intellektuelle Bewegung existierte, die von breiteren Volksbewegungen getrennt war, die in einem gewissen Sinn aus ihrer Isolation eine Tugend machte und nichts unternahm, um mit der Arbeiterbewegung und anderen gr ößeren Volksbewegungen eine Kommunikation aufzubauen. ” Auf der anderen Seite seien die Anliegen der Studentenbewegung, insbesondere das Engagement gegen den Vietnamkrieg, so Thompson, wichtige linke Anliegen gewesen, aber am expressiven, „ von sich selbst berauschten Stil der Gesten ” sei die zweite Neue Linke „ sofort als revoltierendes Bürgertum ” erkennbar gewesen.16 Die jüngere New Left kritisierte vor allem den „ Kulturalismus ” der ursprünglichen New Left, bemängelte fehlende marxistische Theoriebildung und behauptete, die alte New Left sei letztlich nie über den Rahmen traditioneller Sozialkritik hinausgegangen. Doch diese Auseinandersetzungen, insbesondere die oben erwähnte Kontroverse zwischen Thompson und Anderson gehören zur Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte von Thompsons 1963 in englischer Erstausgabe erschienener „ The Making of the English Working Class ” in der britischen Linken, die nachzuzeichnen den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde.
Für die Frage, in welchem Kontext MEWC entstand, oder wie Thomas Lindenberger formuliert, „ Wer schreibt da gegen wen und unter welchen ideologischen und politischen Bedingungen? ” 17 , bleibt festzuhalten, daßThompson einerseits als engagierter Marxist18, mit seinem Buch die „ vorherrschenden Orthodoxien ” der bürgerlichen Geschichtsschreibung in Frage stellte: „ Es gibt erstens die Fabier-Orthodoxie, die in der großen Mehrheit der arbeitenden Menschen nichts als passive Opfer des laissez-faire sieht [...] . Zweitens gibt es die Orthodoxie der empirischen Wirtschaftshistoriker, in der die arbeitenden Menschen als Arbeitskräfte, Wanderarbeiter oder Daten für Statistiken vorkommen. Drittens haben wir die Pilgrim ´ s Progress-Orthodoxie, die die Geschichte nach Vorläufern und Pionieren des Wohlfahrtsstaates durchstöbert [...] . Der ersten und der zweiten Orthodoxie werfe ich vor, daßsie dazu neigen, daßaktive Handeln der arbeitenden Menschen, das Ausmaß, in dem sie [...] die Geschichte mitgeprägt haben, zu gering zu bewerten. Mein Einwand gegen die dritte Orthodoxie besteht darin, daßsie Geschichte im Lichte späterer Interessen interpretiert [...] - man erinnert sich nur an die Erfolgreichen [...] ; die verlorenen Kämpfe und die Verlierer selbst werden vergessen. ” 19 Ebenfalls aus seinem marxistischen Selbstverständnis heraus wendete sich Thompson gegen sozialwissenschaftliche Theorien, die den Klassenbegriff zu entschärfen suchen, wie z.B. die eines Ralfs Dahrendorfs, den er im Vorwort von 1963 explizit zitiert.
Andererseits schrieb Thompson als dissidenter Kommunist und Aktivist der ersten Neuen Linken in Großbritannien mit MEWC gegen marxistische Orthodoxien vor allem sowjet-marxistischer Provenienz: „ Man neigt heute allenthalben zu der Annahme, Klasse sei etwas Konkretes, Reales20. Diese Auffassung findet sich in Marx ’ historischen Schriften nicht; aufgrund dieser falschen Interpretation sind allerdings viele spätere ‚ marxistische ‘ Analysen unbrauchbar. ‚ Sie ‘ , die Arbeiterklasse existiert, wie es dann heißt, tatsächlich, und man kann diese Existenz nahezu mathematisch definieren [...]. Wenn man von dieser Annahme ausgeht, l äßt sich das Klassenbewußtsein ableiten, daß‚ sie ‘ haben m üßte [...] , wenn ‚ sie ‘ sich ihrer eigenen Lage und ihrer wirklichen Interessen hinreichend bewußt wäre. Es gibt einen kulturellen Überbau, der diese Einsicht in einem ungenügenden Maße verbreitet. Da diese kulturellen Verzögerungen und Entstellungen nur Schwierigkeiten mit sich bringen, l äßt man sie leicht links liegen und geht zu einer Substitutionstheorieüber: Nun sind es Partei, Sekte oder Theoretiker, die das Klassenbewußtsein ans Licht bringen, und zwar nicht so wie es ist, sondern wie es sein sollte. ” 21
3. Anmerkungen zur Thompson-Rezeption in Deutschland
Nimmt man Übersetzungen, Besprechungen oder Aufsätze als Indizien für die Thompson-Rezeption in der Bundesrepublik, so setzt diese in der bundesdeutschen Historikerzunft erst vergleichsweise spät ein. Nach dem Erscheinen von MEWC 1963 bespricht als einziger namhafter deutscher Historiker der DDR-Wissenschaftler Jürgen Kuczynski im Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1965 die Thompsonsche Studie. Zu einer Zeit, da englische Geschichtsstudenten dank der bemerkenswerten Tradition britischer marxistischer Geschichtsschreibung bereits um eine Auseinandersetzung mit sozialistischen Interpretationen nicht herumkamen, emanzipierte sich die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft nach der sog. Fischer-Kontroverse 1961 gerade erst von den bis dahin weitgehend vorherrschenden autoritären Traditionen des deutschen Historismus. Unter den günstigen Bedingungen eines massiv vorangetriebenen Ausbaus des Hochschulwesens etablierte sich Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre in der BRD eine Sozialgeschichte, die zunächst weitgehend von der geschichtswissenschaftlichen Konzeption Hans-Ulrich Wehlers und Jürgen Kockas dominiert wurde. Ihr Projekt der „ Historischen Sozialwissenschaft ” , die sogenannte Bielefelder Schule , stellte die Analyse gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen in den Vordergrund und war - folgt man Thomas Welskopp - unter anderem gekennzeichnet durch „ normative Westbindung, politischen Aufklärungsanspruch, Ideologiekritik, Theorieorientierung, Strukturalismus, Systemdenken ” und „ Modernisierungsperspektive ”.22
Seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre mußte sich die Historische Sozialwissenschaft zunehmend der Herausforderung durch die im Entstehen begriffene Alltagsgeschichte stellen. Diese kritisierte vor allem das affirmative Verhältnis der Bielefelder zu modernisierungstheoretischen Prämissen, das die Kosten des Fortschritts übersieht sowie die „ Strukturlastigkeit ” der Historischen Sozialwissenschaft hinter der die konkreten historischen Subjekte, ihre Erfahrungen und ihre Lebenswelten verschwänden.23
Maßgeblich inspiriert wurden die Kritik der Alltagshistoriker und ihre Forderung nach stärkerer Berücksichtigung sozialanthropologischer Perspektiven in der Geschichtswissenschaft unter anderem durch intensive Auseinandersetzung mit der Mentalitätsgeschichte der französischen Annales-Schule, den Arbeiten des US- amerikanischen Soziologen Cliford Geertz und des französischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu, den Strukturalisten um Louis Althusser und Michel Foucault sowie schließlich den Arbeiten anglo-marxistischer Sozialhistoriker, und hier nicht zuletzt denen E.P. Thompsons. Zu den Protagonisten der Alltagsgeschichte zählen z.B. die Historikergruppe um Hans Medick und Alf Lüdtke am Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte oder Lutz Niethammer in Essen. Auf Interesse stießen Thompsons Arbeiten auch im Rahmen der zwar eng mit der Alltagsgeschichte verknüpften, aber eigenständigen deutschen Geschichtswerkstättenbewegung der ersten Hälfte der achtziger Jahre.24
Mit Ausnahme der bereits 1973 vorliegenden Übersetzung des 1967 in „ Past and Present “ erschienenen Thompson-Aufsatzes „ Time, Work-discipline and Industrial Capitalism ” in dem von dem Schweizer Historiker Rudolf Braun u.a. herausgegebenen Sammelband „ Gesellschaft in der industriellen Revolution “ wurden Thompson-Aufsätze erst im Zuge der Entwicklung der Alltagsgeschichte vermehrt ins Deutsche übersetzt. 1979 erschien, sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung, in der Zeitschrift Past and Present Thompsons wohl mit Abstand meist rezipierter Aufsatz „ The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century ” 25 in deutscher Übersetzung in einem von Detlef Puls herausgegebenen Sammelband mit dem Titel „ Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert”. Ein Jahr später wurde ein Sammelband Thompsonscher Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19.Jahrhunderts in deutscher Übersetzung von Dieter Groh herausgegeben. Bemerkenswert für unseren Zusammenhang ist, daßder Herausgeber selbst zu diesem Zeitpunkt (1980) Thompson „ beinahe immer noch als Geheimtip unter Experten ” einschätzte und der deutschen Sozialgeschichte eine weitgehende „ Abstinenz ” und ein „ Nichtzurkenntnisnehmen ” Thompsonscher Arbeiten und Forschungsperspektiven bescheinigte.26
In der Folgezeit wuchs die Zahl von Sammelbänden oder Monographien zu diversen Aspekten der Sozialgeschichte der Unterklassen im 18. und 19. Jahrhundert, in deren Einleitungen auf Thompsons MEWC oder sein „moral-economy”-Konzept verwiesen wurde27, und kaum eine Abhandlung über Alltagsgeschichte, historische Anthropologie oder auch Sozialgeschichte im allgemeinen konnte sich noch einer Würdigung Thompsons versagen28. Die Suche nach ausführlicheren deutschsprachigen Auseinandersetzungen mit dem Thompsonschen Ansatz führt aber, von einigen Ausnahmen abgesehen, zu linksakademischen Zeitschriften wie „ PROKLA - Probleme des Klassenkampfes. Zeitschrift für politische Ökonomie und sozialistische Praxis ”, „ Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften ” , „Ä sthetik & Kommunikation. Beiträge zur politischen Erziehung ” , aber auch „ Autonomie. Neue Folge. Materialien gegen die Fabrikgesellschaft ” als zu sich ausschließlich historiographisch verstehenden Publikationen.
Bereits 1970 wurde MEWC Interesse aus den Reihen der gerade zerschlagenen Studentenbewegung entgegengebracht: Mit einem expliziten Verweis in der Einleitung auf die „ aktuelle Problemstellung ”, daßder „ Weg der sozialen Bewegungen [...] auch heute noch durch viele Täuschungen und Selbsttäuschungen hindurch ” gehe, und der Forderung nach einer „ Zeitperspektive [emanzipatorischer Prozesse, E.G.] aufs Übermorgen ” erschien die Dissertation des Politikwissenschaftlers Michael Vester mit dem Titel „ Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess ”, die in weiten Teilen Thompsons MEWC zur Grundlage hat29. Hatte Vesters Veröffentlichung, die mehrere Auflagen sowie eine Übersetzung ins Dänische erlebte, auf die unmittelbare Forschungspraxis im Bereich der Arbeitergeschichte keinen Einfluß, da sie - so Thomas Lindenberger - ‚lediglich‘ „ eine zeittypische Mixtur aus studentenbewegtem Seminarmarxismus und Second-Hand- Geschichte ” wäre 30 , so war sie längerfristig offenbar keineswegs folgenlos. Dieter Groh beispielsweise hat sie nach eigenem Bekunden zur Lektüre von MEWC angeregt.31
Den Debatten der britischen New Left gehörte auch in der Folgezeit Vesters Aufmerksamkeit. Als Redaktionsmitglied des Zeitschriftenprojektes „Ä sthetik & Kommunikation ” schrieb er u.a. zur Arbeiterkultur und zum Kulturbegriff der britischen Linken sowie über E.P. Thompson als anglo-marxistischen Historiker.32 1980 gab Vester gemeinsam mit dem Institut für sozialhistorische Forschung in Frankfurt Thompsons „ The poverty of Theory and Other Essays ” in deutscher Übersetzung heraus. In der Einleitung dazu wandte sich Vester deutlich gegen eine entpolitisierte Rezeption Thompsons und gegen solche Fachhistoriker, die Arbeiterkultur lediglich als Forschungsthema und nicht „ als politische Frage nach einer Gegenkultur mit antikapitalistischer Potenz ” verstanden wissen wollten.33
Selbstredend galt das Interesse der genannten linksintellektuellen Zeitschriften weder allein Thompson noch vornehmlich seinem historischen Werk. Vielmehr erhofften sich die Redaktionen von der Rezeption französischer und britischer Linksintellektueller eine Befruchtung der neulinker Diskussionen in der Bundesrepublik über Kultur und Bewußtsein der Arbeiterklasse angesichts der Stagnation der traditionellen Arbeiterbewegung, des Aufschwungs der sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen und der damals in Mode kommenden diversen „ Abschied [e] vom Proletariat ” (Gorz). Im Rahmen dieser als „ Krise des Marxismus “ (Althusser) verhandelten Debatten seit Ende der Siebziger wurden beispielsweise von der „Ä sthetik & Kommunikation ” und dem „ Argument ” Autoren aus dem Umfeld des britischen Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) 34 übersetzt oder wollte die Redaktion der Prokla die von ihr veröffentlichten Beiträge z.B. des Soziologen Wilfried Spohn zu den Debatten und Ideen der britischen Linken verstanden wissen.35
Manch einer der linksintellektuellen Protagonisten der bundesdeutschen Thompson- Rezeption scheint sich allerdings im Laufe der achtziger Jahre nicht nur vom Proletariat sondern - nach einem Intermezzo, dessen Orientierung Neue Soziale Bewegungen hieß- am Ende auch vom linken Selbstverständnis verabschiedet zu haben, wie in Manfred Gailus‘ und Thomas Lindenbergers Rückblick von 1994 auf zwanzig Jahre „ moralische Ökonomie ” angedeutet wird: „ Man sah darin [im moral-economy- Konzept, E.G.] die sozialhistorische Rekonstruktion [...] einer vor- bzw. nicht- marktwirtschaftlichen Ökonomie. Das wurde als historischer Nachweis der Möglichkeit und zugleich als Vorschein einer anzustrebenen postmarktwirtschaftlichen Ökonomie, sprich Sozialismus, aufgefaßt. Ein nicht geringer Teil der Faszination rührte sicherlich aus dieser Lesart, die aber den tatsächlichen Gehalt des Artikelsüberforderte und spätestens mit den Zusammenbrüchen nichtmarktwirtschaftlicher Ökonomien der jüngsten Zeit weithin verflogen seien dürfte. ” 36
In der Tat haben Randströmungen der bundesdeutschen Linken versucht, den Thompsonschen Ansatz für eine Analyse der Gegenwart fruchtbar zu machen, wenn auch nicht in dem von Lindenberger und Gailus verkürzten Sinn. So setzte sich die Redaktion der „ Autonomie Neue Folge ” intensiv mit Thompsons Klassenbegriff und seinem „ moral-economy ” - Konzept auseinander. Sie versuchte vor dem Hintergrund, daßzwischen vor- und frühindustrieller Massenarmut des 19.Jahrhunderts „ und der trikontinentalen Armut eine epochale Analogie besteht - und zwar hinsichtlich des Umbruchs der Gesellschaftsformationen [...] wie der Formen und Forderungen von sozialen Bewegungen ” , den Thompsonschen Ansatz für die Wiedergewinnung eines Proletariatsbegriff, „ der sich der sozialhistorischen Realität versichert und weder kategorial ist noch von einer politischen Bildungskonzeption getragen wird ” weiterzuentwickeln. Vor allem das letzte abschließende Heft Nr.14 (1985), mit dem es der Redaktion der Autonomie NF gelang, Thompson über die engeren linksintellektuellen und akademischen Kreise hinaus in Teilen der aus der Jugendrevolte 1980/1981 hervorgegangenen autonomen Linken zu einem Begriff zu machen, widmete sich intensiv der Geschichte der sozialen Bewegungen 1789 und 1848 in der Überzeugung, daßaus „ dem Material [...] der Sozialgeschichte keine politische Strategie zu zimmern ist ” , aber in der Hoffnung, daßein „ radikal veränderter Geschichtsbegriff “ helfen könnte „ eine neue sozialrevolutionäre Praxis frei [zu] setzen ” . 37
Es sei dahingestellt, inwieweit dabei - wie Gailus und Lindenberger meinen - Thompsons „ moral-economy ” -Konzept oder auch sein Klassenbegriff manches Mal überstrapaziert wurde. Tatsache bleibt, daßThompson selbst eine Geschichtsschreibung, die Vergangenheit allein aus der Perspektive der Sieger interpretiert, grundsätzlich kritisierte. So heißt es beispielsweise im Vorwort zur „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ”, daßdie verlorenen Kämpfe der arbeitenden Menschen in der Industriellen Revolution „ vor der ungeheuren Arroganz der Nachwelt “ gerettet werden sollten, und zwar auch jene, „ die im Lichte der nachfolgenden Entwicklung ” zweifelhaft erscheinen mögen. Schließlich stünden auch wir „ nicht am Ende der gesellschaftlichen Entwicklung ”, so daßdie lost causes der Vergangenheit möglicherweise „ Einblicke in die sozialen Mißstände, die es immer noch zu beseitigen gilt ” , vermitteln könnten.38 In diesem Sinne ist Gailus und Lindenbergers Verweis auf den Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus in Osteuropa alles andere als ein Argument gegen eine politisch engagierte „Lesart” Thompsons.
Als 1987, 24 Jahre nach der englischen Erstausgabe von MEWC und nach einem gescheiterten Versuch der Europäischen Verlagsanstalt Ende 1981, eine deutsche Ausgabe zu veröffentlichen39, „ Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ - übersetzt von Lotte und Mathias Eidenbenz, Christoph Groffy, Thomas Lindenberger, Gabriele Mischkowski und Ray Mary Rosdale - bei Suhrkamp erschien, hatte die bundesdeutsche Thompson-Rezeption ihren Zenit bereits überschritten. „ Was die deutschen Historiker angeht ” , urteilte Günther Lottes anläßlich des Erscheinens der deutschen Übersetzung, „ mußdie Thompson-Rezeption wohl als abgeschlossen gelten ” . 40 Dem widersprach zwar Hans Medick in einem Aufsatz von 1997 vehement41, tatsächlich gingt aber die deutschsprachige Publikationstätigkeit zu Thompson in den neunziger Jahren deutlich zurück. Laut Klappentext richtete sich jedenfalls die Übersetzung von 1987 weniger an ein wissenschaftliches Spezialpublikum als an eine breite historisch interessierte Leserschaft. Ob das gelungen ist, bleibt allerdings fraglich, da dem Leser weder hinreichende Informationen über den Autor und seine Wirkungsgeschichte mit auf den Weg gegeben werden noch der Anmerkungsapparat der Übersetzer das zum Verständnis des deutschen (Durchschnitts-)Lesers notwendige Gerüst an Wissen zur englischen Geschichte bereitstellt. Die einem breiteren Publikum entgegenkommende ursprüngliche Taschenbuchausgabe hat der Verlag gegenwärtig zugunsten einer mehr als doppelt so teuren gebundenen Ausgabe aus dem Programm genommen.
4. „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse”
a) Darstellungsweise
Die zweibändige, knapp tausend Seiten starke deutsche Ausgabe von MEWC mit dem Titel „ Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse” gliedert sich entsprechend dem englischen Original in drei Teile. Schon der Blick in das Inhaltsverzeichnis deutet an, daßdas vorliegende Werk sich einer narrativen, eher literarischen, mit einer figurativen Sprache arbeitenden Geschichtsschreibung bedient. So finden sich Überschriften wie beispielsweise „ Der Freiheitsbaum ” (Teil I), „ Adams Fluch ” (Teil II), „ Christian und Apollyon ” (Kap.2), „ Die Myriaden der Ewigkeit ” (Kap. 12, IV) oder „ Die Armee der Gerechten ” (Kap.14). Hans Medick bescheinigt Thompson einen „ höchst kunstvollen ” Schreibstil42, Michael Vester spricht von einer „ epischen Form “, durch die die Leser „ das Leiden und die Kämpfe der Handelnden miterleben können “ 43 und Karl-Heinz Roth charakterisiert Thompsons MEWC als „ unförmiges Konvolut ohne alle tabellarischen, sozialstatistischen oder kartographischen Hilfsmittel, eine ganz aus der Quellenemperie geschöpfte hermeneutische Re-Konstruktion, in der es von Dialekten, unverständlich gewordenen frühproletarischen Begriffswelten und Dichterzitaten nur so wimmelt ” . 44 Vergeblich wird der Leser von Thompsons „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” nach einem einleitenden theoretisch-begrifflichen Rahmenkapitel suchen und wer das Vorwort überschlägt, findet sich unvermittelt auf der Gründungsveranstaltung des Londoner Jakobinerclubs „ London Correspondending Socitety ” (LCS) wieder. Thompson selbst sprach in einem Interview von 1978 hinsichtlich seiner MEWC von „ meiner ziemlich respektlosen Haltung gegenüber akademischen Gepflogenheiten ”, die u.a. daher rühre, daßer - wie bereits oben erwähnt - nicht zuletzt die Debatten mit den Teilnehmern seiner Kurse zur Erwachsenbildung vor Augen hatte.45 Wer nun daraus schließt Thompsons „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” sei dann wohl gerade eine für den Laien leicht verständliche „Gute-Nacht-Lektüre”, wird allerdings eines Besseren belehrt. Vielmehr ließe sich umgekehrt „ Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” als ein Indiz für das hohe Bildungs- und Diskussionsniveau in den Kursen der Workers’ Education Association bezeichnen. So hält sich Thompson beispielsweise gar nicht erst mit allgemeinen Bemerkungen dazu auf, wer denn z.B. John Bunyan war und worum es in seinem „ The Pilgrim ’ s Progress ” geht, sondern bespricht gleich dessen Bedeutung für den plebejischen Radikalismus. Thompsons „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” ist also weder ein anspruchsloses noch theorieloses Werk. Allein erkenntnisleitende Fragestellungen, methodische Reflexionen oder theoretisch-begriffliche Überlegungen werden nicht in extra ausgewiesenen Kapiteln angestellt, sondern sind eingeflochten in die Beschreibung von prozessualen Veränderungen, von Traditionen, politischen Ideen, Kämpfen und Erfahrungen der sich zur Arbeiterklasse formierenden englischen Unterschichten, kurz: Reflexion und Beschreibung, theoretische Passagen und Erzählung sind weitgehend miteinander verknüpft. Ein Zugang zu Thompsons Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen ist also ohne Lektüre des - wie Lindenberger schreibt - „ Wustes an Anekdoten, literarischem und biographischen Material “ 46 nicht zu haben. Zwar hat Thompson im Vorwort und im Nachwort von 1968 einige generalisierende Aussagen formuliert, beide - im Forschungs- und Schreibprozeßeben auch das sogenannte Vor wort - sind letztlich nachträgliche Theoretisierungen, zumal vor dem Hintergrund von Thompsons explizit hermeneutischer Methode. Ich werde deswegen Thompsons Aussagen aus Vor- und Nachwort erst im fünften Abschnitt vorstellen.
b) kursorischer Überblick
Der erste Teil der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” mit dem Titel „ Der Freiheitsbaum ” scheint auf den ersten Blick recht wenig mit „der Arbeiterklasse” im eigentlichen Sinn zu tun zu haben. Aus der anfänglichen unvermittelt erscheinenden knappen Schilderung der ersten Zusammenkunft der LCS 1792 und des Hochverratsprozesses gegen ihre Gründungsmitglieder 1794 entwickelt Thompson folgende Fragen: Läßt sich angesichts der sozialen Zusammensetzung und beruflichen Struktur, der fließenden Grenzen zwischen Gesellen und Kleinmeistern, zwischen abhängig Arbeitenden und Kleinunternehmern, die Behauptung, die LCS sei die erste wirkliche politische Organisation der Arbeiterschaft, halten? Wie neu war der Bruch der LCS mit „ der jahrhundertealten Gleichsetzung von politischen und Eigentumsrechten ” ? Inwieweit wirkten Traditionen der Levellers des 17. Jahrhunderts fort? Welche Rolle spielte die Französische Revolution, welche die Industrialisierung? Aufgrund welcher Faktoren gewannen diese Ereignisse derart rasant an Bedeutung? Kurz, wo hat eine Geschichte der Entstehung der englischen Arbeiterklasse überhaupt zu beginnen? „ Man mußdie fortwirkenden Traditionen und den veränderten Zusammenhang verstehen ” 47, leitet Thompson den ersten Teil der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” ein. Dieser Prämisse folgend, widmet sich Thompson in den folgenden drei Kapiteln den ambivalenter Tradition religiöser Sekten, dem Charakter verschiedener Krawalle und Unruhen des 18. Jahrhunderts sowie den Möglichkeiten und Grenzen der, seit dem Revolutionskompromißvon 1688 im reformerischen Lager vorherrschenden antiabsolutistischen Ideenkomplexes.
Dabei geht es Thompson darum, sowohl fortwirkende Traditionsbestände als auch Modifikationen, prozessuale Veränderungen und Brüche auszuloten. Was blieb von den teilweise libertär-antiautoritären und kommunitären Elementen der sich einer Eingliederung in die englische Staatskirche widersetzenden, eher nüchtern-rationalen älteren Dissenter Sekten des 17. und 18. Jahrhunderts und wo und warum konnte sich demgegenüber der jüngere, eher spirituelle Methodismus mit seinem politisch- regressiven, autoritären und disziplinierenden Charakter durchsetzen? Oder: Von welchen Traditionen waren die Krawalle und Unruhen des 18.Jahrhunderts bestimmt und wo gab es bedeutende Verschiebungen? Da Thompson in diesem letzteren Zusammenhang erstmals den Begriff der „ moralischen Ökonomie ” verwendet, den er in späteren Arbeiten zu einem eigenständigen Theorem ausarbeitet, kurz einige Sätze mehr zu diesem dritten Kapitel der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ”.
In seinen Untersuchungen von spontanem Aufruhr und Riots im 18. Jahrhundert unterscheidet Thompson in Anlehnung an George Rudé zwischen „ revolutionärer Volksmenge ” und funktionalisierter Volksmenge im Sinne „ gekaufter Banden, die im Auftrag außenstehender Interessengruppen handeln ” (S. 68). Zu ersteren zählen nach Thompson vor allem Brot- und Lebensmittelunruhen, deren Motive über den Hunger hinaus reichten, wie der vergleichsweise kontrollierte und Elemente von Organisation und Planung aufweisende Charakter der Lebensmittelunruhen zeige. In ihnen käme die Verteidigung einer älteren paternalistischen Ökonomie zum Ausdruck. Deren Kennzeichen waren beispielsweise Regelungen von Preis, Größe und Beschaffenheit des Brotes durch einen komplizierten Mechanismus von Gesetzgebung und Brauchtum oder auch die Tradition des persönlichen Aushandelns der Lohnhöhe am Maßstab der Subsistenz. Brotunruhen richteten sich demnach immer auch gegen die ausschließliche Unterwerfung von Lebensmittelpreisen und Löhnen unter das Diktat des freien Marktes. Sie werden von Thompson als Verteidigung einer älteren „ moralischen Ökonomie “ gegen die politische Ökonomie des Kapitalismus interpretiert (S. 68-74). Demgegenüber erscheinen die von außenstehenden Interessengruppen initiierten Ausschreitungen - „ In einem Land, daßkaum Polizei kannte, war ein ‚ Mob ’ eine sehr nützliche Ergänzung für den Friedensrichter “ (S. 74) - auf den ersten Blick ausschließlich konterrevolutionär. Tatsächlich bekamen sie aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - so Thompson - zunehmend einen ambivalenten, „ subpolitischen “ Charakter, da sie schnell außer Kontrolle geraten konnten. So richteten sich die antikatholischen Gordon-Riots der 1780er Jahre in London innerhalb kürzester Zeit nicht mehr im Sinne des Anstifters, der „ Protestant Association ” des Lord George Gordon, gegen katholische Kirchen und katholische Amt- und Würdenträger, sondern die aufgebrachte Volksmenge stürmte das Gefängnis und unternahm schließlich sogar einen Angriff auf die Bank von England. Auch hinsichtlich der antijakobinischen Church-and-King-Ausschreitungen in Birmingham 1791 kommt Thompson zu dem Schluß, daßes nicht immer klar war, „ ob nun reiche Dissenter angegriffen wurden, weil sie Dissenter oder weil sie reich waren ” . Beide sind nach Thompson Beispiele für einen „ Mob im Übergang, im Begriff, eine selbstbewußte Masse von Radikalen zu werden ”. So hätte es nach der Französischen Revolution kein Politiker oder Ratsherr mehr gewagt, „ sich mit derlei gefährlichen Kräften einzulassen ” (S. 75-80).Und weiter: „ Die Reformer fürchteten [bei Kriegsende 1815, E.G.] den ‚ Mob ‘ nicht mehr, während die Behörden sich gezwungen sahen, Kasernen zu errichten und andere Vorsichtsmaßnahmen gegen die revolutionäre Volksmenge zu ergreifen. Dies ist eine jener Tatsachen der Geschichte, die so unbedeutend sind, daßsie leichtübersehen werden oder einfach voraus gesetzt werden; sie zeigt jedoch eine erhebliche Verschiebung im nicht artikulierten ‚ subpolitischen ‘ Verhalten der Massen an.” (S. 85)
Auch hier geht es also Thompson vor allem darum, Traditionen und ihre Modifikationen im Verhältnis zum (durch das Vordringen des Marktes, die Französische Revolution usw.) veränderten gesellschaftlichen Kontext zu beschreiben. Die „ Vielschichtigkeit fortwirkender Traditionen “ (S. 27) soll auch das Kapitel „ Der freigeborene Engländer ” verdeutlichen, in dem Thompson die seit dem Revolutionskompromißvon 1688 vorherrschende antiabsolutistische Rhetorik des konstitutionalistischen Radikalismus und ihre Überwindung durch Thomas Paine 1792 betrachtet. Dessen Schrift „ Rights of Man ” bewertet Thompson als grundlegenden Text der englischen Arbeiterbewegung, der für knapp einhundert Jahre neue Maßstäbe setzte: „ Es gab zwar Perioden, etwa auf dem Höhepunkt der Oweniten- und Chartistenbewegung, in denen andere Traditionen dominierten, aber nach jedem Rückschlag blieb der Kern der Paineschen Forderung unangetastet. Die Aristokratie war der Hauptgegner ... ” (S. 105). Nach diesem „ langen Umweg ” mit dem Thompson „ die chinesische Mauer ” durchbrechen will, „ die das 18. vom 19. Jahrhundert und die Geschichte der Arbeiterbewegung von der kulturellen und intellektuellen Geschichte derübrigen Nation trennt ” (S. 111) kehrt Thompson im letzten Kapitel des ersten Teils zur Betrachtung des englischen Jakobinismus zwischen 1792 und 1799 zurück. Sein Fazit: „ England unterschied sich von anderen europäischen Ländern insbesondere dadurch, daßder Höhepunkt der konterrevolutionären Einstellungen und Disziplinierungen mit dem Höhepunkt der Industriellen Revolution zusammenfiel [...]. Die Gärung unter den Industriellen und reichen Dissenter-Kaufleuten in Birmingham und den nördlichen Industriestädten fand in den Jahren 1791 und 1792 statt; der Höhepunkt der ‚ Unzufriedenheit ‘ unter den Handwerkern und Lohnarbeitern in London, Norwich und Sheffield - ob als Folge der jakobinischen Agitation oder des Hungers - liegt dagegen im Jahr 1795. Nur im Jahre 1792 liefen beide Bewegungen wenige Monate lang zusammen. [...] Die Geschichte der Reformbewegung zwischen 1792 und 1796 war allgemein gesprochen die Geschichte des Versagens der bürgerlichen Reformer und der raschen ‚ Linkswendung ‘ der plebejischen Radikalen zugleich. ” (S.191 und 196)
Der zweite Teil der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” trägt den Titel „ Adams Fluch ” . In dessen erstem Kapitel mit dem Titel „ Ausbeutung ” und mit schon fast programmatischem Charakter wendet sich Thompson gegen verschiedene Orthodoxien der Wirtschafts- und Sozialgeschichte hinsichtlich der Industriellen Revolution. Zum einen argumentiert er gegen eine unkritische Reproduktion seitens der Sozialgeschichte der um die Mitte des 19. Jahrhunderts ebenso unter radikalen und sozialistischen wie unter konservativen Zeitgenossen verbreiteten Gleichung „ Dampfkraft plus Baumwollspinnerei = Neue Arbeiterklasse ”. Wer die Entstehung der Arbeiterklasse allein mit der Industriellen Revolution erkläre, übersähe leicht die „ Kontinuität politischer und kultureller Traditionen bei der Entstehung von Arbeitergemeinden. [...] Die Entstehung der Arbeiterklasse ist zugleich eine Entwicklung innerhalb der politischen und kulturellen und innerhalb der Wirtschaftsgeschichte. Sie war nicht das automatische Produkt des Fabriksystems. Und genauso wenig sollten wir und eineäußere Kraft vorstellen, die ‚ Industrielle Revolution ’ , die auf ein unbestimmtes, undifferenziertes menschliches Rohmaterial einwirkt und am Ende ein ‚ neue Rasse von Lebewesen ’ hervorbringt. ” (S. 207 u. S. 208-209, Hervorhebung im Original)
Des weiteren wendet sich Thompson gegen eine verengte Perspektive von Arbeiterklasse, die allein auf Fabrikarbeiter rekurriert und betont demgegenüber die Rolle von Handwerkern, von Heimarbeitern bis in die frühen 1830er Jahre sowie der unzähligen unterschiedlichsten kleinen Gewerbetreibenden und Berufstätigen und zwar ohne angesichts der Vielfalt hinsichtlich „ Status, Kenntnissen, Fertigkeiten und Arbeitsbedingungen ” den Begriff der „ Arbeiterklasse ” durch „ arbeitende Klassen ” ersetzen zu wollen. „ Trotzdem ist, bei allen Vorbehalten, das herausragende Ereignis der Periode zwischen 1790 und 1830 die Herausbildung ‚ der Arbeiterklasse ‘ . Dies zeigt sich erstens in der Entwicklung von Klassenbewußtsein: dem Bewußtsein einer Interessenidentität all dieser verschiedenen Gruppen der arbeitenden Bevölkerung untereinander und gegenüber den Interessen anderer Klassen, zweitens in der Entstehung entsprechender Formen politischer und gewerblicher Organisation. 1832 gab es festgefügte und selbstbewußte Institutionen der Arbeiterklasse [...] , eigene intellektuelle Traditionen, Gemeinschaftsformen und eine spezifische Gefühlsstruktur. ” (S.208)
Schließlich opponiert Thompson gegen eine Wirtschaftsgeschichte, die die Industrielle Revolution entlang modernisierungstheoretischer Paradigmen und auf Grundlage quantitativer Methoden vorrangig als eine Erfolgsgeschichte marktwirtschaftlicher Dynamik mit ungeheuren Wachstumsraten und letztlich insgesamt steigenden Lebensstandards interpretiert. Dabei arbeitet er die methodische Fragwürdigkeit von nationalen Durchschnitten heraus und kritisiert mangelndes Hinterfragen scheinbarer Sachzwänge, ohne jedoch die klassische Verelendungstheorie wiederbeleben zu wollen. Vielmehr insistiert er darauf, daßeine Bewertung der Lebensqualität die Erfahrungen der betreffenden Menschen, ihre Bedürfnisse oder Entbehrungen sowohl in materieller als auch in sozialer und kultureller Hinsicht umfassen müsse. „ Es ist sehr wohl möglich, daßsich statistische Durchschnittswerte und menschliche Erfahrungen in entgegengesetzter Richtung bewegen. [...] Während der Periode von 1790 bis 1840 gab es eine leichte Verbesserung des durchschnittlichen Standards. Im gleichen Zeitraum gab es intensivere Ausbeutung, gr ößere Unsicherheit und zunehmendes materielles Elend. ” (S. 227, 228) Die „ leichte Verbesserung des durchschnittlichen Standards ” erlitten die Menschen, so Thompson, als „ katastrophische Erfahrung ” .
Der Untersuchung dieser durch die Industrielle Revolution einschneidend veränderten Erfahrungen, „ aus denen die politischen und kulturellen Ausdrucksformen des Bewußtseins der Arbeiterklasse entstanden ” (S.228) , widmet sich Thompson in den folgenden Kapiteln, in denen er exemplarisch drei große Arbeitergruppen beschreibt: Erstens die Landarbeiter also Bauernknechte, Häusler, ländliche Gelegenheitsarbeiter etc., zweitens die Arbeiter des städtischen Gewerbes, die v.a. als Handwerker in kleinen Werkstätten oder in der eigenen Wohnung, oder als Arbeiter auf der Straße, auf den Bauplätzen oder in den Docks arbeiteten, sowie die ungelernten und Gelegenheitsarbeiter in der Stadt, die sich als Straßenverkäufer, Marktschreier, Balladenkrämer etc. durchschlugen und drittens die Arbeiter und Handwerker der textilen Verlagssysteme in den ländlichen Manufakturdistrikten, wie Weber, Spinner, Tuchscherer, Wollkämmer etc. Dabei arbeitet Thompson detailliert die Differenzen und Statusunterschiede innerhalb der genannten Arbeitergruppen heraus und folgt den Auswirkungen der sich verändernden Arbeits- und Lebensbedingungen bis in die Einzelheiten, beispielsweise der durch Einhegungen fortfallenden Gewohnheitsrechte des Brennholzsammelns, des Abweidens von Stoppelfeldern und des Mähens von Wegrändern und ihre Bedeutung für die Zerstörung der traditionellen „ Zusammenkratz-Subsistenzwirtschaft “ der Armen in den ländlichen Distrikten. Detailliert beschreibt Thompson die Kollisionen zwischen den neuen Verhaltenszumutungen einerseits, denen Handwerker, Landarbeiter und Weber ausgesetzt wurden, und ihren allgemeinen als auch je spezifischen traditionellen Werten, Verkehrsformen, Bräuchen, Ehrbegriffen, Mythen und Träumen andererseits. In diesem Rahmen thematisiert Thompson unterschiedlichste Widerstands- und Verweigerungsformen, und zwar sowohl solche, die bis dahin von der Geschichtswissenschaft eher unter dem Verdikt der Kriminalität verhandelt wurden, wie z.B. Wilderei und Diebstahl, oder deren politischer Gehalt übersehen wurde, wie z.B. Nahrungsmittelrevolten, als auch sogenannte „politische“ oder „ökonomische“ Protestformen wie Petitionen, die Gründung von Interessenverbänden und Streiks. Beschrieben werden sowohl alltägliche Szenarien, wie z.B. die Bedrohung von Armenaufsehern als auch Revolten und Streiks von landesweiter Bedeutung, wie z.B. der Streik der Weber und Wollkämmerer von Bradford 1825 oder die Landarbeiterrevolte von 1830.
Im Anschlußdaran kommt Thompson noch einmal auf die Lebensstandard-Debatte zurück. Zu diesem Abschnitt bemerkte Thompson allerdings bereits 1968: „ Ein weiteres Kapitel ist offensichtlich unangemessen: dasüber ‚ Lebensstandard und Erfahrungen ‘ . Es war geprägt durch eine besondere historische Kontroverse [...] , die die neuere Geschichtsschreibungüberwunden hat. Das Kapitel kommt mir jetzt kleinlich vor, mit wenig zusätzlicher Information und Analyse. [...] Dennoch: Es gibt immer noch Beispiele, die eher ungewöhnliche und in Historikerkreisen meistenteils belächelte, Quellen zurück, um sich Erfahrung Wirtschaftswachstums verpflichtet ist, und zwar in einer Form, daßsie eine Disziplin auf Propaganda reduzieren. Und aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, das Kapitel stehen zu lassen: als Polemik. ” (S. 904, Hervorhebung im Original).
Ebenfalls bereits vertraut, allerdings aus dem ersten Teil der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” ist dem Leser das Thema Methodismus, das Thompson im zweiten Teil unter der Überschrift „ Die verwandelnde Macht des Kreuzes ” noch einmal ausführlich kritisch untersucht. Ging es Thompson im ersten Teil vorrangig um eine vergleichende Betrachtung des Methodismus hinsichtlich der älteren Dissentertraditionen, so liegt der Schwerpunkt nun auf der Funktionalität des Methodismus als „ Disziplinierungsagentur ” für die neue industrielle Gesellschaft und der Frage, warum so viele arbeitende Menschen bereit waren, sich dem zu unterwerfen. „ Wie war es möglich, daßder Methodismus mit solchem Erfolg seine doppelte Rolle als Religion der Ausbeuter und der Ausgebeuteten spielen konnte? ” (S. 404) Bis in die Details von Sonntagschullehrplänen und Gemeinschaftsritualen sucht Thompson nach den Ursachen für die Attraktivität des Methodismus in den Unterklassen und versucht sich dem Phänomen der freiwilligen Unterwerfung v.a. anhand psychoanalytischer Kategorien der Triebstruktur zu nähern.
Thompson schließt den zweiten Teil der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” mit dem Kapitel „ Gemeinde und Gemeinschaft ”. Hier werden die durch die Industrielle Revolution hervorgerufenen Veränderungen im Freizeitverhalten, z.B. durch den Rückgang traditioneller Feste und Bräuche, und die Veränderungen in den persönlichen Beziehungen, z.B. durch die Zerstörung der traditionellen Familienwirtschaft, untersucht. Dabei insistiert Thompson darauf, daßes „ töricht ” wäre, „ die Dinge nur von der idyllischen Seite zu betrachten ” (S.441) . Er diskutiert den ambivalenten Charakter den die Zerstörung traditioneller Lebensformen für die Situation der Frau hatte, und zeigt darüber hinaus anhand der Gründung der Unterstützungskassen „ mit ihrem Alltagsethos gegenseitiger Hilfe ” (S.452), die Entstehung neuer sozialer Formen, um schließlich zu demErgebnis zu kommen, daßdas „ Gemeinschaftsleben der Arbeiterklasse des frühen 19.Jahrhunderts [...] weder ein Produkt des Paternalismus noch des Methodismus, sondern im hohem Grade der bewußten Anstrengung der Arbeiterklasse selbst ” (S.447) war. In einem gesonderten Abschnitt widmet sich Thompson der Situation der irischen Einwanderer und beschreibt ausführlich das zwar keineswegs spannungsfreie, aber durchaus auch zu Bündnissen fähige Verhältnis zwischen irischen und englischen Arbeitern.
Thompson endet den zweiten Teil mit dem Fazit: „ Der Industrialisierungsprozeßist notwendigerweise schmerzlich. Er ist ohne den Zerfall traditioneller Lebensmuster nicht denkbar. Aber in England verlief er außerordentlich gewaltsam, ungemildert durch irgendeine gemeinschaftliche Anstrengung einer Nation wie in den Ländern mit einer nationalen Revolution. [...] Die Erfahrung der Verelendung kam in hundert verschiedenen Formenüber sie [die arbeitenden Menschen, E.G.] : für den Landarbeiter als Verlust von Gemeinderechten und Resten einer dörflichen Demokratie; für den Handwerker als Verlust seines beruflichen Status; für den Weber als Verlust von Einkommen und Unabhängigkeit; für das Kind von Arbeit und Spiel zu Hause; für viele Arbeitergruppen, deren Reallöhne stiegen, als Verlust von Sicherheit und Freizeit, als Verschlechterung ihrer städtischen Umwelt. [...] Und dieser Eindruck bleibt [...] zusammen mit dem Eindruck vom Verlust jeglichen spürbaren Gemeinschaftslebens außer dem, das sich die arbeitenden Menschen im Widerstand gegen ihre Arbeit und ihre Herren selbst schufen. ” (S. 476-477 und S. 478)
Standen im zweiten Teil der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse ” die Erfahrungen der arbeitenden Menschen mit der sich radikal verändernden Alltagswirklichkeit während der Industriellen Revolution im Vordergrund, so widmet sich Thompson im dritten Teil mit dem Titel „ Die Präsenz der Arbeiterklasse ” den Erfahrungen in den politischen Auseinandersetzungen. Konkret geht es um die Geschichte des plebejischen Radikalismus zwischen 1800 und 1830, in dessen Kämpfen die Arbeiterklasse zunehmend Konturen gewann und deren Präsenz schließlich die alten Eliten und die bürgerlichen Wahlrechtsreformer in ein Bündnis - dessen politischer Ausdruck die Wahlrechtsreform von 1832 war - drängte und damit zu einer Neuordnung der politisch-sozialen Fronten führte. Den Radikalismus zu Beginn dieser Periode um 1807 charakterisiert Thompson wie folgt: „ Zunächst einmal weist der Begriff ‚ Radikalismus ‘ auf eine gewisse Breite und Unschärfe der Bewegung hin. Die Jakobiner der neunziger Jahre [des 18. Jahrhunderts, E.G.] waren durch ihre Treue zu den Rights of Man und zu bestimmten Formen der offenen Organisation eindeutig zu identifizieren. Im 19. Jahrhundert umfaßt der Begriff ‚ Radikalismus ‘ zunehmend unterschiedliche Traditionen. 1807 sagte er ebensovielüber den Ton und die Kühnheit der Bewegung wieüber die Doktrin. Er bezeichnete unnachgiebige Opposition zur Regierung, Verachtung für die Schwäche der Whigs, Bloßstellung der Korruption und des [repressiven, E.G.] ‚ Pitt-Systems ‘ und allgemeine Unterstützung für eine Parlamentsreform. Bei sozialen undökonomischen Fragen bestand wenig Übereinstimmung. ” (S.547) Die Thompsonsche Rekonstruktion der Geschichte des plebejischen Radikalismus führt über bis dahin von der englischen Geschichtsschreibung kaum beschrittene Pfade, wie die These von der Untergrundtradition in den ländlichen Industriedistrikten. „ In den Midlands und im Norden wurde der Radikalismus in den Untergrund getrieben, in die Welt der illegalen Gewerkschaften; hier stießer auf die Probleme der Arbeitswelt, das Geheimtreffen und den Eid. ” (S. 553)
Eine Annäherung an diese Tradition der Illegalität, „ eine Tradition, die für immer im Dunkeln bleiben wird ” (S. 554) versucht Thompson im Kapitel „ Die Armee der Gerechten ” . Schwerpunkt des Kapitels ist die Beschreibung und Interpretation der Maschinenstürmerei des Luddismus. Dabei fragt Thompson nicht nur nach möglichen Zusammenhängen zur Untergrundtradition des politischen Radikalismus, sondern zeigt, entgegen konventionellen Bewertungen des Maschinensturm, als „blindwütige Fortschrittsfeindlichkeit“, daßder Maschinensturm letztes Mittel einer jahrelang vergeblich um soziale Absicherung petitionierenden Bewegung war, die einen hohen Organisationsgrad über die jeweils betroffenen Gewerbe hinaus aufwies. „ All diese Forderungen [die Verteidigung paternalistischer Bräuche und Gesetze ebenso wie die Forderung nach Mindestlohn, nach Besteuerung der Maschinen zur Finanzierung sozialer Hilfsprogramme oder die Forderung nach Legalisierung von Gewerkvereinen; E.G.] waren in demselben Maße vorausschauend wie rückwärtsgewandt [...]. Die Ludditen gehörten zu den letzten Zunftleuten und zugleich zu den ersten, die mit der Agitation begannen, welche in die Bewegung für den Zehnstundentag mündete. In beiden Richtungen lag eine zum Laissez-faire alternative politische Ökonomie und Moral. ” (S. 640) Thompson schließt sein Kapitel über den Luddismus mit der Feststellung, daßdie „ Agitation für Parlamentsreform [...] in den drei Grafschaften genau zu dem Zeitpunkt, als der Luddismus besiegt war ” begann und der provokanten Interpretation, daß„ dem erbitterten Kommentar eines Friedensrichters aus Derbyshire aus dem Jahre 1817 Glauben [zu] schenken [sei]: ‚ Die Ludditen sind jetzt hauptsächlich mit Politik und Wühlarbeit beschäftigt. Sie sind die Hauptanführer der Hampden-Clubs, die jetzt in beinahe jedem Dorf im Dreieck zwischen Leicester, Derby und Newark gegründet werden. ” (S. 693)
Thompsons Suche nach Verbindungslinien zwischen militantem Untergrund und der radikalen Bewegung, der er auch im anschließenden Kapitel „ Demagogen und Märtyrer ” nachgeht, indem er beispielsweise nach möglichen Zusammenhängen zwischen dem Luddismus und dem Pentridge-Aufstand von 1817 oder zwischen Jakobinern mit Untergrunderfahrung und der Cato-Street-Verschwörung 1820 fragt, ist in sofern provokant, als er damit explizit gegen eine an einer stetigen konstitutionellen Entwicklung Großbritanniens orientierten „Whigschen”-Geschichtsschreibung opponiert. Diese interpretiert aufständische Untergrundaktivitäten vorrangig entlang der Interessen von Provokateuren und Behörden zur Legitimation repressiver Politik - bei einigen Vorkommnissen bis hin zur Verschwörungstheorie -, denn als tatsächliche eigene Widerstandsform der frühen Arbeiterklasse.(vergl. S. 561, S. 567 ff, S. 665 ff, S. 744, S. 748, S.760 ff, S.796)
Schwerpunkt des Kapitels „ Demagogen und Märtyrer ” ist jedoch die Rekonstruktion der radikalen Bewegung bis 1820 in ihrer inneren historischen Logik insgesamt. So beleuchtet Thompson das Wirken verschiedener politischer Vereinigungen, wie „ Hampden-Clubs ”, „ Union Societies ” oder „ Society of Spencean Philantropists ” , ihre Organisationsprobleme und regionalen Disparitäten. Er versucht ein Bild von den informellen Strukturen der Bewegung zu zeichnen und diskutiert die ambivalente Rolle charismatischer Wortführer und Agitatoren. Ein weiteres Thema ist die Konfliktualtität zwischen den Konstitutionalisten der „ moral-force ” -Fraktion und den Revolutionären der „ physical-force ” -Fraktion oder das Problem von Spitzeln, Provokateuren und Verrat. So diskutiert Thompson ausführlich die Ereignisse und Folgen des gescheiterten Pentridge Aufstandes, in dessen Vorbereitung ein Agent der Regierung - William Olivier - an exponierter Stelle verwickelt war. „ In der Reformbewegung der Arbeiterklasse führte die Olivier-Affaire nach 1817 zu einer entschlossenen konstitutionalistischen Einstellung. ‚ Friedlich, wenn wir können ‘ erhielt den Vorrang vor ‚ gewaltsam, wenn wir müssen ‘ . [...] Erst der Peterloo-Schock (August 1819) führte einen Teil der Bewegung auf revolutionäre Bahnen zurück und die Cato-Street-Verschwörung (Februar 1820) verlieh der Lektion von Olivier und Pentridge noch einmal Nachdruck. ” (S. 764)
Diese entschieden konstitutionalistische Strategie des plebejischen Radikalismus nach 1817, der mit seinen neuen Modellen lokaler Reformgesellschaften und Massendemonstrationen mit militärisch anmutender Formierung den Forderungen nach politischer Organisation, Presse- und Versammlungsfreiheit und Parlamentsreform Nachdruck verlieh, interpretiert Thompson als eine für Regierung und herrschende Klassen sichtbare und als Bedrohung empfundene „ Verwandlung des Pöbels in eine disziplinierte Klasse ” (S. 777). „ Mit dieser wachsenden Macht konfrontiert, stand Old Corruption vor der Alternative, die Reformer zu unterdrücken oder ihnen nachzugeben. Aber Nachgeben hätte 1819 bedeutet, einer Reformbewegung nachzugeben, die sich weitgehend aus der Arbeiterklasse rekrutierte; die bürgerlichen Reformer waren noch nicht stark genug (das waren sie erst 1832), um eine gem äßigtere fortschrittliche Linie anzubieten. Das ist der Grund für die Ereignisse von Peterloo. ” (S. 778) „Peterloo” bezeichnet die landesweit Aufsehen erregende, blutige Zerschlagung einer solchen knapp hunderttausend Teilnehmer - darunter viele Frauen und Kinder - zählenden Massendemonstration auf dem St.-Peters-Feld in Manchester durch in Waterloo geprüfte Kavallerieeinheiten und berittene Milizen örtlicher Fabrikanten und Kaufleute. „ Es war die Panik des Klassenhasses ” (S. 781) kommentiert Thompson die Ereignisse. Aus der Situation in den folgenden Monaten, in denen unzählige politische Vereinigungen gegründet wurden, Gerüchte über Bewaffnung die Runde machten und „ selbst der konstituionalistische Radikalismus [in einigen Gegenden, E.G.] eine revolutionäre Wendung ” (S. 785) vollzog, folgert Thompson: „ 1819 war eine Generalprobe für 1832. In beiden Jahren war eine Revolution möglich, weil die Regierung isoliert war und es innerhalb der herrschenden Klasse scharfe Differenzen gab. ” (S. 766) So hatte u.a. das Vorgehen der Behörden in Manchester bis in Kreise der Gentry Empörung ausgelöst. „ Aber Ende Dezember war die Bewegung faktisch zusammengebrochen. Dafür gab es zwei Gründe: die Spaltungen unter den radikalen Führern und die Repression durch die Six Acts. ” (S. 788) . Die Six Acts kodifizierten bzw. erweiterten die repressive Gesetzgebung von 1795 und 1817 und in ihrem Gefolge startete die Regierung „ die umfassendste Strafverfolgungskampagne der britischen Geschichte. ” (S. 795)
Das letzte Kapitel trägt den Titel „ Klassenbewußtsein ” Einleitend schreibt Thompson: „ Verglichen mit den vorangegangenen radikalen und den nachfolgenden chartistischen Jahren, erscheinen die zwanziger Jahre merkwürdig ruhig [...] . In diesen ruhigen Jahren kämpfte Richard Carlile für die Pressefreiheit, wuchs die Kraft der Gewerkschaftsbewegung, wurden die Koalitionsgesetze widerrufen, entwickelten sich Freidenkerei, die Genossenschaftsexperimente und die owenitische Theorie. Individuen und Gruppen versuchten die zwei von uns beschriebenen Erfahrungen in eine Theorie zuübertragen: die Erfahrung der Industriellen Revolution und die Erfahrung des aufständischen und besiegten Volksradikalismus. Am Ende dieses Jahrzehnts, als der Kampf zwischen Old Corruption und der Reformbewegung seinen Höhepunkt erreichte, können wir in einem neuen Sinn vom Bewußtsein der arbeitenden Menschen, von ihren Klasseninteressen und ihrer Klassenlage sprechen. ” (S. 807) Den Weg zu diesem neuen „ Bewußtsein der arbeitenden Menschen ” verfolgt Thompson entlang einer Rekonstruktion der intellektuellen Kultur des Volksradikalismus, insbesondere des Handwerkermilieus, der sie maßgeblich prägenden und aus ihr hervorgehenden radikalen Presse sowie schließlich entlang einigen Aspekten der owenitischen Bewegung und der Situation rund um die Verabschiedung des Reform Bill 1832.
Das wesentliche Kennzeichen der radikalen Handwerkerkultur sieht Thompson in einer mühsam erworbenen autodidaktischen Bildung: „ Die Handwerkerkultur war vor allem eine Autodidakten-Kultur ” (S. 824), wobei Thompson unter „Handwerker” ein Milieu verstanden wissen will, das „ auf der einen Seite an die Londoner Schiffbauer und die Fabrikarbeiter von Manchester heranreichte und auf der anderen Seite an die herabgesunkenen Handwerker, die Heimarbeiter. ” (S. 844) In diesem Milieu mit seiner teilweise noch aus der Tradition des Dissent stammenden „ moralischen Sprödigkeit ” (S. 739) hatte die radikale Presse ihr Publikum, organisierte man sich in Abonnenten - Gemeinschaften und Leseclubs, bat der Analphabet ums Vorlesen und wurden weite Wege zurückgelegt, um einem „Volksredner” zuzuhören usw. Aus ihm gingen radikale Publizisten wie z.B. Carlile hervor, wurden informelle Pressevertriebswege „ mit ihrer eigenen Folklore ” (S. 827) organisiert und der Kampf um die Pressefreiheit geführt. Die Handwerker-Kultur der zwanziger Jahre will Thompson einerseits zwar noch nicht als „Arbeiterkultur” verstanden wissen, andererseits nimmt er sie aber deutlich gegen das Verdikt der „ Kleinbürgerlichkeit “ in Schutz.
Ging es Thompson im ersten Abschnitt des Kapitels „ Klassenbewußtsein “ vor allem darum, zu zeigen, daßder maßgeblich vom Handwerkermilieu getragene Radikalismus „ in gewisser Weise eine intellektuelle Kultur ” (S. 807) war und wie Aneignung und Vermittlung von Information, Wissen, Bildung und politischen Ideen in einer Gesellschaft, in der nur zwei von drei arbeitenden Menschen lesen konnten, funktionierte, so rücken in den folgenden Abschnitten vermehrt die politischen Ideen selbst, allerdings immer im Kontext der radikalen Bewegung, in den Vordergrund. Den Gründen für den außerordentlichen Erfolg von William Cobetts radikaler Zeitung „ Political Register “, die mit einer Auflage zwischen 40.000 und 60.000 Exemplaren pro Woche um 1817 „ jeden Konkurrenten gleich welcher Art um ein vielfachesübertraf “ (S. 815) spürt Thompson anhand der - mittels Textanalyse herausgearbeiteten - Argumentationsweise, ihres Tonfalls und Stils nach. Er lotet die Stärken und Grenzen sowohl der durch Cobett geprägten Sozialkritik als auch der sich rund um die kleineren Zeitungen artikulierenden Ideen aus. So diskutiert Thompson Carliles antiabsolutistischen und antiklerikalen Journalismus, den Arbeiterutilitarismus im „ Gorgon “ und die gewerkschaftlichen Ideen rund um das „ Trades Newspaper “ von John Gast.
Neben der Handwerkerkultur und der radikalen Presse ist der Owenismus ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels „ Klassenbewußtsein “. Wie schon in den vorangegangenen Untersuchungen zu den einflußreichen radikalen Publizisten und Denkern geht es Thompson weniger um eine umfassende Analyse sämtlicher politischer Vorstellungen Robert Owens, sondern darum, einige Bedingungen für die rasche Verbreitung der owenitischen Bewegung anhand der owenitischen Ideen einerseits und der Erfahrungen der arbeitenden Menschen andererseits auszuloten, um so zu einer Einschätzung der Bedeutung des Owenismus für das Bewußtsein der sich formierenden Arbeiterklasse zu gelangen. So setzt Thompson beispielsweise owenitische Ideen ins Verhältnis zu den in Teil 2 beschriebenen „ katastrophischen Erfahrungen “ von Handwerkern und Heimarbeitern. Er beschreibt die vor bzw. unabhängig von Owens Ideen existierenden frühgenossenschaftlichen Praktiken selbstorganisierter kollektiver Vermarktung durch in ihrer Existenz bedrohte Kleinproduzenten oder diskutiert Berührungspunkte zwischen messianischen Aspekten der owenitischen Propaganda und den zwischen Ende der 1820er und Mitte der1830er Jahre noch einmal auflebenden chiliastischen Sekten und Bewegungen.
Explizit verteidigt Thompson die politischen Ideen, Forderungen und Kultur des plebejischen Radikalismus gegen bestimmte Urteile von sich - in Thompsons Augen zu Unrecht - „marxistisch“ nennenden Interpreten und Analysten. So durchzieht zum einen die Diskussion, um das bereits oben angesprochene Urteil der „ Kleinbürgerlichkeit “ mehr oder weniger das gesamte letzte Kapitel zum Klassenbewußtsein. Die Frage, ob dieses Urteil gerechtfertigt ist oder nicht, debattiert Thompson nicht nur im Abschnitt zur Handwerkerkultur, sondern auch in den Abschnitten, in denen er die radikale Presse, ihre Publizisten, ihre Argumentationsweise und ihr Verhältnis zur Leserschaft untersucht. (vergl.S. 823, 824, 866) Zum zweiten verwahrt sich Thompson gegen eine pauschale Verurteilung des owenitischen Sozialismus als „ irrationalistisch “ , „ utopisch “ oder „ rückwärtsgewandt “: „ Es lag nichts Irrationales und Messianisches darin, eine Kritik am Kapitalismus als System vorzubringen oder ‚ utopische ’ Gedankenüber ein alternatives und vernünftigeres System zu entwerfen. Vom Standpunkt derer, die sich abplacken mußten, war nicht Owen ‚ verrückt ’ , sondern ein soziales System, in dem Dampfkraft und neue Maschinen offensichtlich die Arbeiter verdrängten und ihre Lage verschlechterten und in dem Märkte ‚ü berschwemmt ’ werden konnten, während der Weber ohne Schuhe am Webstuhl saßund der Schuhmacher in seiner Werkstatt keine Jacke trug. [...] Ironischerweise hat diese Bewegung, der bisweilen unterstellt wird, sie hätte ihre Stärke zum großen Teil von ‚ Kleinbürgern ‘ bezogen, ernsthaftere Versuche gemacht, neuen Formen des Gemeinschaftslebens den Weg zu ebenen, als jede andere in der englischen Geschichte. ” (S. 908, 909) Und zum Dritten verteidigt Thompson den hohen Stellenwert, den die englische Arbeiterklasse demokratischen Freiheiten, wie Presse-, Rede-, Versammlungs- und persönliche Freiheit sowie dem allgemeinen (Männer-)Wahlrecht, zumaßgegen „ die in neueren ‚ marxistischen ’ Interpretationen anzutreffenden Vorstellungen, diese Forderungen seien ein Erbe des bürgerlichen Individualismus “. Vielmehr hätten sich die Handwerker und Arbeiter in ihren Kämpfen die aus dem Revolutionskompromißvon 1688 herrührende, antiabsolutistische Tradition in besonderer Weise zu eigen gemacht, indem sie beispielsweise im Kampf um die Pressefreiheit und gegen die Stempelgebühren „ der Forderung nach Rede- und Gedankenfreiheit ihre eigene Forderung nach ungehinderter Verbreitung der Produkte dieser Gedanken in möglichst billiger Form hinzufügten “ (S. 830). Und hinsichtlich des Wahlrechts bemerkt Thompson: „ Das Wahlrecht stellte für die Arbeiter dieser und der nächsten Dekade [1830er und 1840er Jahre, E.G.] ein Symbol dar, dessen Bedeutung nur schwer erfaßbar ist, da unsere Augen seit mehr als einem Jahrhundert durch den Nebel des ‚ Zweiparteien-Systems ’ geschwächt sind. Es bedeutete vor allem und zunächst ‚ egalit é ’ : Gleichheit des Bürgerrechts, persönliches Ansehen und Würde. [...] Aber im Kontext der Jahre der Oweniten und Chartisten implizierte die Forderung nach dem Wahlrecht auch noch weitere Forderungen: eine neue Art, in der die Arbeiter die soziale Kontrolleüber ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu erlangen suchten. “ (S. 933, Hervorhebungen im Original)
Thompson endet das Kapitel „ Klassenbewußtsein “ , und damit seine knapp tausend Seiten umfassende Rekonstruktion der Entstehung der englischen Arbeiterklasse, mit einer Charakterisierung der sozialen Fronten um 1832. „Überschreiten wir die Schwelle zwischen den Jahren 1832 und 1833, so treten wir in eine Welt, in der die Präsenz der Arbeiterklasse in jeder Grafschaft Englands und in den meisten Lebensbereichen zu spüren ist. Das neue Klassenbewußtsein der arbeitenden Bevölkerung l äßt sich unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Auf der einen Seite gab es ein Bewußtsein der Interessenidentität bei den arbeitenden Menschen der verschiedensten Berufe und Qualifikationen, das sich in vielen institutionellen Formen verkörperte und sich in einem bis dahin noch nie dagewesenen Ausmaßin der allgemeinen Gewerkschaftsbewegung von 1830-1834 ausdrückte. Dieses Bewußtsein und diese Institutionen waren im England von 1780 nur in fragmentarischer Form vorzufinden. Auf der anderen Seite gab es ein Bewußtsein der Arbeiterklasse oder der ‚ produktiven ’ Klassen im Gegensatz zu denen anderer Klassen; und darin reifte die Forderung nach einem alternativen System heran. “ (S. 912, Hervorhebungen im Original) Eine wesentliche Bedingung für die neuen sozialen Fronten sei - so Thompson - nicht zuletzt die bürgerliche Reaktion auf die „ Stärke der Arbeiterklasse “ gewesen: Die Klassengrenzen wurden „ 1832 mitäußerster Sorgfalt mittels der Wahlberechtigung gezogen “. Im Radikalismus als „ Arbeiterbewegung mit der Theorie eines fortschrittlichen demokratischen Populismus “ sieht Thompson einen Grund für die „ eigenartig repressive und anti-egalitäre Ideologie des englischen Bürgertums “ (S. 913). An anderer Stelle spricht Thompson auch von einem, in den Jahren zwischen der Französischen Revolution und der Reform Bill gewachsenen „ bürgerlichen Klassenbewußtsein “, das „ konservativer und behutsamer im Umgang mit großen idealistischen Zielen [...] und auf bornierte Weise selbstsüchtig [er] war als das jeder anderen industrialisierten Nation “ (S. 926). Demgegenüber war die grundlegende Tendenz der „ großen Bewegungen der Handwerker und Heimarbeiter “ zwischen 1780 und 1830 - so Thompson - „ der Widerstand gegen die Verwandlung in ein Proletariat “ (S. 937, Hervorhebung im Original). Ein Widerstand, der in seiner politisch organisierten Form auf die (Rück-)Gewinnung der sozialen Kontrolle über die eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen durch demokratische Reformen hoffte und der - so paradox es klingen mag - als Widerstand gegen die Proletarisierung gleichzeitig das „Making“, d.h. nicht eine nur passive „Entstehung“, sondern ein aktiver Formierungsprozeßder (englischen) „Arbeiterklasse“ war.
c) Quellen
E.P.Thompsons „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ hat eine ausgesprochen reiche Quellenbasis zur Grundlage. Neben den zahlreichen unveröffentlichten Quellen wie z.B. den Akten des Innenministeriums, Prozeßakten oder verschiedenen Sammlungen des Britischen Museums, der Sheffield Reference Liberary oder der John Rylands Liberary in Manchester füllt allein die im bibliographischen Anhang aufgeführte Liste der zugrunde gelegten zeitgenössischen Periodika vom The Alfred über Cobbett ’ s Political Register bis zum Working Man ´ s Friend and Political Magazine schon mehrere Seiten. Hinzu kommen Monographien, Aufsätze und Literatur aus knapp zwei Jahrhunderten. Neben der wissenschaftlichen Sekundärliteratur, zeitgenössischen politischen Schriften, Memoiren und ähnlichem greift Thompson auch auf, vor allem in der Entstehungszeit des Buches eher ungewöhnliche und in Historikerkreisen meistenteils belächelte, Quellen zurück, um sich Erfahrungen und Mentalitäten gerade auch der schriftlosen Gruppen und Individuen zu nähern. Dazu zählen unter anderem Liedgut, wie z.B. „ General Ludds Triumphe “ , das man zur Melodie von „ Poor Jack “ 48 sang, Moralgeschichten und religiöse Bekenntnisbiographien, die - so Thompson - „ gegen ein ‚ satanisches Licht gehalten und umgekehrt gelesen werden [müssen, E.G.] , wenn man herausfinden will, was die ‚’ Teerjacke ’ , der Lehrling oder das Mädchen aus Sandgateüber Autoritäten und methodistische Prediger dachten “ 49, sowie auch Allegorien, wie das bereits erwähnte Bunyansche Erbauungsbuch „ The Pilgrim ’ s Progress “ 50, oder Erzählungen, Legenden und Volkslyrik, wie beispielsweise die in den Weberdistrikten entstandenen „ John o ’ Grinfilt “ -Balladen und Romane, wie z.B. Charlotte Brontoёs „ Shirley “ 51. Als weitere Quellen, um zu Einschätzungen allgemeinerer Art hinsichtlich der sich nicht artikulierenden Gruppen und Individuen zu gelangen, dienen Thompson beispielsweise Konjunkturen chiliastischer Sekten und Bewegungen: „ Eine Bestätigung für diesen Meinungsumschwung [hin zu einer „wachsenden Bereitschaft zum Schutz und zur Tolerierung“ von Jakobinern, E.G.] finden wir in unvermuteten Quellen. In den Jahren 1793 und 1794 kam es zu einer Flut von Phantasien vom ‚ Tausendjährigen Reich ’ , wie man sie seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr gesehen hatte. [...] Der chiliastische Geist [...] l äßt eine Unruhe erkennen, die die Friedensrichter als den ‚ Geist der Erneuerung ’ verdammten, einen vagen sozialen Optimismus der Leichtgläubigen, der den revolutionären Hoffnungen der Intellektuellen verwandt war. “ 52
Mehrmals thematisiert Thompson in seiner „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ explizit die Quellenproblematik. So widmet er sich beispielsweise im kompletten Unterkapitel „ Die geschlossene Gesellschaft “ den Schwierigkeiten der Quelleninterpretation hinsichtlich der Ludditenbewegung als Teil einer möglicherweise andauernden Untergrundtradition zwischen 1795 und 1820. Er diskutiert ebenso die Frage der Zuverlässigkeit von Behördenmaterial (wie Spitzelberichte, Briefe von Friedensrichtern an das Innenministerium usw.), wie die Frage nach der Parteilichkeit der „ wichtigste [n] , alternative [n] Informationsquelle “ , nämlich dem Archiv des liberalen Wahlrechtsagitators Francis Place. Die Tragweite von derlei Quellenproblemen, wie daß„ bis heute [...] keine authentischen, von den Ludditen selbst geschriebenen Darstellungen “ - z.B. persönliche Erinnerungen - gefunden wurden, wird einmal mehr deutlich, wenn als Lösung nur der punktuelle Übergang „ von der Quellenkritik zur konstruktiven Spekulation “ 53 bleibt , wie Thompson seinen Lesern mit bemerkenswerter Offenheit mitteilt.
5. Thompsons Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen
Im Vorwort zur „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ und im Nachwort zur 2. Auflage von 1968 hat Thompson einige auf seinen historischen Untersuchungen basierende Aussagen allgemeinerer Art zu seiner Vorstellung von „ Klasse “ formuliert. Darin wendet sich Thompson gegen einen statischen, überhistorischen, verdinglichten Klassenbegriff. Thompson will Klasse nicht als festgefügte „ Struktur “, definierte „ Kategorie “ , als „ Ding “ 54 mit bestimmten Eigenschaften oder als vermeßbares Objekt verstanden wissen, „ sondern als etwas, das sich unter den Menschen, in ihren Beziehungen abspielt. “ 55 Mit anderen Worten „Klasse“ ist nach Thompson ein Prozeßoder ein Geschehen. Eine Klasse kann so Thompson weder abstrakt, noch isoliert von anderen Klassen betrachtet werden: „ Wir können auch nicht von verschiedenen Klassen, die unabhängig voneinander existieren ausgehen, und sie dann zueinander in Beziehung setzen. “ 56 Klasse als Geschehen, daßnur im Verhältnis zu anderen Klassen stattfindet, läßt sich selbstredend nicht jenseits der Zeitdimension, d.h. jenseits von Aktion, Reaktion, Wandel und Konflikt erfassen. „ Soziologen, die die Zeitmaschine angehalten haben und - unter beträchtlichem Aufwand an begrifflichem Geächze und Gestöhne - in den Motorraum hinabgestiegen sind, erzählen uns, daßsie nicht in der Lage waren, irgendwo eine Klasse zu lokalisieren oder zu klassifizieren. Sie können nur eine Vielzahl von Menschen mit verschiedenen Beschäftigungen, Einkommen, Status-Hierarchien und was es sonst noch gibt, finden. Sie haben natürlich recht, ‚ Klasse ’ ist ja nicht dieser oder jener Teil der Maschine, sondern die Art und Weise, wie diese Maschine funktioniert [...] . “ 57 Das hier verwendete „Maschinen“-Bild erinnert an die Analogie der marxistischen Geschichtstheorie von den Klassenkämpfen als „Motor“ der Geschichte. Von daher scheint es naheliegend, daßThompson darauf anspielt. Andererseits schreibt er 1978 in seiner Polemik gegen Althusser, daß„ wir die Analogie vom Klassenkampf als Motor der Geschichte nie besonders gemocht haben “, da sie von „ zwei getrennten Einheiten “ ausgehe: „ von ‚ Geschichte ’ , die leblos ist [...] und einem ‚ Motor ’ (Klassenkampf) “ , der sie in Bewegung setzt.58 Wie dem auch sei, hinsichtlich klassentheoretischer Fragestellungen zu den Gründen und Ursachen von Klassenformierung geht Thompson bereits 1963 eigene Wege: „ Eine Klasse formiert sich, wenn Menschen aufgrund gemeinsamer Erfahrungen - seien von den Vorfahren weitergegeben oder zusammen erworben - die Identität ihrer Interessen empfinden und artikulieren, und zwar sowohl untereinander als auch gegenüber anderen, deren Interessen von ihren eigenen verschieden (und diesen gewöhnlich entgegengesetzt) sind. Die Klassenerfahrung ist weitgehend durch die Produktionsverhältnisse bestimmt, in die man hineingeboren wird - oder in die man gegen seinen Willen eintritt. Klassenbewußtsein ist die Art und Weise, wie man diese Erfahrungen kulturell interpretiert und vermittelt: verkörpert in Traditionen, Wertsystemen, Ideen und institutionellen Formen. “ 59 Zwar spielen auch für Thompson ökonomische Kriterien, konkret die Produktionsverhältnisse d.h. die kapitalistische Industrialisierung, eine Rolle im Prozeßder Klassenformierung, allerdings schreibt Thompson den Produktionsverhältnissen lediglich den Status von materiellen Zwängen und Grenzen zu. Sie determinieren zwar „ weitgehend “ die „ Erfahrung “ , sie determinieren nicht die Konsequenzen. Die Klassenformierung, d.h. entsprechend den oben zitierten Sätzen das Empfinden von Interessenidentität und ihre Artikulation untereinander und gegenüber anderen Klassen, was nichts anderes bedeutet als Klassenkampf, ist kein automatischer, den Produktionsverhältnissen entspringender Prozeß, sondern wesentlich vermittelt durch kulturelle Wahrnehmungsmuster und Interpretationen. Damit ist auch gleichzeitig noch etwas anderes gesagt, nämlich daßsoziale Klassen nicht jenseits von sozialen Kämpfen, sprich Klassenkämpfen denkbar sind. Gegen einen ökonomistisch verkürzten Marxismus, demzufolge die Produktionsverhältnisse das „Ding“ Klasse gebären, das sich dann von der „ Klasse an sich “ zur „ Klasse für sich “ entwickelt und schließlich den Klassenkampf aufnimmt, setzt Thompson einen dynamischen Prozeßvon sozialen Kämpfen und Klassenformierung, eben das „ making “, das „ Sich zur Klasse- Machen “, das an die Stelle der klassischen „für sich“/„an sich“ Definitionen tritt. Dem „ making “ liegt zwar eine durch die Produktionsverhältnisse bestimmte Partizipation am gleichen Erfahrungszusammenhang zugrunde, die kulturelle Verarbeitung und spezifische politische Rezeption dieser Erfahrung variiert. Sie bewegt sich zwischen Tradition sowie ihren Modifikationen und Transformationen in unmittelbaren Kämpfen und Konflikten und ist damit immer auch die Eigenleistung der historischen Subjekte. Und insofern reale Klassensituationen - ausgehend von einem Klassenbegriff, wonach Klasse „ die Bewegung selbst “ ist60 - immer auch Konflikt- bzw. Kampfsituationen sind, richtet sich Thompson dynamischer Klassenbegriff auch gegen das „ andere ideologische Lager “ , in dem Klasse ebenso statisch als „ Bestandteil der Gesellschaftsstruktur “ definiert wird, Klassenbewußtsein und Klassenkampf aber als „ etwas ganz Übles, als eine Erfindung vonüberspannten Intellektuellen “ 61 gilt.
Setzt man nun diese allgemeineren theoretischen Aussagen ins Verhältnis zur Geschichte über die „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “, so läßt sich hinsichtlich Thompsons Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen folgendes festhalten: Erstens sei noch einmal grundsätzlich darauf hingewiesen, daßThompson - wie in der Zusammenfassung im Abschnitt 4 zu genüge deutlich geworden sein sollte - einen konkreten historisch-empirischen Prozeßvon Klassenformierung rekonstruiert, nämlich eben die Entstehung der Arbeiterklasse in England zwischen 1790 und 1830. Das heißt, Thompson untersucht politische Ereignisse, soziale Kämpfe, gesellschaftliche Beziehungen, kulturelle Muster etc. hinsichtlich der Frage ob, wie, wann und warum sich eine bestimmte soziale Klasse formierte immer auch als Rekonstruktion spezifischer englischer Geschichte. Er widmet sich beispielsweise bestimmten nationalen und historischen Spezifika hinsichtlich ihrer Relevanz für die Klassenformierung, wie z.B. den politischen und kulturellen Traditionen des antiabsolutistischen Konstitutionalismus oder der Gleichzeitigkeit der Industrialisierung in England mit der Französischen Revolution usw. Die „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ ist weder eine Konstruktion einer übernationalen Entwicklungslogik zur bürgerlichen Klassengesellschaft, der England nur als Beispiel gilt, noch ist ihr Gegenstand die Formulierung einer allgemeinen Theorie zur Klassenstrukturierung in England oder gar eine Sozialstrukturanalyse. Sondern die „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ ist eine historiographische Untersuchung einer realen Klassenformierung.
Zweitens: Auch Thompson mußhinsichtlich Anfang und Ende seines Untersuchungszeitraumes in gewisser Weise „die Zeitmaschine anhalten“. Wie oben angesprochen, legt er dem Leser im ersten Teil eben genau diese Problematik des Beginns der Geschichte der Arbeiterklasse dar, um dann ältere religiöse, antiklerikale, und nonkonformistische Traditionen, aufrührerische Praxen und antiabsolutistische Traditionen zu rekonstruieren. Damit gelingt es ihm nicht nur - um im Bild zu bleiben - ohne anzuhalten auf die Zeitmaschine aufzuspringen, sondern die Rekonstruktion der genannten Facetten des 18. Jahrhunderts dient ihm gleichzeitig als Folie, anhand derer er die Konturen der späteren Arbeiterklasse präzisieren kann, so z.B., wenn er im Abschnitt zu den „ Ritualen gegenseitiger Hilfe “ im Kapitel „ Gemeinde und Gemeinschaft “ die Argumentation für die Gründung von Unterstützungskassen unter Bezugnahme auf die zuvor beschriebenen Traditionen und Werte des jüngeren und älteren Dissent charakterisiert: „ Ihre Sprache verband die christliche Nächstenliebe und die schlummernde Vorstellungswelt der ‚ Brüderlichkeit ’ der methodistischen (und herrenhuterischen) Tradition mit den gesellschaftlichen Prinzipien des owenitischen Sozialismus “ . Noch deutlicher dient das im ersten Teil gezeichnete Bild der aufrührerischen Praxen des 18. Jahrhunderts als Hintergrund zur Charakterisierung der Arbeiterklasse: „ Eben dieses kollektive Selbstbewußtsein mit seiner entsprechenden Theorie, seinen Institutionen, seiner Disziplin und seinen Gemeinschaftswerten unterscheidet die Arbeiterklasse des 19. vom Mob des 18.Jahrhunderts. “ 62 Und sowenig wie es einen bestimmbaren Zeitpunkt gibt an dem die Formierung „einsetzt“, sowenig ist sie am Ende des von Thompson untersuchten Zeitraumes „fertig“. Ihre Präsenz ist - wie Thompson schreibt - ab 1832 überall „spürbar“. Im Verlaufe der sozialen Auseinandersetzungen haben sich bestimmte, beschreibbare soziale Frontstellungen oder Klassenbeziehungen herauskristallisiert. Als „ soziale und kulturelle Formation “ ist Klasse aber selbstredend auch jetzt weder statisch noch überhistorisch: „ Vielleicht war es ein einmaliges Gebilde, diese britische Arbeiterklasse von 1832. “ 63
Drittens wäre nach der Bestimmung, wonach Klasse nur im Verhältnis zu anderen Klassen definiert werden kann, sowie nach den verwendeten Begriffen und Bezeichnungen zu fragen: Die von Thompson beschriebene Klassenformierung findet ihren Abschlußund Höhepunkt in der Krise von 1832, in der die „ Präsenz der Arbeiterklasse “ „ Großgrundbesitz und Großindustrie, [...] Privileg und Geld “ 64 in der Frage der Wahlrechtsreform zu einem Klassenbündnis zwingt. Die zentrale politisch- soziale Frontstellung, die mit dem Klassenbündnis von 1832 eine Neuordnung erfährt, ist die zwischen der „ alten Oligarchie von Grundbesitz und Handelskapital [...], zunehmend verfilzt von Korruption, Käuflichkeit und Besitzinteressen “ (S. 26) und dem englischen Radikalismus. Ersterer begegnet der Leser der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ fast ausschließlich aus der Perspektive des Radikalismus, als der oben bereits mehrfach zitierten „ Old Corruption “. „ Old C o rruption “ ist eine der diversen von Thompson verwendeten zeitgenössischen Bezeichnungen, die als politischer Kampfbegriff gegen das „ englische Ancien R é gime “ (S. 181) vor allem durch die politischen Publizistik William Cobbetts nach 1804 geprägt wurde.65 Als Oligarchie von Grundbesitz und Handelskapital ist „ Old Corruption “ nicht nur eine politische Formation, sondern auch eine Formation „ besitzender Klassen “ - allerdings nicht aller. Zu den „ besitzenden Klassen “ (S. 61) zählt Thompson neben denen der „ Old Corruption “ die (bis 1832) „ nicht im Parlament repräsentierten Klassen von Fabrikanten und Geschäftsleuten “ (S. 105). An anderer Stelle spricht er auch von der „ neuen Fabrikantenklasse “ (S.63, Hervorhebung E.G.) Auch deren Klassenbewußtsein formierte sich, wie oben bereits zitiert, zwischen 1789 und 1830. Demgegenüber ist die „ Old Corruption “ eine - wenn auch hinsichtlich der langen Auseinandersetzungen in den 1840erJahren für die Abschaffung der Korngesetze (vergl.S.928) - langsam ‚sterbende’ gesellschaftliche Formation: „ Und indirekt versetzte sie [die Revolte der Landarbeiter 1830, E.G.] Old Corruption den Todesstoß. [...] Die Aristokratie verlor das ‚ Gesicht ’ und die Dringlichkeit einer Reform wurden offensichtlicher. “ 66 Insgesamt wird in Thompsons Klassenformierungsgeschichte sowohl „Old Corruption“ als auch die neue Fabrikantenklasse bzw. das industrielle Bürgertum fast ausschließlich unter dem Blickwinkel des Verhältnisses zur sich formierenden Arbeiterklasse betrachtet. Die innere Entwicklung von Aristokratie und Bürgertum sind nicht Thema von Thompsons Untersuchung.
Wie sieht es nun auf der anderen Seite der politisch-sozialen Frontstellung, d.h. auf der Seite des Radikalismus, aus? Der Radikalismus ist zum einen eine sozial indifferente Bewegung: „ Zwischen 1815 und 1832 rissen verschiedentlich Agitationen gegen einzelne Mißbräuche [...] weite Teile der Bevölkerung mit. Fabrikanten, Bauern, niedere Gentry, Angehörige freier Berufe, Handwerker und Arbeiter - sie alle forderten Maßnahmen zur Parlamentsreform. “ 67 Im Sinne dieser Breite verwendet Thompson vor allem die Bezeichnung „ Volksradikalismus “ , hat doch das englische „popular“ - so Günther Lottes - vor allem die Bedeutungskomponenten „populär“, „volkstümlich“, „allgemein beliebt“.68 Wohingegen die romantisch-nationalistischen Komponenten, die im Deutschen mit dem Begriff Volk verbunden sind, dem englischen „popular“ nicht anhängen. Allerdings sei angemerkt, daßGareth Stedman Jones darauf hinweist, daßThompsons Betonung einer popularen demokratischen Tradition in England in seinem wissenschaftlichen Werk und in seinen politischen Polemiken sehr geprägt war von der aus dem 2. Weltkrieg stammenden Verknüpfung von Antifaschismus und Patriotismus.69 Dennoch sollten bei der Lektüre der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ die Bedeutungsdifferenzen zwischen „popular“ und „Volk“ gegenwärtig bleiben, zumal hinsichtlich der hier diskutierten Charakterisierung des Radikalismus als „ Volksradikalismus “ , die Thompson in diversen Passagen deutlich spezifiziert im Sinne von „ Volk “ gegen „ Obrigkeit “ (S. 695).
Bestimmte Gruppen innerhalb des Radikalismus, konkret einige radikale, vom Westminister-Komitee in London unterstützte Parlamentsabgeordnete, wie z.B. Francis Burdett (S. 538), bezeichnet Thompson als „ patrizische “ i.S. von „ dem wohlhabenden, vornehmen Bürgertum angehörende “ Radikale oder schlicht als „ bürgerliche Reformer “ (S. 778). Im Gegensatz dazu ist der Radikalismus als Bewegung der Masse des ‚niederen Volkes’ ein „ plebejischer “ (S. 549, 715) Viel öfter jedoch als die vor allem in der Sekundärliteratur zum Modebegriff stilisierte Bezeichnung „ plebejisch “ nahelegt, spricht Thompson - dort wo eine bestimmte soziale Basis charakterisiert werden soll - deutlich (vor allem für den Zeitraum ab 1818) von „ Arbeiterklasse “: von einer „ Reformbewegung der Arbeiterklasse “ (S. 702), von „ Reformern aus der Arbeiterklasse “ (S. 780), von „ Arbeiterbewegung “ (S. 913) oder er verwendet zur Erläuterung beispielhafte Berufsbezeichnungen: „ Aber die treibende Kraft der Reformbewegung waren die ‚ arbeitsamen Klassen ’ - Strumpfwirker, Handweber, Baumwollspinner, Handwerker und mit ihnen verbunden ein weitgefächertes Spektrum kleiner Meister, Händler, Gastwirte, Buchhändler und Freiberufler [...]. “ 70 Die Begriffe „ arbeitsame Klassen “ oder auch „ produktive Klassen “ (S. 912) sind ebenfalls zeitgenössische Bezeichnungen, die, wie Thompson im Zusammenhang mit Wades Arbeiterutilitarismus zeigt, vor allem den Gegensatz zu den von der Grundrente oder dem Zehnten lebenden „ parasitären “ Klassen, d.h. Kirche und Aristokratie, betonen und somit weit genug sind, auch Unternehmer und Angehörige freier Berufe mit einzubeziehen. Jedoch läge beispielsweise bei Wade die Betonung „ auf ‚ jenen, die durch ihre Arbeit als Landwirt, Handwerker, Arbeiter etc. den Reichtum der Gesellschaft vermehren ’“, so das sich bereits eine Verengung des Begriffs andeute.71 In jedem Fall verdeutlicht die von Thompson vorgenommene weitgehend synonyme Verwendung von „ Arbeiterklasse “ und dem zeitgenössischen „ arbeitsame Klassen “ oder „ produktive Klassen “, daßThompson „ Arbeiterklasse “ vor allem im Sinne von „ plebejisch “ und nicht bzw. weniger im Sinne von „ Lohnarbeiter “ oder gar „ Fabrikarbeiter “ verstanden wissen will.
Desweiteren unterscheidet Thompson die „ bürgerlichen Reformer “ von den „ Reformern der Arbeiterklasse “ nicht nur entlang sozialer Gräben, wie beispielsweise zwischen einem Manufakturbesitzer Brougham und dem arbeitslosen Strumpfwirker Brandreth oder entlang solchen von Massenhaftigkeit/Minderheit, sondern auch entlang politischer Standpunkte: „ Die Linie zwischen Hausherren- und allgemeinem Männerwahlrecht war praktisch viele Jahre lang die Demarkationslinie zwischen den Reformbewegungen des Bürgertums und der Arbeiterklasse “ 72 . Schließlich unterscheidet Thompson die „ bürgerlichen Reformer “ von den „ Reformern der Arbeiterklasse “ entlang ihrer Kultur, konkret im gewählten Beispiel entlang ihrer Publikationsorgane und - neudeutsch ausgedrückt - den damit verbundenen Diskursen: „ Während des Krieges und unmittelbar danach gab es auf der einen Seite eine ‚ bezahlte ’ Presse und auf der anderen Seite die Presse der Radikalen. In den zwanziger Jahren befreite sich ein großer Teil der bürgerlich Presse vom direkten Einflußder Regierung [...]. Die Times und Lord Brougham gaben dem Begriff ‚ Radikalismus ’ eine ganz andere Bedeutung - für Freihandel, billige Regierung und utilitaristische Reformen. Bis zu einem gewissen Grad [...] zogen sie das radikale Bürgertum auf ihre Seite [...], so daßes 1832 zwei radikale Öffentlichkeiten gab: das Bürgertum [...] und die Arbeiterklasse [...]. “ 73 Die radikale Bewegung ist also nicht identisch mit einer Klassenformation. Vor allem die Klassensituation des industriellen Bürgertums wäre eher als quer zur Konfliktualiät zwischen Radikalismus und Old Corruption beschreibbar. Auf der anderen Seite ist der Radikalismus keine „reine“ Arbeiterbewegung. Insofern aber seine dominierende soziale Basis das Milieu der städtischen Handwerker und gelernten Arbeiter sowie der Handwerker und Arbeiter des textilen Gewerbes in den ländlichen Manufakturdistrikten ist, ist der Radikalismus Ausdruck und Bedingung der sich formierenden Arbeiterklasse. Die radikale Bewegung ist das Terrain, auf dem die Arbeiterklasse gegenüber der Minorität der bürgerlichen Radikalen Konturen gewinnt: „ Zur Trennungslinie wurden zunehmend [...] gegensätzliche Vorstellungen von politischer Ökonomie. “ 74
Diesen, den bürgerlichen Reformern entgegengesetzten Vorstellungen politischer Ökonomie, wie sie beispielsweise in der owenitischen Bewegung zum Ausdruck kommen, liegen - wie Thompson einleitend zum Kapitel „ Klassenbewußtsein “ schreibt - sowohl die Erfahrungen im Rahmen der radikalen Bewegung zugrunde, als auch - wir erinnern uns - die „ katastrophische Erfahrung “ der kapitalistischen Industrialisierung, womit wir viertens bei dem Aspekt der Produktionsverhältnisse wären. Weniger die Industrialisierung im einzelnen als vielmehr die Entfaltung der kapitalistischen Marktgesellschaft ist, wie oben dargelegt, vor allem das Thema des zweiten Teils der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “, allerdings auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Weder geht es Thompson um eine detaillierte Analyse der sich rasant entwickelnden kapitalistischen Verhältnisse anhand der Kategorien der Marxschen Wertkritik: „ Im MEWC werden durchgängig die kritischen Begriffe ‚ Klasse ’ und ‚ Klassenkampf gebraucht. Ich gebe diesen Begriffen den vorrang vor einer -ökonomischen - Ableitung vom Begriff des Mehrwerts, der den Baustein Nummer eins bildet, auf dem das Gesamtbild des Kapitals aufgebaut wird. Diese Baustein-Methode, der Aufbau eines Modells des Kapitalismus als statische Struktur, ist dem, was ich von Marx gelernt habe und noch lerne, völlig fremd. Aber ich lese Marx wohl anders als heutige Leser. “ 75 Noch geht es ihm darum, die einschneidenden Veränderungen des Industrialisierungsprozesses nach wirtschaftsgeschichtlichem Vorbild anhand von Bevölkerungsstatistiken, Berufszählungen, Produktionsindizes, Konjunkturen und Krisen, Leitsektoren, Wachstumskernen, Urbanisierungsprozessen, Nominal- und Reallöhnen sowie sonstigen „Strukturbedingungen“ zu beschreiben. Viel mehr gilt sein Interesse vor allem anderen den durch den Prozeßder Entfaltung der Marktgesellschaft geprägten Erfahrungen der arbeitenden Menschen und ihrem kulturellen, normativ-bewußten Umgang mit diesen, und zwar sowohl im Detail hinsichtlich konkreter Arbeitergruppen als auch allgemein hinsichtlich der sie verbindenden Momente. Zwar weist Thompson durchaus auch (und meist in kritisch-polemischer Absicht) auf strukturelle Zusammenhänge hin, wie beispielsweise zwischen einer bereits industrialisierten Garnproduktion und einer Potenzierung der in Heimarbeit produzierenden Weber.76 Im Mittelpunkt stehen jedoch Fragen nach der Bedeutung z.B. der Zerstörung von Subsistenzeinkommen, der Aufhebung der elisabethanischen Handwerksordnung, des Armengesetzes von 1834 und des Fabriksystems für den Alltag, die Lebensweise, die Traditionen und Werte der Betroffenen. Mit anderen Worten: Thompson beschreibt die sich wandelnden Produktionsverhältnisse unter dem Blickwinkel der veränderten Lebensbedingungen der unteren Klassen und ihrer subjektiven Wahrnehmung dieser Transformation. Diese subjektive Wahrnehmung vermittelt Thompson nicht zuletzt durch die unzähligen zitierten Äußerungen von Webern, Schuhmachern, Tuchscherern etc. und rekonstruiert so eine Klasse mit Gesichtern. In kritischer Wendung gegen eine Gesellschaftsanalyse, die Klassenformierung als Resultat objektiver ökonomischer Bedingungen, Strukturen und Prozesse analysiert, stellt Thompson die gemachten und gelebten Erfahrungen der historischen Akteure in den Mittelpunkt. Besondere Aufmerksamkeit widmet Thompson dabei - wie oben bereits erwähnt - neben den Landarbeitern vor allem den Handwerkern und Heimarbeitern. Über Fabrikarbeiter erfährt der Leser dagegen vergleichsweise wenig, zum einen weil Thompson ihre Rolle insgesamt für seinen Untersuchungszeitraum für noch nicht so bedeutend einschätzt: „ Die Fabrikarbeiter waren keineswegs die ‚ä ltesten Kinder der Industriellen Revolution ’ , sondern im Gegenteil, Nachzügler. Viele ihrer Ideen und Organisationsformen waren von Heimarbeitern vorweggenommen worden. [...] Es ist zudem fraglich, ob die Fabrikarbeiter (außer in den Baumwollbezirken) vor den späten vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts den ‚ Kern der Arbeiterbewegung gebildet ’ haben. “ 77 Zum anderen, weil es - so Thompson im Nachwort von 1968 - bezüglich der frühen Fabrikarbeiter „ gute Bücher gibt [...] , an die wir uns [...] wenden können “ 78.
Was dachten Handwerker und Heimarbeiter über die mit der Industrialisierung einhergehenden Veränderungen? Im Kapitel „ Ausbeutung “ resümiert Thompson anhand der Quellen, daßweniger „ direkte ‚ Brot- und Butter ’ Probleme “ die Gemüter erregten als vielmehr „ das Aufkommen einer Unternehmerklasse ohne traditionelle Autorität und Verpflichtungen, die wachsende Distanz zwischen Unternehmer und Arbeiter, die Transparenz der Ausbeutung am Ursprung ihres neuen Reichtums und ihrer Macht, der Verlust von Status und vor allem Unabhängigkeit für den Arbeiter, seine vollständige Abhängigkeit von den Produktionsmitteln des Unternehmers, die Parteilichkeit des Gesetzes, die Auflösung der traditionellen Familienökonomie, die Disziplin und Monotonie der Arbeit, die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen, der Verlust von Freizeit und Annehmlichkeiten und die Reduktion des Menschen zu einem Instrument. [...] Das klassische Ausbeutungsverhältnis der Industriellen Revolution ist entpersonalisiert in dem Sinne, daßkeine der früheren Verpflichtungen zur Gegenseitigkeit - Paternalismus und Unterwürfigkeit oder die Interessen ‚ des Gewerbes ’ - Gültigkeit besitzen. Keine Rede mehr von ‚ gerechten Preisen ’ und keine Rede mehr von auf gesellschaftlichem oder moralischem Rechtsempfinden beruhendem Lohn, statt dessen Auslieferung an das freie Spiel der Marktkräfte. “ 79 Der Umstand, daßdie Produktionsverhältnisse in der „ Entstehung der englischen Arbeiterklasse “ , wie hier zitiert, vor allem hinsichtlich der kulturell-psychologischen Aspekte analysiert werden, hat Thompson vielfach den Vorwurf des Kulturalismus eingebracht: „ In dem am meisten ‚ö konomischen ’ oder, wenn man so will, ‚ strukturellen ’ Kapitel von The Making [nämlich das Kapitel „Ausbeutung“, E.G.] scheint der Angriff auf verschiedene Arten von Ökonomismus den Boden für die Analyseökonomischer Verhältnisseüberhaupt zu beseitigen. “ 80 Angesichts des heutzutage (nicht nur hinsichtlich der Geschichtswissenschaft) tatsächlich weitgehend „beseitigten Bodens“ für die Analyse ökonomischer Verhältnisse wäre nun - 20 Jahre später - wohl weniger Thompson und sein MEWC zu kritisieren als vielmehr die sich einstmals als kritische Linksintellektuelle verstehenden Rezipienten, denen die allerdings notwenige Thompsonsche Kritik an einem verkürzten Ökonomismus zum Signal für einen eh schon längst beschlossenen Frieden mit den Verhältnissen wurde. Festzuhalten bliebe zum einen, daßder von Thompson beschriebene Klassenformierungsprozeßals kulturelle Aneignungsform, in dem er die Klassenerfahrung grundsätzlich in den Produktionsverhältnissen verankert, im Rahmen einer materialistischen Analyse bleibt. Zum anderen sei mit Hans Medick darauf verwiesen, daßfür Thompson Kultur „ stets mehr als ein bloßer ‚ way of life ’ [war] ; sie war immer auch ein besonderer ‚ way of struggle ’ , der seinen Ort in den Spannungsfeldern sozialer, politischer undökonomischer Auseinandersetzungen hatte, diese konstituierte und gleichzeitig durch sie konstituiert wurde. [...] Dieser Angelpunkt der Einsichten Edward Thompsons verdient gerade angesichts der unterschiedlichen kulturgeschichtlichen ‚ Wenden ’ bedacht zu werden, die für die Sozialgeschichte derzeit in der Diskussion sind. Eine Kulturgeschichte ohne Rückbezug auf die sie konstituierenden sozialen und politischen Momente in Konflikten und Auseinandersetzungen war für Thompson eine ‚ contradictio in adjecto ’ . “ 81
Zum Schlußmöchte ich noch auf einen weiteren Aspekt von Thompsons Klassenwahrnehmung hinweisen, den Lindenberger als „ stumme Funktion “ des Thompsonschen Erfahrungsansatzes charakterisiert.82 Nämlich den Umstand, daßMECW nicht nur von den Erfahrungen der historischen Akteure handelt, sondern implizit immer auch Thompsons eigene politische Erfahrungen im Rahmen der britischen KP als auch im Rahmen der New Left verhandelt werden. Offenkundig gilt dies für seine Kritik an einem ökonomischen Determinismus hinsichtlich der Bestimmung von Klasse und eines daraufhin konstruierten „ idealen Klassenbewußtsein “ durch - wie oben (S. 7) zitiert - „ Partei, Sekte oder Theoretiker “. Daneben findet sich insbesondere im dritten Teil des MECW, also im Zusammenhang mit der Rekonstruktion der radikalen Bewegung, die Problematisierung einer Reihe weiterer politisch-theoretischer Diskurse der Linken: So kritisiert Thompson, indem er sich gegen einen pauschalen Utopismusvorwurf an die Adresse des vormarxistischen Sozialismus - konkret des Owenismus - verwahrt, die Vorstellung einer geradlinigen Fortschrittsgeschichte des Sozialismus, wie sie in Engels’ „ Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft “ zum Ausdruck kommt und stellt damit v.a. das Selbstverständnis derjenigen, die sich im Namen eines „ wissenschaftlichen Sozialismus “ beispielsweise als Sowjetunion auf dem vorläufigen Höhepunkt dieser Fortschrittsgeschichte wähnten, in Frage. Auch Thompsons Thematisierung der Landfrage - „ Als der Landarbeiter oder seine Kinder in die Stadt zogen, blieben gerade diese Wünsche lebendig. [...] Seit Spences Zeiten bis zum Land Plan der Chartisten und darüber hinaus taucht die Sehnsucht nach Land immer wieder auf. “ 83 - liest sich wie ein Affront gegen die stalinistische Zwangskollektivierung. In denselben, v.a. an marxistisch-leninistische Diskurse anknüpfenden, Zusammenhang, gehören die oben bereits erwähnte Diskussion um das Urteil der „ Kleinbürgerlichkeit “ oder die Kritik an einer pauschalen Verurteilung der Maschinenstürmerei als „ rückwärtsgewandt “ und „ fortschrittsfeindlich “. Daneben werden diverse Diskussionen und Probleme der Linken aufgegriffen, die zwar ebenfalls Thompsons spezifischen Erfahrungen entstammen, aber zweifellos bis heute aktuell sind, wie das in den Kapiteln zum Methodismus diskutierte Phänomen der freiwilligen Unterwerfung, ein - wie Lindenberger es formuliert - „ spätestens seit dem Faschismus in der Linken theoretisch wie empirisch ungelöstes Phänomen “ 84, der von Thompson betonte zentrale Stellenwert elementarer demokratischer Rechte sowie die Frage von Massenbasis, Organisation und Führung, die Frage der Vermittlung, das Problem von Spitzeln und Provokateuren und die Frage der Gewalt. Thompsons MECW mag bezüglich der historischen Forschung in einigen Punkten überholt, ergänzt und spezifiziert sein. Hinsichtlich der hier erwähnten, unterschwellig präsenten Diskussionen und Probleme, insbesondere der zuletzt genannten, dürfte jeder Leser, der schon einmal in einer sozialen Bewegung engagiert war - bishin zur jüngsten Anti-Globalisierungsbewegung - auch an eigene Erfahrungen erinnert werden.
Literatur:
- Ästhetik und Kommunikation, H. 33 (1978), S. 21-32: Ein Interview mit E.P. Thompson.
- Autonomie Neue Folge, Nr. 14. Hrsg. Kollektiv der Buchläden Schwarze Risse Berlin/Rote Straße Göttingen/Kleine Freiheit Gießen, 2. Aufl.1987.
- Chun, Lin: Wortgewitter. Die britische Linke nach 1945, Hamburg 1996.
- Evans, Richard J.: Die History Workshop Bewegung in England, in: Geschichte entdecken. Erfahrungen und Projekte der neuen Geschichtsbewegung, hrsg. v. Hannes Heer, Volker Ullrich, Hamburg 1985, S. 37-45.
- Gailus, Manfred; Lindenberger, Thomas: Zwanzig Jahre „moralische Ökonomie“. Ein sozialhistorisches Konzept ist volljährig geworden, in: GG, H. 20 (1994), S. 469-477.
- Groh, Dieter: Zur Einführung, in: Edward P. Thompson, Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19.Jahrhunderts, a. d. Engl. Frankfurt a.M. 1980, S. 5-28.
- Heer, Hannes; Ullrich, Volker: Die „neue Geschichtsbewegung“ in der Bundesrepublik. Antriebskräfte, Selbstverständnis, Perspektiven, in: Geschichte entdecken. Erfahrungen und Projekte der neuen Geschichtsbewegung, hrsg. v. Hannes Heer, Volker Ullrich, Hamburg 1985, S. 9-37.
- Iggers, Georg G.: Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang, 2. Aufl. Göttingen 1996.
- Jones, Gareth Stedman: Klassen, Politik, Sprache: Für eine theorieorientierte Sozialgeschichte, a. d. Engl. Münster, 1988.
- Johnson, Richard: Edward Thompson, Eugene Genovese und die sozialistisch- humanistische Geschichtsschreibung, a. d. Engl. in: Das Argument, H. 119 (1980), S. 39-49.
- Lindenberger, Thomas: Das „Empirische Idiom“: Geschichtsschreibung, Theorie und Politik in The Making of the English Working Class, in: PROKLA, H. 70 (1988), S. 167-188.
- Lottes, Günther: Kopfgeburten der Sozialgeschichte - Ausgrabungen von unschätzbarem Wert. Über die Suggestivkraft von Edward P. Thompsons Klassiker The Making of the English Working Class aus Anlaßder deutschen Übersetzung, in: NPL, Jahrg. XXXII/3 (1987), S. 477-489.
- Ders.: Popular Culture in England (16.-19 Jahrhundert), in: Francia, Bd. 11 (1983), S. 640-667.
- Medick, Hans: E.P. Thompson und sein ‚empirisches Idiom’. Bemerkungen zu Werk und Wirkung eines außergewöhnlichen Historikers, in: Historische Familienforschung. Ergebnisse und Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag, Frankfurt a.M., New York 1997, S. 69-82.
- Roth, Karl-Heinz: Edward P. Thompson (1924-1993): Historiker, Politiker und Theoretiker der neuen Linken. Nachruf in: 1999, H. 2 (1994), S. 163-171.
- Spohn, Alfred: Geschichte des Marxismus - zur Kontroverse zwischen E.P. Thompson und P. Anderson, in: PROKLA, H. 43 (1981), S. 61-84.
- Ders.: Klassentheorie und Sozialgeschichte. Ein kritischer Vergleich der klassengeschichtlichen Interpretation der Arbeiterbewegung durch Edward P. Thompson und Jürgen Kocka, in: PROKLA, H. 61 (1985), S. 126-138.
- Thompson, Edward Palmer: Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, a. d. Engl., Frankfurt a.M. 1987.
- Thompson, Edward Palmer: Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, a. d. Engl., Frankfurt a.M. 1980.
- Vester, Michael: Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess. Die Entstehung antikapitalistischer Theorie und Praxis in England 1792-1848, 2.Aufl. Frankfurt a.M. 1972
- Ders.: Edward Thompson als Theoretiker der „New Left“ und als historischer Forscher. Notizen zu einer Bio-Bibliographie, in: Ästhetik und Kommunikation, H. 33 (1978), S. 33-44.
- Ders.: Edward Thompson und die Krise des Marxismus, in: E.P. Thompson, Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, a. d. Engl., Frankfurt a.M. 1980, S. 13-38.
- Welskopp, Thomas: Westbindung auf dem „Sonderweg“. Die deutsche Sozialgeschichte vom Appendix der Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft, in: Geschichtsdiskurs Band 5: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945, hrsg. v. Wolfgang Küttler, Jörn Rüsen, Ernst Schulin, Frankfurt a.M. 1999, S. 191-237.
[...]
1 Edward P. Thompson, Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, a. d. Engl.; Frankfurt a.M. 1987.
2 Vergl. Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 14
3 Ein Interview mit E.P. Thompson (gekürzte Übersetzung aus Radical History Review 4/1976), in: Ästhetik und Kommunikation. H. 33 (1978), S. 24.
4 Lin Chun, Wortgewitter. Die britische Linke nach 1945, Hamburg 1996, S. 27.
5 Michael Vester, Edward Thompson als Theoretiker der „New Left” und als historischer Forscher. Notizen zu einer Bio-Bibliographie, in: Ästhetik & Kommunikation. H. 33 (1978), S. 34.
6 Ein Interview mit E.P.Thompson, a.a.O., S. 24.
7 Ein Interview mit E.P.Thompson, a.a.O., S. 25 und 31-32.
8 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 14.
9 Vergl. hierzu: Richard J. Evans, Die „History Workshop“ Bewegung in England, in: Hannes Heer, Volker Ullrich (Hrsg.), Geschichte entdecken. Erfahrungen und Projekte der neuen Geschichtsbewegung. Hamburg 1985, S. 37-45.
10 Institut für sozialhistorische Forschung, Vorrede. in: E.P. Thompson, Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, a. d. Engl., Frankfurt a.M. 1980, S.9.
11 Chun, Wortgewitter, a.a.O., S. 42-43.
12 Ebenda, S. 49.
13 Vergl. ebenda, Kapitel II: „Traditionen und Kultur 1957-1962”, S. 59 ff.
14 Ebenda, S. 114.
15 Vergl. Alfred Spohn, Geschichte des Marxismus - zur Kontroverse zwischen E.P. Thompson und P. Anderson, in: PROKLA, H. 43 (1981), S. 61-84.
16 Ein Interview mit E.P.Thompson, a.a.O., S. 23/24
17 Thomas Lindenberger, Das „Empirische Idiom”: Geschichtsscheibung, Theorie und Politik in The Making of the English Working Class, in: PROKLA, H. 70 (1988) S. 167-188.
18 „ Thompson lehnt es heute ab, sich als Marxist (oder Anglomarxist) bezeichnen zu lassen, (...) sondern versteht sich als Partisan der realen Bewegungen (nicht Institutionen) von Kommunisten, Sozialisten, Proletariern, Labourites - und auch jenen, die heute auf andere Weise als die traditionale Arbeiterbewegung nach Alternativen zum Leben unter kapitalistischen oderähnlichen Verhältnissen suchen ” , so Vester 1980 in seiner Einleitung zur deutschen Ausgabe von Thompsons „ Poverty of the Theory ”. Michal Vester; Edward Thompson und die Krise des Marxismus, in: E.P. Thompson, Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, a. d. Engl., Frankfurt a.M. 1980, S. 15.
19 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 11.
20 Die Verwendung von „Konkretes, Reales” für das im englischen Original verwendete „thing” stammt nicht von der Übersetzergruppe, sondern vom Suhrkamp-Lektorat. Erstere hatte wortwörtlich „Ding” vorgeschlagen, „ da es Thompson um die Opposition Ding-als-Statisches - Beziehung-als-Prozeßgeht, während die Fehlinterpretation des Verlages (typisch deutsch?) nur den Gegensatz Ding-als-Konkretes - Beziehung-als- Abstraktes/Irreales kennt. ” Lindenberger, empirisches Idiom, a.a.O., Anmerkung 8, S. 186.
21 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 8.
22 Ausführlich: Thomas Welskopp, Westbindung auf dem „Sonderweg”. Die deutsche Sozialgeschichte vom Appendix der Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft, in: Wolfgang Küttler, Jörn Rüsen, Ernst Schulin (Hrsg.), Geschichtsdiskurs, Band 5: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945, Frankfurt a.M. 1999, S. 191-237; darin auch kritisch zur Traditionslinie der Historischen Sozialwissenschaft zur Strukturgeschichte der fünfziger Jahre und deren Kontinuität zur Kulturraumsoziologie und Volksgeschichte des NS.
23 Vergl. z.B.: Georg G. Iggers, Geschichtswissenschaft im 20.Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang, 2. Aufl. Göttingen 1996.
24 Hannes Heer, Volker Ullrich, Die „neue Geschichtsbewegung” in der Bundesrepublik. Antriebskräfte, Selbstverständnis, Perspektiven, in: dies., Geschichte entdecken, a.a.O., S. 9-37.
25 Zur Wirkungsgeschichte des „moral-economy”-Konzepts: Manfred Gailus/Thomas Lindenberger, Zwanzig Jahre „moralische Ökonomie”. Ein sozialhistorisches Konzept ist volljährig geworden, in: GG, H. 20 (1994), S. 469-477.
26 Groh, Dieter: Zur Einführung, in: Edward P. Thompson, Plebeische Kultur und moralische Ökonomie.
Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, a. d. Engl. Frankfurt a.M. 1980, S. 5-28.
27 So zum Beispiel Robert Berdahl u.a. (Hrsg.), Klassen und Kultur. Sozialanthropologische Perspektiven der Geschichtsschreibung, Frankfurt a. M. 1982, oder in jüngerer Zeit Manfred Gailus/Heinrich Volkmann (Hrsg.), Der Kampf um das tägliche Brot. Nahrungsmangel, Versorgungspolitik und Protest 1770-1990, Opladen 1994.
28 Zum Beispiel die bereits erwähnten Iggers, Geschichtswissenschaft; Kocka, Geschichte und Aufklärung sowie Heer/Ullrich, Geschichte entdecken, aber auch: Peter Borscheid, Alltagsgeschichte - Modetorheit oder neues Tor zur Vergangenheit, in: Wolfgang Hartwig (Hrsg.), Über das Studium der Geschichte, München 1990, S. 389
29 Michael Vester, Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess. Die Entstehung antikapitalistischer Theorie und Praxis in England 1792-1848, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1972, S. 35.
30 Lindenberger, empirisches Idiom, a.a.O., S. 168.
31 Groh, Zur Einführung, a.a.O., S.6.
32 Michael Vester, Was dem Bürger sein Goethe, ist dem Arbeiter seine Solidarität. Zur Diskussion der ‚Arbeiterkultur‘, in: Ästhetik & Kommunikation, H .24 (1976), S. 62-72, ders., Bio-Bibliograhpie, a.a.O., S. 33- 45.
33 Vester, Krise des Marxismus, a.a.O., S. 16.
34 Ästhetik & Kommunikation, H. 24 (1976), S. 35-38 sowie Das Argument, 22. Jg. (1980), S.39-49.Das 1964 von Richard Hoggart gegründete und seit den Siebzigern von Stuart Hall und Richard Johnson geleitete CCCS war der erste institutionalisierte Rahmen dessen, was heute als „ Cultural Studies ” bezeichnet wird, und inhaltlich sowie personell untrennbar mit der britischen Linken verknüpft. Vergl. Chun, Wortgewitter, sowie Roger Bromley u.a. (Hrsg.), Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung, a. d. Engl., Lüneburg 1999.
35 Spohn, Geschichte und Marxismus, a.a.O., S. 61-84. Ders., Klassentheorie und Sozialgeschichte. Ein kritischer Vergleich der klassengeschichtlichen Interpretation der Arbeiterbewegung durch Edward P. Thompson und Jürgen Kocka, in: PROKLA, H. 61 (1985), S. 126-138. Ders., Krise des Marxismus und Sozialgeschichte der Arbeiterbewegung, in: Rolf Ebbighausen, Friedrich Tiemann (Hrsg.), Das Ende der Arbeiterbewegung in Deutschland? Ein Diskussionsband zum sechzigsten Geburtstag von Theo Pirker. (Schriften des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin Bd. 43), Opladen 1984, S. 128-144..
36 Gailus, Lindenberger, Zwanzig Jahre „moralische Ökonomie”, a.a.O., S. 470-471.
37 Autonomie NF Nr. 14, Hrsg.: Schwarze Risse Berlin/Rote Straße Göttingen/Kleine Freiheit Gießen, 2. Aufl. 1987, S. 15 ff. Zur Bedeutung Thompsons im Rahmen der Autonomieredaktion vergl. Frombeloff (Hrsg.), „... und es begann die Zeit der Autonomie.” Politische Texte von Karl Heinz Roth, Hamburg 1993, S. 21 und 160f.
38 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O,. S.11 u. 12.
39 Vergl. Groh, Einführung, a.a.O., S. 6.
40 Günther Lottes, Kopfgeburten der Sozialgeschichte - Ausgrabungen von unschätzbaren Wert. Über die Suggestivkraft von Edward P. Thompsons Klassiker The Making of the English Working Class aus Anlaßder deutschen Übersetzung, in: NPL, Jahrg. XXXII/3 (1987), S. 477.
41 Hans Medick, E.P. Thompson und sein ‚empirisches Idiom‘. Bemerkungen zu Werk und Wirkung eines außergewöhnlichen Historikers, in: Historische Familienforschung. Ergebnisse und Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag, Frankfurt, New York 1997, S. 69-82.
42 Ebenda, S. 74.
43 Vester, Krise des Marxismus, a.a.O., S. 23.
44 Roth, Karl-Heinz: Edward P. Thompson (1924-1993): Historiker, Politiker und Theoretiker der neuen Linken, Nachruf in: 1999, H.2 (1994), S. 166.
45 Ein Interview mit E.P. Thompson, a.a.O., S. 22.
46 Lindenberger, empirisches Idiom, a.a.O., S.183.
47 Thompson, Arbeiterklasse a.a.O., S.27. Die im Folgenden aus Platzgründen im Text genannten Seitenzahlen beziehen sich alle auf Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O.
48 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 620 und 644
49 Ebenda, S. 63.
50 Vergl. hierzu v.a. Kapitel zwei, ebenda S. 29ff.
51 In Brontoёs „Shirley“ wird ein zur Legende gewordener Ludditen-Überfall auf eine größere Fabrik in Spin Valley, in der bereits Rauh-und Schermaschinen eingesetzt wurden, aus der Sicht der besitzenden Klassen geschildert.
52 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 126 und S. 129.
53 Ebenda, „Die geschlossene Gesellschaft“ Kapitel 14. II, S. 567-580, Zitate S. 569, 578 und 580.
54 Vergl. oben Fußnote 18.
55 Thompson, Arbeiterklasse, S.7.
56 Ebenda.
57 Thompson, Arbeiterklasse, S. 963
58 E.P.Thompson, Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, a. d .Engl. Frankfurt a.M. 1980, S. 160.
59 Thompson, Arbeiterklasse, S.8.
60 Ebenda.
61 Ebenda, S.9.
62 Ebenda, S.452 und S.453.
63 Ebenda, S. 937, vergl. auch S. 962.
64 Ebenda, S. 924. Die im folgenden im Text genannten Seitenzahlen sind beispielhafte Nachweise für die zitierten Bezeichnungen und Begrifflichkeiten. Sie beziehen sich alle auf Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O.
65 Ebenda, S. 51.
66 Ebenda, S. 248.
67 Ebenda, S. 702.
68 Günther Lottes, Popular Culture in England (16.-19. Jahrhundert), in: Francia, Bd. 11 (1983), S. 640.
69 Gareth Stedman Jones, Klassen, Politik, Sprache: Für eine theorieorientierte Sozialgeschichte, a. d. Engl., Münster, 1988, S. 300, 301.
70 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O. S. 702.
71 Ebenda, S. 875.
72 Ebenda, S. 730.
73 Ebenda, S. 824.
74 Ebenda, S. 825.
75 Ein Interview mit E.P. Thompson, a.a.O., S. 29.
76 Vergl. Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 283.
77 Ebenda, S. 207.
78 Ebenda, S. 941.
79 Ebenda, S. 217-218, 218-219.
80 Richard Johnson: Edward Thompson, Eugene Genovese und die sozialistisch-humanistische Geschichtsschreibung, a. d. Engl., in: Das Argument, Nr. 119, 22. Jahrg., 1980, S. 46.
81 Medick, E.P. Thompson, a.a.O. S. 79-80.
82 Lindenberger, empirisches Idiom, a.a.O., S. 178ff.
83 Thompson, Arbeiterklasse, a.a.O., S. 249 u.250.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse”?
Der Text ist eine umfassende Auseinandersetzung mit E.P. Thompsons Werk „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse”. Er analysiert den biographischen und gesellschaftlichen Kontext des Buches, seine Rezeption in Deutschland, Thompsons Darstellungsweise und Quellen, sowie seine Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen.
Wer ist E.P. Thompson?
Edward Palmer Thompson (1924-1993) war ein britischer Historiker, Sozialist und Friedensaktivist. Er ist vor allem für seine Arbeit über die Geschichte der englischen Arbeiterklasse bekannt.
Was sind die wichtigsten Thematiken in „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse”?
Zu den wichtigsten Thematiken gehören die Formierung des Klassenbewusstseins der englischen Arbeiterklasse zwischen 1790 und 1830, die Auswirkungen der Industriellen Revolution, die Rolle des plebejischen Radikalismus, die Bedeutung kultureller Traditionen und die Analyse von Ausbeutung.
Wie wird Thompsons Klassenbegriff dargestellt?
Thompson lehnt einen statischen, überhistorischen Klassenbegriff ab. Er betrachtet Klasse als einen dynamischen Prozess, der sich in den Beziehungen zwischen Menschen und im Verhältnis zu anderen Klassen abspielt. Klassenformierung wird durch gemeinsame Erfahrungen und kulturelle Interpretationen vermittelt.
Welche Quellen verwendete Thompson für seine Analyse?
Thompson stützte sich auf eine breite Palette von Quellen, darunter unveröffentlichte Akten, zeitgenössische Periodika, Monographien, Liedgut, Moralgeschichten, Allegorien, Legenden, Volkslyrik und Romane.
Wie wurde Thompsons Werk in Deutschland rezipiert?
Die Rezeption von Thompsons Werk in Deutschland setzte vergleichsweise spät ein. Anfänglich fand es vor allem in linksakademischen Kreisen und im Rahmen der Alltagsgeschichte Beachtung. Später wurde es auch von der Geschichtswerkstättenbewegung aufgegriffen.
Was ist der "moral-economy"-Begriff im Kontext von Thompsons Arbeit?
Thompson verwendet den Begriff der "moralischen Ökonomie", um die Widerstände gegen die ausschließliche Unterwerfung von Lebensmittelpreisen und Löhnen unter das Diktat des freien Marktes zu beschreiben. Brotunruhen werden als Verteidigung einer älteren "moralischen Ökonomie" interpretiert.
Welche Kritik wurde an Thompsons Ansatz geübt?
Thompson wurde der Kulturalismus vorgeworfen, da er die Produktionsverhältnisse vor allem hinsichtlich ihrer kulturell-psychologischen Aspekte analysiert. Kritiker bemängelten, dass er damit den Boden für die Analyse ökonomischer Verhältnisse beseitige.
Welche Rolle spielt die Religion in Thompsons Analyse?
Thompson untersucht die Rolle religiöser Sekten, insbesondere des Methodismus, als Disziplinierungsagentur für die neue industrielle Gesellschaft. Er fragt, warum so viele arbeitende Menschen bereit waren, sich dem Methodismus zu unterwerfen.
Wie charakterisiert Thompson die radikale Bewegung?
Thompson charakterisiert die radikale Bewegung als eine sozial indifferente Bewegung, die aber zunehmend von der Arbeiterklasse getragen wurde. Er unterscheidet zwischen bürgerlichen Reformern und Reformern aus der Arbeiterklasse, die unterschiedliche politische Standpunkte und Kulturen vertraten.
- Quote paper
- Eva-Bettina Görtz (Author), 2002, Wahrnehmung gesellschaftlicher Klassen: E.P. Thompsons Entstehung der englischen Arbeiterklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106184