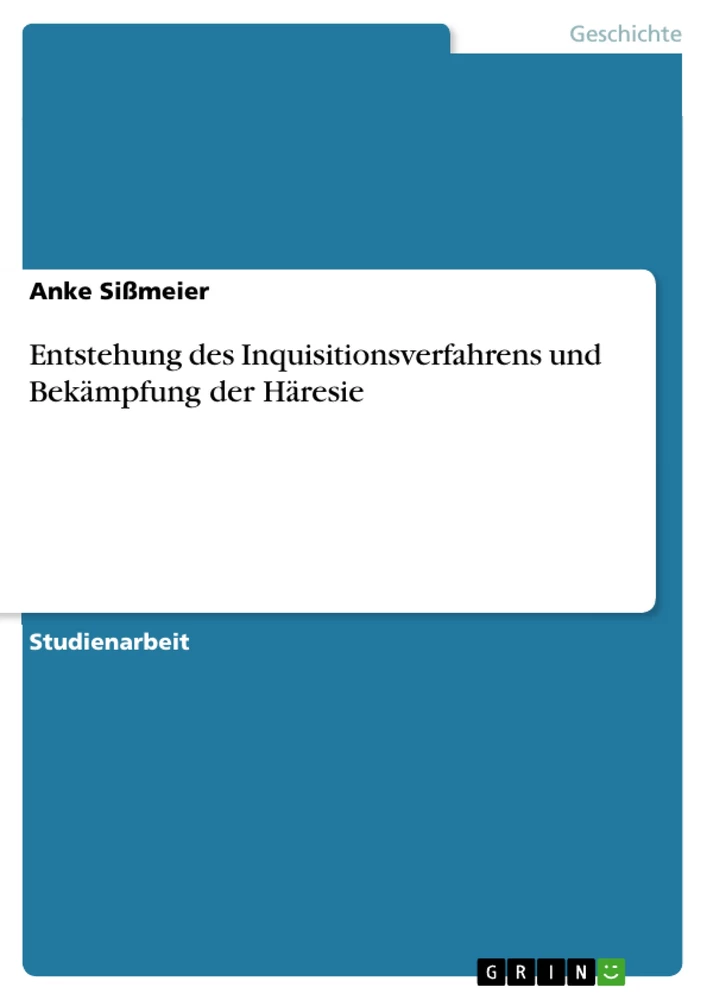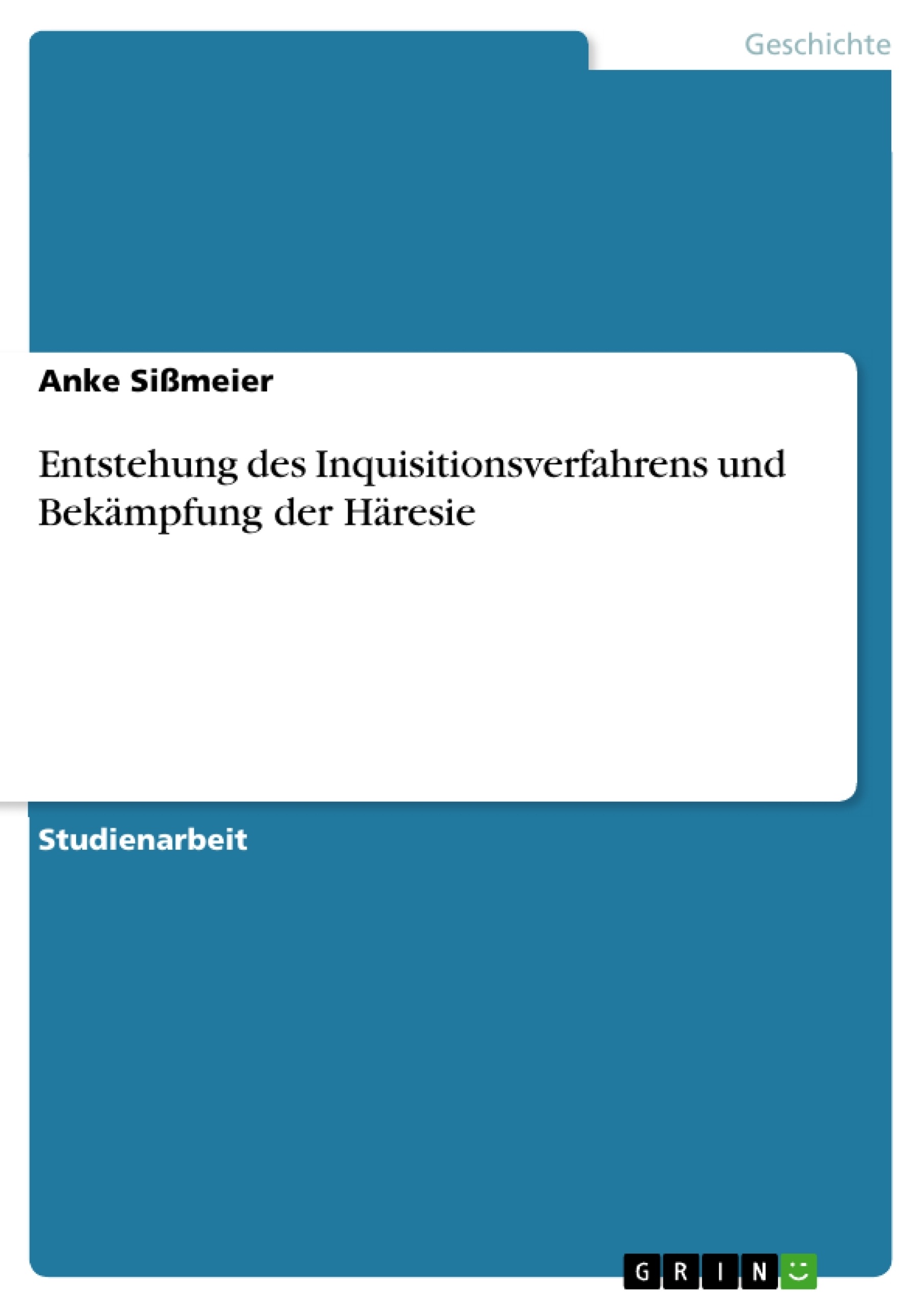Die Inquisition des Mittelalters wird heute in weiten Kreisen als ein emotional-düsteres Thema aufgefasst, das automatisch mit Unrecht, Folter und Gewalt assoziiert.[...]Doch dass der ursprüngliche Inquisitionsprozess kaum etwas mit der Verbrennung von Ketzern auf Scheiterhaufen zu tun hat, sondern sogar eine grundlegende Verbesserung des damals vorherrschenden Prozessrechts darstellte, ist heute gemeinhin unbekannt.
Aus diesem Grund wird sich diese Hausarbeit mit der Entstehung der Inquisition und ihrem eigentlichen Charakter befassen. Weiterhin soll der Zusammenhang zwischen dem Inquisitionsverfahren unter Innocenz III. und den summarischen Ketzerprozessen des Spätmittelalters herausgestellt werden. Somit wird einhergehend mit der chronologischen Darstellung der Entwicklung der Inquisition das prozessuale Vorgehen gegen die Häresie behandelt. Wie kam es zu den summarischen Ketzerprozessen? Welche Rolle spielte hierbei die Entstehung des Inquisitionsverfahrens? Eine zentrale Quelle zu diesem Themenbereich stellt die Dekretale ad abolendam aus dem Jahre 1184 dar. Die doppelte Gesetzgebung von Papst Lucius III und Kaiser Friedrich I. Barbarossa repräsentiert eine erste Systematisierung der Ketzerverfolgung und Konkretisierung im strafrechtlichen Vorgehen gegen die Häresie.
Das erste Kapitel des Hauptteils beschäftigt sich mit der Frage, woraus sich das Verfahren der Inquisition entwickelt hat. Als Grundlage werden Prozessformen des Römischen Rechts sowie die Etablierung der katholischen Kirche als neue Jurisdiktionsgewalt kurz dargelegt. Daraufhin folgt eine Skizzierung der zwei wesentlichen Verfahrensweisen, derer man sich nach Verfall des Römischen Reiches bediente: das Sendgerichts- und Infamationsverfahren [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozessrechts
- Römisches Strafprozessrecht
- Die Kirche als neue Jurisdiktionsgewalt
- Die verschiedenen Prozessformen nach dem Verfall des Römischen Reiches
- Das Sendgerichtsverfahren gegen Laien
- Das Infamationsverfahren gegen Geistliche
- Die strafrechtliche Verfolgung der Häresie
- Häresie als crimen laesae maiestatis und daraus entstehende Folgen
- Die Einführung der bischöflichen Ketzerinquisition: ad abolendam
- Inhalte der Dekretale
- Auswirkungen und Einschätzungen der doppelten Gesetzgebung
- Die Entstehung des Inquisitionsverfahrens unter Papst Innocenz III.
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entstehung des Inquisitionsverfahrens im Mittelalter und dessen Zusammenhang mit der Bekämpfung der Häresie. Ziel ist es, die Entwicklung des Verfahrens zu beschreiben und dessen Charakter im Vergleich zu früheren Prozessformen zu beleuchten. Besonders die Rolle der Dekretale ad abolendam wird hervorgehoben.
- Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozessrechts im Kontext des römischen Rechts und der kirchlichen Jurisdiktion.
- Die Häresie als Verbrechen und die ersten strafrechtlichen Reaktionen der Kirche.
- Die Dekretale ad abolendam und ihre Bedeutung für die bischöfliche Ketzerinquisition.
- Der Beitrag von Papst Innocenz III. zur endgültigen Ausgestaltung des Inquisitionsverfahrens.
- Der Vergleich des Inquisitionsverfahrens mit älteren Verfahren.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die gängige, negative Wahrnehmung der mittelalterlichen Inquisition dar und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: die Untersuchung der Entstehung des Inquisitionsverfahrens und seines Zusammenhangs mit der Bekämpfung der Häresie, insbesondere unter Bezugnahme auf die Dekretale ad abolendam. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Fortschritts im mittelalterlichen Prozessrecht durch die Einführung des Inquisitionsverfahrens und der Klärung des Ursprungs der summarischen Ketzerprozesse des 13. Jahrhunderts.
Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozessrechts: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozessrechts, ausgehend von römischen Verfahrenstypen wie dem Cognitial- und dem Akkusationsverfahren. Es beleuchtet die Rolle der katholischen Kirche als neue Jurisdiktionsgewalt und deren Einfluss auf die Gestaltung des Strafprozessrechts. Die Entstehung der kirchlichen Jurisdiktion wird erklärt, und es werden die beiden wesentlichen Verfahrensweisen nach dem Verfall des Römischen Reiches, das Sendgerichts- und das Infamationsverfahren, vorgestellt. Das Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der späteren Entwicklung des Inquisitionsverfahrens.
Die strafrechtliche Verfolgung der Häresie: Dieses Kapitel behandelt die zunehmende Problematik der Häresie aus Sicht der Kirche. Es analysiert das rechtliche Verständnis des häretischen Verbrechens und die ersten strafrechtlichen Reaktionen auf geistlicher Ebene. Die Bedeutung der doppelten Gesetzgebung von Papst Lucius III. und Kaiser Friedrich I. Barbarossa sowie der Inhalte und Auswirkungen der Dekretale ad abolendam für die Entstehung der bischöflichen Ketzerinquisition werden eingehend untersucht. Schließlich wird die Rolle von Papst Innocenz III. bei der endgültigen Festlegung des Inquisitionsprozesses und die Unterschiede zu früheren Verfahren beleuchtet. Das Kapitel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Verbreitung der Häresie und der Entstehung der Inquisition.
Schlüsselwörter
Inquisition, Häresie, Mittelalter, Strafprozessrecht, Römisches Recht, Kanonisches Recht, Ketzerverfolgung, Dekretale ad abolendam, Papst Lucius III., Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Papst Innocenz III., Sendgerichtsverfahren, Infamationsverfahren, prozessuale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Entstehung des Inquisitionsverfahrens im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entstehung des Inquisitionsverfahrens im Mittelalter und seinen Zusammenhang mit der Bekämpfung der Häresie. Sie beleuchtet die Entwicklung des Verfahrens, vergleicht es mit früheren Prozessformen und hebt die Rolle der Dekretale ad abolendam hervor.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozessrechts im Kontext des römischen Rechts und der kirchlichen Jurisdiktion, die Häresie als Verbrechen und die ersten strafrechtlichen Reaktionen der Kirche, die Dekretale ad abolendam und ihre Bedeutung für die bischöfliche Ketzerinquisition, den Beitrag von Papst Innozenz III. zur Ausgestaltung des Inquisitionsverfahrens und einen Vergleich des Inquisitionsverfahrens mit älteren Verfahren (Sendgerichts- und Infamationsverfahren).
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozessrechts, ein Kapitel zur strafrechtlichen Verfolgung der Häresie und ein Resümee. Die Einleitung stellt die Problematik dar und skizziert die Zielsetzung. Das zweite Kapitel beschreibt die Entwicklung vom römischen Recht zur kirchlichen Jurisdiktion. Das dritte Kapitel analysiert die Bekämpfung der Häresie, die Bedeutung der Dekretale ad abolendam und die Rolle von Papst Innozenz III.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Inquisition, Häresie, Mittelalter, Strafprozessrecht, Römisches Recht, Kanonisches Recht, Ketzerverfolgung, Dekretale ad abolendam, Papst Lucius III., Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Papst Innozenz III., Sendgerichtsverfahren, Infamationsverfahren, prozessuale Entwicklung.
Wie wird die Rolle der Dekretale ad abolendam dargestellt?
Die Dekretale ad abolendam wird als zentraler Punkt für die Entstehung der bischöflichen Ketzerinquisition betrachtet. Die Hausarbeit untersucht deren Inhalte und Auswirkungen auf die Entwicklung des Inquisitionsverfahrens.
Welche Rolle spielte Papst Innozenz III. bei der Entwicklung des Inquisitionsverfahrens?
Papst Innozenz III. wird als Schlüsselfigur für die endgültige Ausgestaltung des Inquisitionsverfahrens dargestellt. Seine Rolle und sein Beitrag werden in der Hausarbeit ausführlich beleuchtet.
Wie werden frühere Prozessformen mit dem Inquisitionsverfahren verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht das Inquisitionsverfahren mit älteren Verfahren wie dem Sendgerichts- und dem Infamationsverfahren, um die Fortschritte und Veränderungen im mittelalterlichen Prozessrecht aufzuzeigen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Entstehung des Inquisitionsverfahrens zu beschreiben, seinen Charakter im Vergleich zu früheren Prozessformen zu beleuchten und die Bedeutung der Dekretale ad abolendam hervorzuheben.
- Arbeit zitieren
- Anke Sißmeier (Autor:in), 2002, Entstehung des Inquisitionsverfahrens und Bekämpfung der Häresie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10614