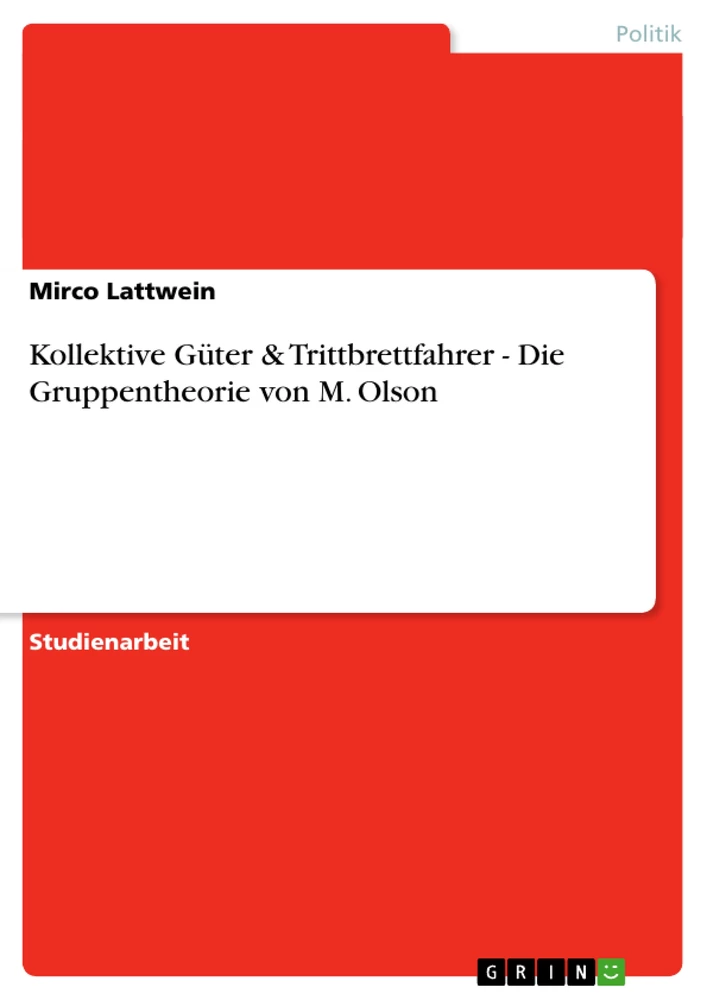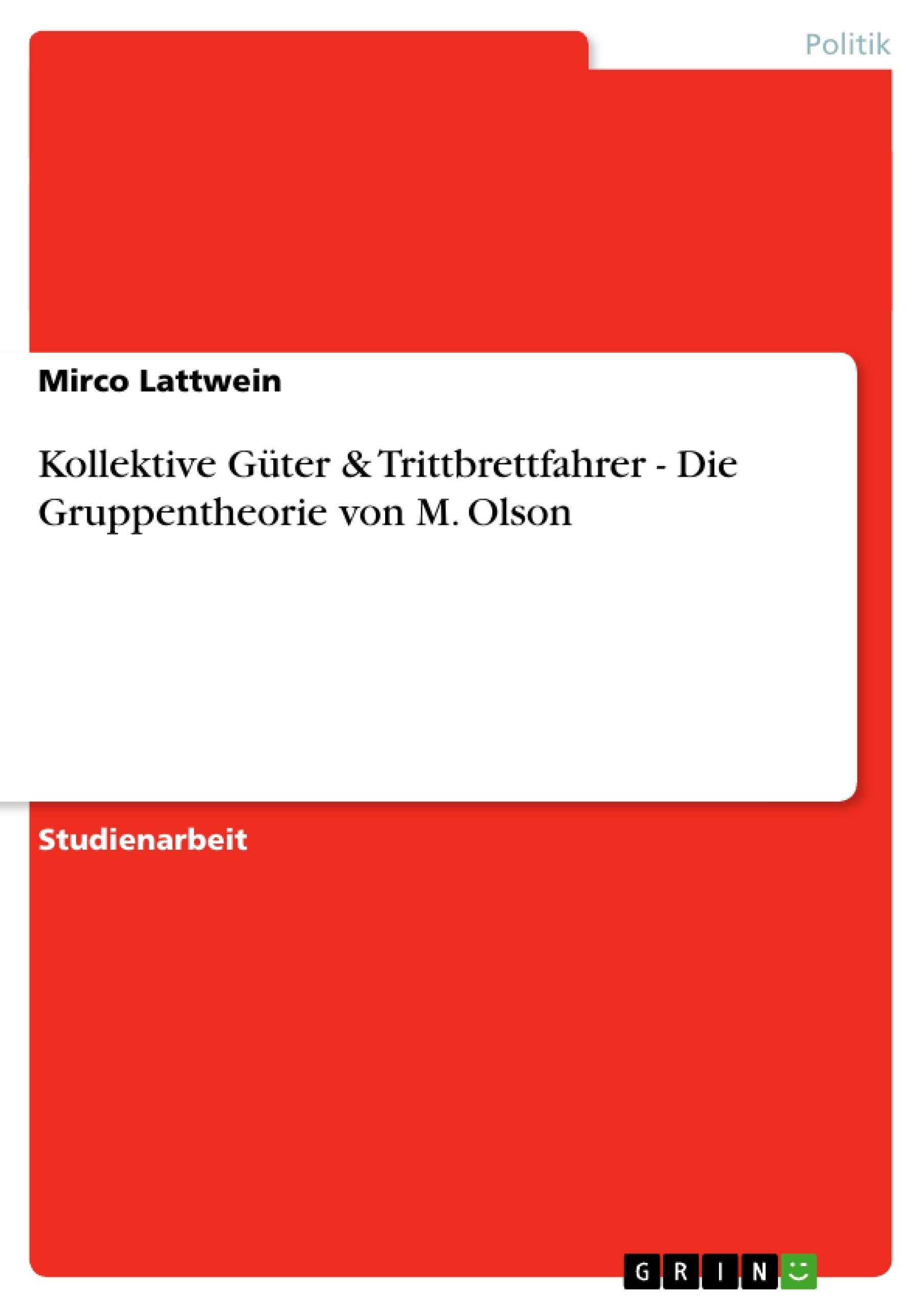Warum schließen sich Menschen zu Gruppen zusammen, und wann scheitert dieses Vorhaben? Diese Frage steht im Zentrum einer ebenso provokanten wie aufschlussreichen Analyse des kollektiven Handelns. Entgegen der landläufigen Meinung, dass größere Gruppen automatisch mehr Einfluss haben, enthüllt dieses Werk die überraschende Logik, die hinter dem Erfolg oder Misserfolg von Interessensverbänden und Organisationen steht. Anstatt sich auf traditionelle Theorien zu verlassen, die menschliches Verhalten als instinktiv oder triebgesteuert abtun, entwirft der Autor ein Modell, das auf dem rationalen Eigeninteresse des Einzelnen basiert. Der Leser wird mit der Erkenntnis konfrontiert, dass die Größe einer Gruppe paradoxerweise deren Fähigkeit zur Durchsetzung ihrer Ziele untergraben kann. Kleine, homogene Gruppen profitieren oft von einem hohen Maß an Kooperation, während große, diffuse Gruppen mit dem Problem des Trittbrettfahrerverhaltens zu kämpfen haben, wo jedes Mitglied versucht, von den Anstrengungen der anderen zu profitieren, ohne selbst einen Beitrag zu leisten. Um dieses Dilemma zu überwinden, bedarf es geschickter Anreizsysteme, die den Einzelnen dazu motivieren, sich aktiv an der Verfolgung gemeinsamer Ziele zu beteiligen. Doch Vorsicht: Die Bereitstellung selektiver Vorteile kann dazu führen, dass das eigentliche Ziel der Gruppe in den Hintergrund tritt und zum bloßen "Nebenprodukt" der individuellen Vorteilsnahme wird. Dieses Buch ist eine unerlässliche Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie Gruppen funktionieren – oder eben nicht. Es bietet wertvolle Einblicke in die Dynamik von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, und liefert praktische Werkzeuge zur Gestaltung effektiver Organisationen. Tauchen Sie ein in die Welt der Gruppentheorie, der kollektiven Güter und selektiven Anreize, und entdecken Sie die verborgenen Mechanismen, die unser Zusammenleben bestimmen. Erfahren Sie, wie rationale Entscheidungen zu irrationalen Ergebnissen führen können, und wie man diese Fallstricke vermeidet. Ein fesselndes Werk, das Ihr Verständnis von Macht, Einfluss und sozialem Wandel nachhaltig verändern wird. Die Gruppendynamik, Interessenvertretung, Rational-Choice-Theorie, Kollektivgüter und Anreizsysteme werden hier auf eine Art und Weise beleuchtet, die sowohl akademisch fundiert als auch praktisch relevant ist. Lassen Sie sich von den überraschenden Erkenntnissen inspirieren und entwickeln Sie neue Strategien für eine erfolgreiche Interessenvertretung.
Gliederung
1. Einleitung
2. Definitionen/Begriffserklärungen
2.1 Gruppe
2.2 Interessenverbände
2.3 öffentliche/kollektive Güter
3. Die ,,klassische" bzw. ,,traditionelle" Gruppentheorie
3.1 Überblick
3.2 Olsons Kritik
4. Mancur Olsons Gruppentheorie
4.1 Die Durchsetzung der Interessen in Abhängigkeit von der Gruppengröße
4.1.1 Die privilegierte Gruppe
4.1.2 Die mittelgroße Gruppe
4.1.3 Die latente Gruppe
4.2 Selektive Anreize
4.3 Die Theorie vom ,,Nebenprodukt"
5. Schlussbemerkungen
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Eine Teildisziplin der Politikwissenschaft ist, menschliches Handeln zu erklären und zu analysieren. Dazu sind im Laufe der Zeit zahlreiche Modelle entwickelt worden, die eben dies versuchen. Eines dieser Modelle geht von einem Modellindividuum aus, das ausschließlich aufgrund rationaler Entscheidungen handelt: der ,,homo oeconomicus" - der wirtschaftlich handelnde und denkende Mensch - charakterisiert als Nutzenmaximierer und Kostenminimierer. Anders formuliert: Er maximiert seinen Nettonutzen.1 Dieses Modell ist bekannt als ,,Rational-Choice"-Modell (im folgenden: RC).
Es gibt - analog zur Wirtschaftswissenschaft - zwei Ebenen, Handeln zu erklären: Die Mikround die Makroebene. Während die Mikroebene das Handeln des Individuums untersucht, beschäftigt sich die Makroebene mit den ,,aggregierten Handlungen" der Individuen. Sie untersucht also gruppendynamisches bzw. kollektives Handeln.
Einen wichtigen Beitrag zum RC stellt Mancur Olsons Werk ,,Logik des kollektiven Handelns" dar: Olson nimmt in diesem Buch bezug auf die ,,traditionelle" Gruppentheorie und übt heftige Kritik. Da seiner Meinung nach manche traditionelle Schlussfolgerungen empirisch nicht nachweisbar seien, entwickelt er neue Prämissen, anhand denen er zu Folgerungen kommt, die den klassischen Folgerungen diametral entgegenstehen.
Die Hauptthese Olsons lautet, je größer eine (Interessen-)Gruppe ist, desto geringer ist der Durchsetzungsgrad ihrer Interessen. Damit widerspricht er der klassischen Gruppentheorie, die besagt, je größer eine Gruppe ist, desto besser kann sie ihre Interessen formulieren und durchsetzen.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit M. Olsons Gruppentheorie. Dazu werden eingangs die Begriffe ,,Gruppe", ,,Interessenverbände" sowie ,,kollektive Güter" erklärt, um Missverständnisse zu vermeiden. Danach wird ausgehend von der Darstellung der traditionellen Gruppentheorie die Kritik Olsons an dieser Theorie skizziert, um anschließend die Logik des kollektiven Handelns näher zu beleuchten.2
Ziel der Arbeit ist es, Olsons Theorie vom kollektiven Handeln darzustellen und dessen Aussagen anhand von Beispiele n greifbar zu machen.
2. Definitionen/Begriffserklärungen
2.1 Gruppe
3 Der Begriff ,,Gruppe" wird in den Sozialwissenschaften unscharf und mehrdeutig benutzt für Menge, Masse bzw. abgrenzbare Zahl von Personen, die besondere soziale Beziehungen untereinander und gegenüber Außenstehenden unterhalten.
Die Gruppe hat eine mehr oder weniger verbindende soziale Struktur und die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern sind relativ regelmäßig und zeitlich überdauernd. Die Gruppe kennzeichnet ein bestimmtes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und der Abgrenzung gegenüber Dritten, ihr Handeln ist an gemeinsamen Zielen und Interessen ausgerichtet.
Gruppen können unterschieden werden in Primär- und Sekundärgruppen: die Primärgruppe zeichnet sich aus durch spontane oder enge persönliche Beziehungen (wie z.B. Familie, Freundschaft), während die Sekundärgruppe lediglich auf bestimmte Zielsetzungen und deren Erreichung ausgerichtet ist.
2.2 Interessenverbände
Interessenverbände sind ,,Zusammenschlüsse von Personen bzw. Korporationen mit dem Ziel, in organisierter Form gemeinsame Interessen zu vertreten und durchzusetzen."4 Wichtige Interessenverbände sind Parteien und Landsmannschaften als Vertreter politischer Interessenverbände und Gewerkschaften, Unternehmer-, Berufsverbände und Kammern als Beispiele wirtschaftlicher Interessenverbände.5
2.3 Öffentliche/kollektive Güter
Öffentliche Güter (engl. public goods) (oder kollektive Güter) sind von staatlichen und von bestimmten öffentlichen Institutionen (z.B. Interessenverbänden) angebotene Güter und Dienstleistungen, die dem Prinzip der Nichtausschließbarkeit unterliegen (Beispiele für öffentliche Güter sind u.a. die Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit, das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel, Umweltschutz, Tarifverträge, etc.), das bedeutet, dass Bewohner eines bestimmten Gebietes oder Angehörige einer bestimmten sozialen Kategorie in ungeteilter Weise Nutznießer bestimmter bereitgestellter Güter sind, die man ihnen nicht vorenthalten kann.6 Olson definiert ,,Kollektivgut" als ,,jedes Gut, das den anderen Personen einer Gruppe praktisch nicht vorenthalten werden kann."7
Als ,,praktisch nicht vorenthaltbar" gelten auch Kollektivgüter, die man theoretisch zwar teilen kann, bei denen die Teilung aber unpraktisch oder unwirtschaftlich ist.
Es ist nun gleichgültig, ab die Gruppe groß wie eine Nation oder klein wie ein Verein ist. Im Hinblick auf die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder bemühen sich alle Organisationen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, das unteilbar für alle Mitglieder ist. Dieses Ziel - oder auch Kollektivgut - muss nicht unbedingt materiellen oder gar finanziellen Charakter haben. Es kann durchaus auch eine Handlung an sich, wie z. B. die Teilnahme an einer Demonstration sein, wobei der Akt des Demonstrierens von den Demonstranten als Kollektivgut verstanden wird. Auch die räumliche Verteilung eines Kollektivguts kann unterschiedliche Dimensionen annehmen. Sie kann regional begrenzt, aber auch global sein, wie dies beim Umweltschutz der Fall ist.
Hierbei wird deutlich, dass das Kollektivgut nur im Hinblick auf eine bestimmte Gruppe spezifiziert werden kann.
3. Die ,,klassische" bzw. ,,traditionelle" Gruppentheorie
3.1 Überblick
Der Begriff der ,,traditionellen Theorie" muss grundsätzlich mit Vorsicht behandelt werden, da es eigentlich keine einheitliche traditionelle Theorie der Gruppen gibt. Vielmehr existieren mehrere Ansätze des Gruppenverhaltens, die jedoch die gleichen Kernannahmen voraussetzen und somit unter dem (sicherlich ungenauen) Begriff ,,traditionelle Theorie(n)" subsumiert werden können.8
Dieser Denkansatz geht davon aus, dass es aufgrund der Existenz zahlreicher Organisationen und Gruppen eine Neigung geben müsse, die den Menschen dazu treibt, Verbände zu bilden und ihnen beizutreten. In Anlehnung an Aristoteles, der den Menschen als Herdenwesen beschreibt9, stellt die traditionelle Theorie den Menschen als ein vom Instinkt bzw. Trieb, Herden zu bilden und gegen andere Herden zu kämpfen, geleitetes Wesen dar.
Sie erklärt die heutige allgegenwärtige Verbände- und Gruppenbildung als Teil der Entwicklung von der primitiven zur modernen Gesellschaft. Während in primitiven Gesellschaften primäre Gruppen wie Familie und Sippe die meisten sozialen Funktionen übernehmen konnten, stellt sich das heutige gesellschaftliche Gefüge anders dar: Durch die Weiterentwicklung und Differenzierung der Gruppenfunktionen kam es dazu, dass die primäre Gruppe Familie nicht mehr fähig ist, alle Funktionen zu übernehmen, was dazu führt, dass neue Verbindungen entstehen, die so Funktionen der einstigen primären Gruppe übernehmen. ,,Mit der Verringerung der sozialen Funktionen, die in unserer Gesellschaft von der Institution Familie erfüllt werden, haben einige der sekundären Gruppen, wie etwa die Gewerkschaften, einen Interaktionsgrad erreicht, der dem bestimmter Primärgruppen gleichkommt oder ihn sogar übertrifft."10 Demnach besteht der hervorstechendste strukturelle Unterschied zwischen modernen und primitiven Gesellschaften in der großen Vielfalt von Zweckverbänden.
Die traditionelle Theorie nimmt an, dass die Teilnahme an freiwilligen Verbänden universell sei, und dass die Tendenz, Mitglieder anzuziehen in kleinen und großen Gruppen die gleiche ist. Desweiteren geht sie davon aus, dass in Fällen, in denen für eine bestimmte Funktion kleine Gruppen benötigt werden, sich auch kleine Gruppen bilden, ebenso vollzieht sich das Bilden großer Gruppen. Man stellte aber fest, dass die kleinen Gruppen effizienter sind als die großen11, und schloss daraus, dass eine große Gruppe einfach die Wesenszüge einer kleinen Gruppe übernehmen müsse, um ebenfalls effizienter zu sein, also die Ergebnisse von Untersuchungen kleiner Gruppen durch eine Multiplikation mit einem Proportionalitätsfaktor einfach auf große Gruppen übertragen könne.12
3.2 Olsons Kritik
Der Ansatzpunkt von Mancur Olsons Kritik an der traditionellen Theorie ist direkt die Grundannahme der entwicklungsbedingten Differenzierung. Wenn die traditionelle Theorie recht hat, dann muss der moderne große Verband das Äquivalent zur kleinen Gruppe der primitiven Gesellschaft sein. Demnach müsste für die Entstehung die gleiche Ursache gelten.13 Der bemühte Begriff der ,,Neigung" oder des ,,Instinktes", Gruppen zu bilden, ist nach Auffassung Olsons ungeeignet, Gruppenverhalten zu erklären, da dieser Begriff nur als Worthülse angeboten wird, ohne tatsächlich eine Erklärung zu liefern.
,,In ihrer zugespitzesten Form behauptet die traditionelle Theorie, dass die weitverbreitete Teilnahme an der heutigen freiwilligen Vereinigung auf die ,strukturelle Differenzierung` sich entwickelnder Gesellschaften zurückzuführen ist; d.h. darauf, dass mit dem Rückgang oder der zunehmenden Spezialisierung der kleinen Primärgruppen der primitiven Gesellschaft jene Aufgaben, die eine Vielzahl dieser kleinen Gruppen zu erfüllen pflegten, nun von großen, freiwilligen Vereinigungen übernommen werden. Wenn aber der nichtssagende Begriff eines universalen ,Beitrittsinstinkte` abgelehnt werden muss, wie kommt es dann zur Mitgliedschaft in diesen neuen, großen, freiwilligen Vereinigungen?"14
Die traditionelle Theorie besagt, dass sich kleine und große Gruppen dann bilden, wenn sie von ihrer Größe her benötigt werden, was bedeutet, dass in modernen Gesellschaften große Verbände deshalb vorherrschend sind, weil sie besser in der Lage sind, für eine große Anzahl von Menschen Funktionen zu erfüllen (Nachfragen sättigen, Interessen vertreten, Bedürfnisse stillen), die kleine Gruppen nicht so gut erfüllen würden. Olson kritisiert nun, dass die traditionelle Theorie Gruppen nur nach dem Umfang der Funktionen, die sie erfüllen, unterscheidet und nicht im Hinblick auf den Erfolg, den sie dabei haben, oder nach der Fähigkeit, Mitglieder zu gewinnen15, d.h. sie unterscheidet Gruppen lediglich nach dem Grade, aber nicht nach ihrem Wesen. Genau in diesem Punkt liegen für Olson die Defizite der Theorie, denn empirische Forschungen zeigen, dass der Mensch in Wirklichkeit nicht typischerweise großen Verbänden beitritt. Damit ist die Grundannahme der traditionellen Theorie hinfällig, denn wenn der Begriff des ,,Beitrittsinstinktes" abgelehnt wird, muss es andere Gründe geben, warum Verbände entstehen und vor allem, warum Verbände unterschiedlicher Größe entstehen.
4. Mancur Olsons Gruppentheorie
Wie zu Beginn schon erläutert wurde, haben Gruppen immer ein bestimmtes Ziel, das sie erreichen wollen. Dieses Ziel kann man auch als ein Gut bezeichnen, das allen Mitgliedern zugute kommt (z.B. die Durchsetzung von Lohnerhöhungen der Gewerkschaften), oder wie Olson formuliert, ein ,,Gut, das den anderen Mitgliedern einer Gruppe praktisch nicht vorenthalten werden kann."16 Olson zeigt mit seiner Theorie, worin die Probleme bestehen, wenn sich Personen zusammenschließen, um die Bereitstellung solcher Kollektivgüter zu ermöglichen und geht dabei besonders auf das Verhalten der Individuen in den Gruppen ein.
Als Verhaltensdeterminante bringt Olson in seiner Theorie den ,,homo oeconomicus", den wirtschaftlich und rational denkenden und handelnden Menschen mit seiner Verhaltensmaxime, Nutzen zu maximieren und Kosten (Kosten im weitesten Sinne: Anstrengung, finanzielle Kosten,...) zu minimieren, ins Spiel. Das ermöglicht Olson, das Verhalten von Gruppen aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Olson geht davon aus, dass sich das Individuum aufgrund dieser Maxime anders verhält als es die Gruppe von ihm erwartet, obwohl beide dieselben Interessen haben, denn grundsätzlich strebt das Individuum danach, seine Interessen mit möglichst geringen Kosten durchzusetzen. ,,Obwohl demnach alle Mitglieder der Gruppe ein gemeinsames Interesse haben, diesen kollektiven Vorteil zu erlangen, haben sie doch kein gemeinsames Interesse daran, die Kosten für die Beschaffung dieses Kollektivgutes zu tragen."17
Diese Erkenntnis ermöglicht es Olson, zwischen drei verschiedenen Gruppengrößen zu unterscheiden, da sich das Verhalten der Gruppenmitglieder bei unterschiedlicher Gruppengröße ändert. Olson unterscheidet zwischen kleiner (,,privilegierter") Gruppe, mittelgroßer Gruppe und großer (,,latenter") Gruppe. Auf die Unterschiede dieser Gruppen und ihre Implikationen auf das Verhalten ihrer Mitglieder soll im folgenden eingegangen werden.
4.1 Die Durchsetzung der Interessen in Abhängigkeit von der Gruppengröße
4.1.1 Die privilegierte Gruppe
18 Die privilegierte Gruppe ist eine kleine Gruppe, die aus wenigen Personen besteht. Sie ist gekennzeichnet durch starke wechselseitige Beziehungen und einen hohen Interaktionsgrad. Olson nennt diese Gruppe privilegiert, weil sie am ehesten von allen Gruppen in der Lage ist, Kollektivgüter in optimaler Menge zu produzieren und für ihre Mitglieder bereitzustellen.
Einerseits würde es durch den hohen Interaktionsgrad der Gruppe sofort bemerkt, wenn ein Mitglied seinen Beitrag zur Beschaffung des Gutes reduzieren würde, was Sanktionen zur Folge hätte.
Andererseits sind die Kosten für die Beschaffung der Kollektivgüter privilegierter Gruppen so gering, dass selbst wenn die Kosten für die Bereitstellung nur von wenigen übernommen werden, der Nutzen für diese immer noch höher wäre als der Verzicht. Somit ist die optimale Verteilung in privilegierten Gruppen immer gesichert.
4.1.2 Die mittelgroße Gruppe
19 Als mittelgroß bezeichnet Olson eine Gruppe mit einer durchschnittlich großen Personenzah Es gibt geringe wechselseitige Beziehungen innerhalb dieser Gruppe, die jedoch schon so groß ist, dass sich persönliche Abhängigkeiten kaum entwickeln. Demzufolge ist die Motivation des Einzelnen zur Beteiligung an der Beschaffung eines Gutes eher gering. Der Nutzen am möglicherweise bereitgestellten Kollektivgut wäre zwar höher als die Kosten, dennoch lässt sich über die Bereitstellung kollektiver Güter keine Aussage treffen, da sie nicht unbedingt gesichert ist. Wenn eine Beschaffung und Verteilung erfolgte, so wäre sie höchstens suboptimal.
4.1.3 Die latente Gruppe
Die latente Gruppe ist durch sehr geringe persönliche Abhängigkeit zwischen den Mitgliedern gekennzeichnet, da der Umfang der Gruppe kaum überschaubar ist. Das einzelne Mitglied hat aufgrund seiner ,,Kostensparmaxime" kein Interesse daran, seinen Beitrag zur Beschaffung des Gutes zu leisten und verhält sich als Trittbrettfahrer, d.h. es ist Konsument eines Gutes, von dessen Konsum es nicht ausgeschlossen werden kann, ohne einen angemessenen Beitrag für dessen Beschaffung zu leisten.
Das Mitglied hat keine Sanktionen zu befürchten, da sein Beitrag gemessen am Gesamtbetrag verschwindend gering ist, und sein Fehlen somit nicht auffällt.
Das Problem der latenten Gruppe ist nun, dass sich viele Mitglieder als Trittbrettfahrer verhalten und somit ein erheblicher Teil der Beschaffungskosten fehlt, was mindestens zu einer suboptimalen und in den meisten Fällen sogar zu keiner Beschaffung des Kollektivgutes führt. Olson nennt diese Gruppe ,,latente" Gruppe, ,,weil sie eine latente Macht oder Fähigkeit zum Handeln hat, aber diese mögliche Macht nur mit Hilfe von ,selektiven Anreizen` realisieren oder ,mobilisieren` [kann; M.L.]."20 Das bedeutet, ,,große [also latente; M.L.] Organisationen können ihre Ziele nicht optimal erreichen, so lange sie für ihre Mitglieder nur kollektive Güter bereitstellen."21
4.2 Selektive Anreize
Um den oben geschilderten Größeneffekt der Beschaffung kollektiver Güter, nämlich der Abnahme der Optimalität bezüglich der Verteilung des Gutes mit steigender Größe der Gruppe, entgegenzuwirken, müssen in latenten Gruppen Anzeize geschaffen werden, die die Mitglieder dazu bringen, ihren Beitrag zu leisten, sodass wieder eine optimale Beschaffung und Verteilung des Gutes/der Güter möglich ist.
Wie müssen diese Anreize aussehen? Diese Anreize müssen nicht zwangsläufig finanzieller Natur sein. Wie Olson richtig bemerkt sind wirtschaftliche Anreize nicht die einzigen Anreize, die man als Gruppe den einzelnen Mitgliedern bieten kann, denn der Mensch ist auch von dem Wunsch geleitet Prestige, Achtung, Freundschaft und ähnliches zu erlangen.22 Diese Anreize sind aber keine kollektiven Güter und damit gilt wieder das Ausschlussprinzip, so dass die Mitglieder etwas leisten müssen, um diese Güter zu bekommen, und genau hier liegt die Lösung des Problems:
In dem Moment, in dem eine Organisation/Gruppe ihren Mitgliedern selektive Anreize bietet (Selektivgüter), gelingt es ihr, die Mitglieder zu den notwendigen Leistungen zu motivieren, die notwendig sind, um das Kollektivgut zu beschaffen.23
Darüber hinaus dienen diese selektiven Anreize auch als Anreize für potentielle Mitglieder, d.h. als ,,Lockmittel" um neue Mitglieder zu gewinnen. So sichern die Organisationen die Beschaffung doppelt: Zum einen durch die Aktivierung eigener Mitglieder und zum anderen durch Neugewinnung von Mitgliedern.
Selektive Anreize müssen jedoch nicht zwangsläufig positiver Natur sein, es können auch negative ,,Anreize" wie Zwang oder Strafe eingesetzt werden, um Personen dazu zu bringen, ihren Beitrag zu leisten.24
4.3 Die Theorie vom ,,Nebenprodukt"
Ausgehend von der Beschaffung selektiver Anreize formuliert Olson die Theorie vom Nebenprodukt: Da diese Anreize wie in Anmerkung 24 erläutert, für viele Personen ausschlaggebend sind, um Organisationen beizutreten, kann man behaupten, dass für viele diese Anreize wichtiger sind, als das Kollektivgut, dessen Beschaffung und Bereitstellung das zentrale Ziel der Organisation ist. Wie muss man sich das vorstellen?
Ein Musterbeispiel für eine Organisation, die durch selektive Anreize Mitglieder wirbt, ist der ADAC, einst gegründet zur Förderung der Interessen des Kraftfahrwesens und des Motorsports, heute eine Massenorganisation, die Autoversicherungen, Pannenhilfe, vergünstigte Reisen u.v.m. anbietet. Selbstverständlich nur für ihre Mitglieder. Warum treten also so viele Menschen dem ADAC bei?
Wohl kaum, um ihre Interessen als Autofahrer vertreten zu wissen, denn das werden sie, auch wenn sie nicht Mitglied des ADAC sind (=> Trittbrettfahrer), sondern um diese Leistungen in Anspruch nehmen zu können, die nur für Mitglieder bereitgestellt werden. Da diese Selektivgüter nun in den Vordergrund rücken, verschiebt sich die Wahrnehmung:
Die zu Anfang als Selektivgüter bereitgestellten Leistungen werden mit der Zeit zum ,,Hauptprodukt" und das Kollektivgut, dessen Beschaffung das eigentliche Ziel war, rückt in den Hintergrund. Olson erkennt, dass das Kollektivgut nur noch das ,,Nebenprodukt" der Organisation/Gruppe ist.25
Die Beschaffung von Selektivgütern ,,führt vielfach dazu, dass die eigentlichen Organisationsziele in den Hintergrund treten und, wie Olson sagt, zu einem Nebenprodukt der Erzeugung von privaten [selektiven; M.L.] Gütern werden."26
5. Schlussbemerkungen
Mancur Olson wollte mit seiner Theorie des kollektiven Handelns zeigen, dass der Ansatz bzw. der Glaube der traditionellen Theorie, man könne das Verhalten von kleinen Gruppen auf große übertragen, zu kurz greift. Er zeigt in seinen Ausführungen anschaulich, dass sich mit der Änderung der Größe auch das Wesen einer Gruppe verändert und das eben diese Induktion der traditionellen Theorie nicht möglich bzw. falsch ist. Grundlegend für seine Theorie ist die Annahme, dass sich der Mensch als Kostenminimierer und Nutzenmaximierer verhält.
Aufgrund dieser Prämisse kann Olson veranschaulichen, dass mit steigender Größe einer Gruppe der Durchsetzungsgrad von Interessen sinkt und daraus eine suboptimale Verteilung resultiert. Zusammengefasst lautet Olsons These, je größer eine Gruppe ist desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ihre Interessen vertreten kann. Durch das kostenminimierende Verhalten der Mitglieder können in großen (latenten) Gruppen Kollektivgüter nur dann beschafft werden, wenn die Mitglieder durch selektive Anreize dazu gebracht werden, ihren Beitrag zur Beschaffung des Gutes zu leisten. Durch die hohe Bedeutung des Selektivgutes sinkt die des Kollektivgutes und es gerät in den Hintergrund.
Die Nebenprodukttheorie Olsons zeigt, dass Mitglieder nur durch attraktive Anreize gewonnen werden können und dass das Kollektivgut nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, es wird zum Nebenprodukt. Olsons Ausführungen zeigen anschaulich, dass die traditionelle Theorie zu kurz greift und gleichsam geben sie dem Sozialwissenschaftler eine attraktive Theorie mit auf den Weg, die erklärt, wie und warum kollektives Handeln funktioniert.
Sie erklärt aber auch, und das ist der Fortschritt, in welchen Fällen es nicht funktioniert. Die Spannungen im Verhältnis Einzelinteresse - Gruppeninteresse erklären das Trittbrettfahrerverhalten auf transparente Weise und können - ganz im Gegensatz zu den Prämissen der traditionellen Theorie - empirisch nachgewiesen werden.
Damit wurde von Olson eine Theorie entwickelt, die Sozialwissenschaftler in die Lage versetzt, Gruppenverhalten zu analysieren, zu verstehen und zu erklären.
6. Literarurverzeichnis
Druwe, Ulrich, Politische Theorie, Reihe ,,Politikwissenschaft aktuell", Band 2, Ars Una Verlag, Neuried 1993.
Hillmann, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie, 4. Auflage, Kröner-Verlag, Stuttgart 1994.
Lehner, Franz: Einführung in die neue politische Ökonomie, Athenäum-Verlag, Königstein/Ts. 1981.
Meyers großes Taschenlexikon, Band 9+10, 4. Auflage, B.I.-Taschenbuchverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1992.
Olson, Mancur: Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die Theorie der
Gruppen, in der Reihe ,,Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften. Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften", Band 10, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen 1968.
[...]
1 Vgl: Druwe, Ulrich, Politische Theorie, in der Reihe ,,Politikwissenschaft aktuell", Band 2, Ars Una Verlag, Neuried1993, S. 305.
2 Dabei soll die Theorie der ,,Sonderinteressen" nicht behandelt werden, da sie für das direkte Verständnis der Theorie Olsons nicht notwendig ist und ihre Darstellung den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen würde.
3 Vgl. Meyers großes Taschenlexikon, Band 9, 4. Auflage, B.I.-Taschenbuchverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1992, S. 48.
4 Meyers großes Taschenlexikon, Band 10, 4. Auflage, B.I.-Taschenbuchverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1992, S 215.
5 Vgl. Meyers großes Taschenlexikon, Band 10, 4. Auflage, B.I.-Taschenbuchverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1992, S. 215.
6 Vgl. Hillmann, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie, 4. Auflage, Kröner-Verlag, Stuttgart 1994, S.623.
7 Olson, Mancur: Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die Theorie der Gruppen, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen 1968, S. 13.
8,,Wie die meisten anderen ist auch diese Theorie der Gruppen von zahlreichen Autoren mit verschiedenen Ansichten entwickelt worden; deshalb ist es unvermeidbar, dass kein Versuch, diese verschiedenen Meinungen gemeinsam zu behandeln, ihnen völlig gerecht wird. Dennoch haben die Vertreter der Traditionellen Lehre von den Gruppen in einer Beziehung etwas mit dem in dieser Studie entwickelten Ansatz gemeinsam. Deshalb ist es passend, hier etwas ungenau von einer einzigen traditionellen Theorie zu sprechen [...]"Olson M. (Anm. 7), S. 16.
9 Olson M. (Anm. 7), S. 16.
10 Olson M. (Anm. 7), S. 17.
11 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S. 55: Homans Theorie über den Zerfall großer Kulturen, während auf der Stufe des Stammes die Gesellschaft immer in der Lage war, sich zu erhalten.
12 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S. 56.
13 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S. 18.
14 Olson M. (Anm. 7), S. 57.
15 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S. 19.
16 Olson M. (Anm. 7), S. 13.
17 Olson M. (Anm. 7), S. 20.
18 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S.32ff, S. 48f.
19 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S. 49.
20 Olson M. (Anm. 7), S. 50.
21 Lehner, Franz: Einführung in die neue politische Ökonomie, Athenäum-Verlag, Königstein/Ts. 1981, S. 80.
22 Vgl. Olson M. (Anm. 7), S. 59.
23 Vgl. Lehner, F. (Anm. 21), S. 80.
24 Ein Beispiel für positive Anreize wäre zum Beispiel des Streikgeld und der Arbeitnehmerrechtschutz der Gewerkschaften: als Kollektivgut stellen sie die Tarifverträge zur Verfügung, von denen auch Nicht- Gewerkschaftsmitglieder profitieren. Diese verhalten sich somit als Trittbrettfahrer: Sie konsumieren das kollektive Gut, ohne für dessen Beschaffung einen Beitrag zu leisten. Um diese Trittbrettfahrer nun zu aktivieren, werden selektive Anreize in Form von Streikgeldern angeboten, was dazu führt, dass Personen den Gewerkschaften beitreten, um an diesen Selektivgütern teilzuhaben. Ein Beispiel für negative selektive Anreize ist das deutsche Kammerwesen (z.B. die kassenärztliche Vereinigung), bei dem Personen aufgrund ihres erlernten Berufes Mitglied sein müssen, wenn sie ihn ausüben wollen.
25 Vgl. Olson, M. (Anm. 7), S. 130ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Mancur Olsons Gruppentheorie?
Die Hauptthese Olsons besagt, dass je größer eine (Interessen-)Gruppe ist, desto geringer ist der Durchsetzungsgrad ihrer Interessen. Dies widerspricht der klassischen Gruppentheorie, die annimmt, dass größere Gruppen ihre Interessen besser formulieren und durchsetzen können.
Was sind die zentralen Definitionen und Begriffe, die in der Analyse der Gruppentheorie verwendet werden?
Die zentralen Begriffe sind: Gruppe (definiert als eine Menge von Personen mit sozialen Beziehungen und gemeinsamen Zielen), Interessenverbände (Zusammenschlüsse zur Vertretung und Durchsetzung gemeinsamer Interessen) und öffentliche/kollektive Güter (Güter, die nicht-ausschließbar sind und allen Mitgliedern zugute kommen).
Was ist die "klassische" oder "traditionelle" Gruppentheorie?
Die traditionelle Gruppentheorie geht davon aus, dass es eine angeborene Neigung zur Gruppenbildung gibt und dass moderne Verbände eine Weiterentwicklung primitiver Gruppen darstellen. Sie nimmt an, dass die Teilnahme an freiwilligen Verbänden universell ist und dass kleine und große Gruppen gleichermaßen effizient sein können.
Was ist Olsons Kritik an der traditionellen Gruppentheorie?
Olson kritisiert, dass die traditionelle Theorie die Ursachen für die Entstehung von Gruppen nicht ausreichend erklärt und dass sie Gruppen lediglich nach dem Umfang ihrer Funktionen unterscheidet, nicht aber nach ihrem Erfolg oder der Fähigkeit, Mitglieder zu gewinnen. Er argumentiert, dass empirische Forschungen zeigen, dass Menschen nicht typischerweise großen Verbänden beitreten, was die Grundannahme der traditionellen Theorie in Frage stellt.
Welche drei Gruppengrößen unterscheidet Olson in seiner Gruppentheorie?
Olson unterscheidet zwischen der "privilegierten" Gruppe (kleine Gruppe mit starkem Zusammenhalt), der mittelgroßen Gruppe (durchschnittliche Gruppengröße mit geringen wechselseitigen Beziehungen) und der "latenten" Gruppe (große Gruppe mit geringer persönlicher Abhängigkeit zwischen den Mitgliedern).
Was sind selektive Anreize in Olsons Theorie?
Selektive Anreize sind Anreize (materieller oder immaterieller Natur), die Mitglieder einer Gruppe motivieren sollen, ihren Beitrag zur Beschaffung kollektiver Güter zu leisten. Diese Anreize sind nicht-kollektiv und können nur von Mitgliedern in Anspruch genommen werden, die ihren Beitrag leisten.
Was ist die "Theorie vom Nebenprodukt" in Olsons Gruppentheorie?
Die Theorie vom Nebenprodukt besagt, dass die selektiven Anreize, die Organisationen bieten, um Mitglieder zu gewinnen, im Laufe der Zeit wichtiger werden können als das eigentliche Kollektivgut, dessen Beschaffung das ursprüngliche Ziel der Organisation war. Das Kollektivgut wird somit zum "Nebenprodukt" der Organisation.
Was ist die Rolle des "Homo Oeconomicus" in Olsons Theorie?
Olson verwendet das Konzept des "Homo Oeconomicus" (des rational handelnden Menschen), um zu erklären, warum Individuen in Gruppen möglicherweise nicht immer im besten Interesse der Gruppe handeln. Da der "Homo Oeconomicus" seinen Nutzen maximieren und seine Kosten minimieren möchte, kann er sich als Trittbrettfahrer verhalten und von den Vorteilen eines Kollektivgutes profitieren, ohne einen Beitrag zu dessen Beschaffung zu leisten.
Was ist das Problem der "Trittbrettfahrer" (free riders) in Bezug auf kollektives Handeln?
Das Problem der Trittbrettfahrer besteht darin, dass Individuen, die sich nicht an der Bereitstellung eines Kollektivgutes beteiligen, dennoch von diesem profitieren können, ohne einen Beitrag zu dessen Kosten zu leisten. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass das Kollektivgut nicht in optimaler Menge bereitgestellt wird oder gar nicht zustande kommt.
Was sind Beispiele für Organisationen, die Olsons Theorie verdeutlichen?
Der ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) wird als Beispiel für eine Organisation genannt, die durch selektive Anreize (Pannenhilfe, Versicherungen, etc.) Mitglieder wirbt, wobei das eigentliche Ziel der Interessenvertretung der Autofahrer in den Hintergrund rückt.
- Quote paper
- Mirco Lattwein (Author), 2001, Kollektive Güter & Trittbrettfahrer - Die Gruppentheorie von M. Olson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106101