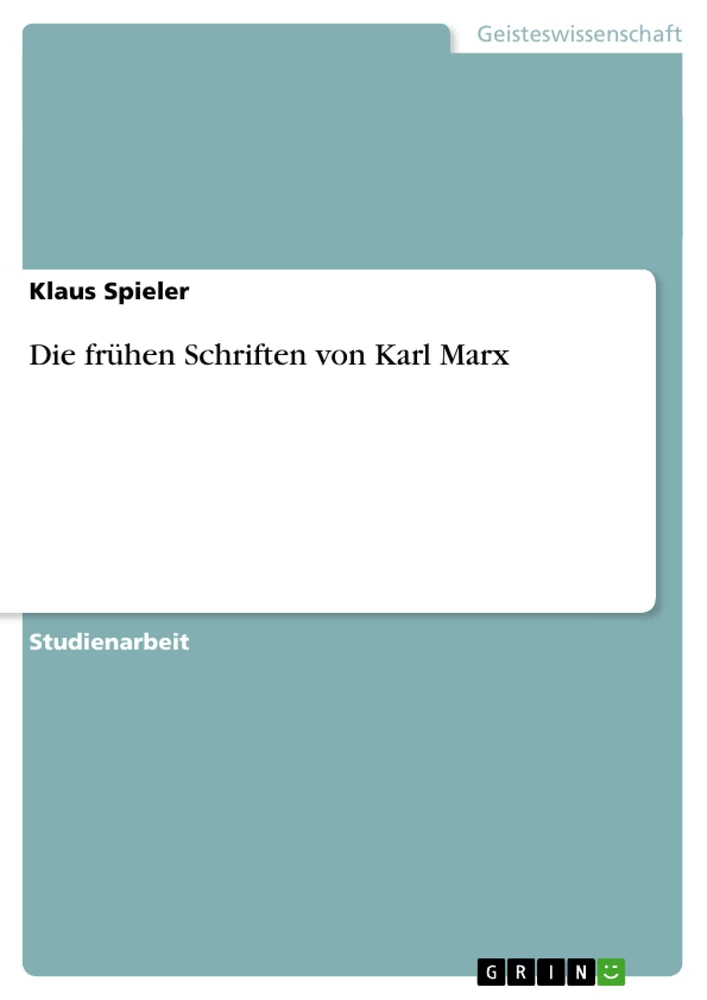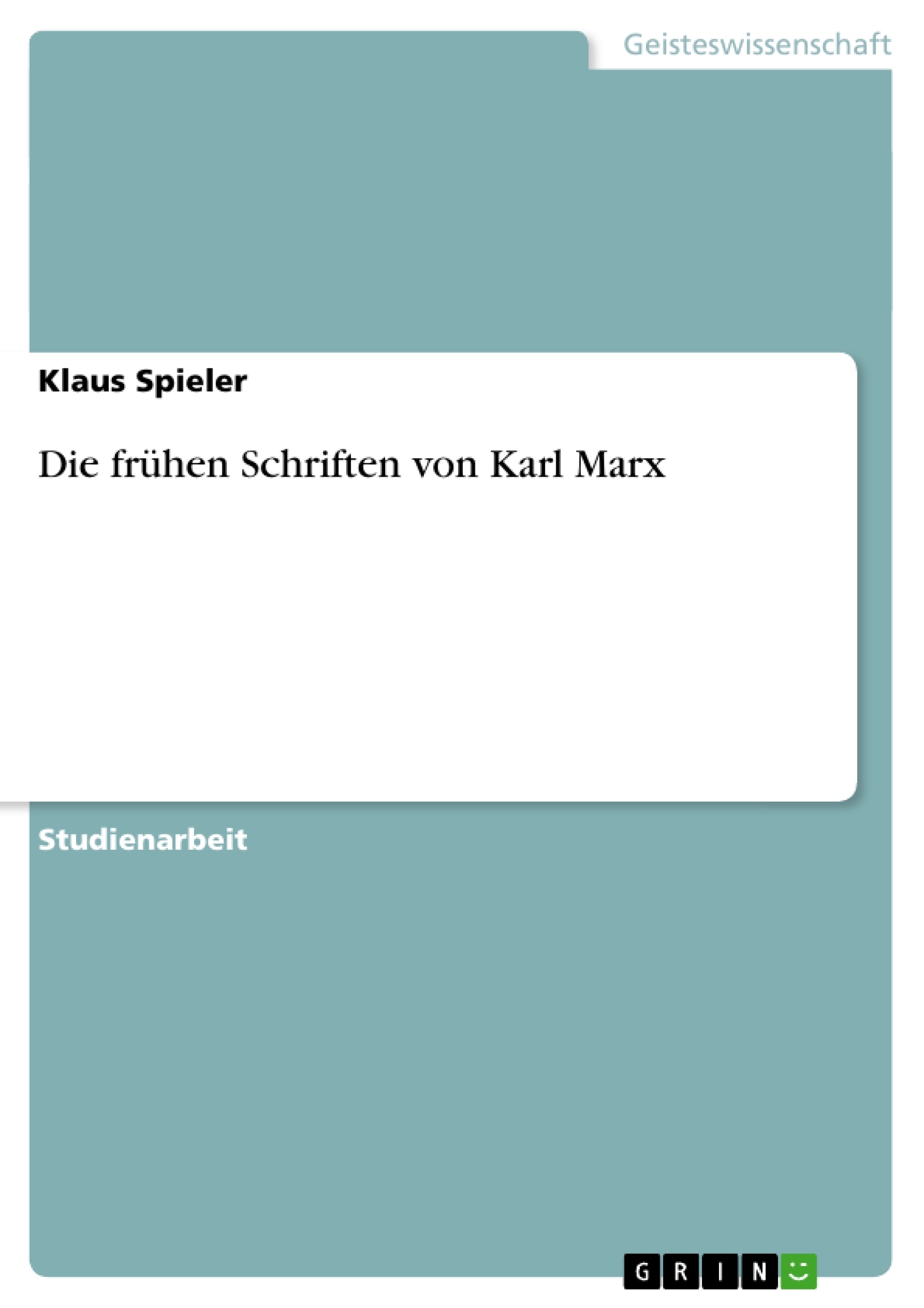Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Die Dialektik
- II. Der Mensch
- III. Der Staat
- IV. Die Gesellschaft
- V. Das Zusammenspiel
- VI. Fazit
- Nachwort
- Literatur
DIE
FR Ü HEN
SCHRIFTEN
Im Marxschen Frühwerk formulierte Grundlagen der materialistischen Geschichtsschreibung, unter besonderer Berücksichtigung der Staatstheorie
„ The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point is to change it. “
Marx
„Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.“
Goethe
„Selbst der verbrecherische Gedanke eines Bösewichts ist großartiger und erhabener als die Wunder des Himmels.“
Hegel
„Keinen verderben lassen, auch nicht sich selber Jeden mit Glück zu erfüllen, auch sich Das ist gut
Brecht
Nur Liebe und sonst gar nichts
Songtitel
Vorwort
Der Staat war ein zentrales Thema des „jungen Marx“. Sein frühes Werk von Ende der 30er Jahre bis 1844 befaßt sich zum großen Teil mit dem Wesen des Staates und seiner Beziehung zur Gesellschaft, in welcher den Menschen, ihrer wahren Natur zuwiderlaufende, Rollen - Charaktermasken zugewiesen werden.
Seine wichtigste Arbeit vor den „Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten“ von 1844, die den Marxschen Übergang zum konsequenten Materialisten und somit den Abschluß seines Frühwerks markieren, war meines Erachtens, abgesehen von seiner Dissertation, die „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ seine Einleitung „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. Aber auch andere veröffentlichte Arbeiten seines Frühwerks, insbesondere Briefe und Beiträge zur „Rheinischen Zeitung“, sollen hier Beachtung finden.
Marx theoretische Bemerkungen bilden ein äußerst komplexes und keineswegs eindeutiges Gedankengebäude.1 Eine umfassende und systematische Staatstheorie fehlt. Marx schrieb 1858, er beabsichtige, in einem Teil des geplanten Werks, von dem „Das Kapital“ nur der erste Teil sein sollte, den Staat einer systematischen Analyse zu unterziehen.2 Aber von diesem Programm wurde nur ein Teil - das „Kapital“ tatsächlich fertiggestellt. Marx Auffassung vom Staat muß daher entwickelt werden aus verschiedenen historischen Gelegenheitsschriften und aus gelegentlichen Bemerkungen in anderen Werken.3 Andererseits kommt der Staatstheorie zentrale Bedeutung im Gesamtzusammenhang zu, was dadurch deutlich wird, daß Marx sich in fast allen Schriften auf sie bezieht.4
Gerade dieser Sachverhalt läßt die frühe Marxsche Arbeit über den Staat und die Gesellschaft besonders interessant erscheinen, denn, obwohl er bald die Anschauungen und Positionen, die er dort vertreten hatte, änderte, kehren einige Fragen, die besonders in der Auseinandersetzung mit Hegels Philosophie angeschnitten wurden, in den späteren Schriften wieder. Die grundlegenden anthropologischen Vorstellungen von Marx, wie er sie im Frühwerk ausdrückte, unterlagen darüber hinaus keinem grundsätzlichen Wandel in späteren Publikationen.5
Jener Teil seines Werkes, der Thema dieser Arbeit sein soll, ist meines Erachtens, wenn nicht gar ein unerläßlicher, so doch zumindest ein sehr wichtiger Baustein zum Verständnis der Marxschen Megatheorie.
I. Die Dialektik
Um die Entwicklung im Marxschen Frühwerk, die Auseinandersetzung mit den Denkfiguren Hegels, nachvollziehen zu können, erscheint es mir unerläßlich, zunächst auf die von Hegel entwickelte Methode, der sich Marx anschloß, zu verweisen. Diese Methode trägt den Namen „Dialektik“ und ist im wesentlichen gekennzeichnet durch das Gesetz der Negation der Negation, demzufolge die Entwicklung als ständige Negation bestehender Qualitäten vor sich geht, und zwar so, daß die Negierung einer Qualität eine erneute Negation erfährt und dadurch in der Entwicklung wesentliche Seiten der ursprünglichen Qualität auf höherer Ebene wiederholt werden.6 Jede Entwicklung vollzieht sich als Negation bestehender Qualitäten, wobei die neue Qualität alles Positive der Alten in sich aufbewahrt; da die Entwicklung auf dieser Stufe aber nicht stehenbleibt, muß auch die neue Qualität ihrerseits eine Negation erfahren. Als Resultat dieser zweiten Negation, also der Negation der Negation, entsteht eine neue Qualität, die, da sie um die positiven Seiten der ersten beiden Entwicklungsphasen bereichert ist, nur eine formale Ähnlichkeit mit dem Ausgangsstadion aufweist.7 „Die Entwicklung wiederholt im Stadium der Negation der Negation bestimmte Züge und Merkmale vorangegangener Stadien auf höherer Ebene und kann daher bildlich durch die Form einer Spirale veranschaulicht werden.“8
Engels ergänzte: „Negieren in der Dialektik heißt nicht einfach nein sagen, oder ein Ding für nicht bestehend erklären oder es in beliebiger Weise zerstören...Ich soll nicht nur negieren, sondern auch die Negation wieder aufheben. Ich muß also die erste Negation so einrichten, daß die zweite möglich bleibt oder wird. Wie? Je nach der besondern Natur jedes einzelnen Falls. Vermahle ich ein Gerstenkorn, zertrete ich ein Insekt, so habe ich zwar den ersten Akt vollzogen, aber den zweiten unmöglich gemacht. Jede Art von Dingen hat also ihre eigentümliche Art, so negiert zu werden, daß eine Entwicklung dabei herauskommt, und ebenso jede Art von Vorstellungen und Begriffen.“9
Darüber hinaus muß die den Dingen innewohnende Bewegung als Selbstbewegung gesehen werden, in der quantitative und qualitative Veränderungen verschmelzen.10 Um mit dieser Methode Ergebnisse zu erzielen, bedarf es a priori einer exakten Begriffsbildung.
Wesentlich, für das Marxsche Gesammtwerk ist der, von Adam Smith übernommene, Begriff der „Klasse“. Klassen stellen große Menschengruppen dar, in denen sich die einzelnen Mitglieder gleichen, und sich von den anderen Klassen unterscheiden, hinsichtlich ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisation.11 In der „Deutschen Ideologie“ schreibt er: „So wenig es von ihrem idealistischen Willen und Willkür abhängt, ob ihre Körper schwer sind, so wenig hängt es von ihm ab, ob sie ihren eigenen Willen...durchsetzen...Ihre persönliche Macht beruht auf Lebensbedingungen, die sich als Vielen gemeinschaftlich entwickeln,...“12
Der ebenfalls wichtige Begriff „Antagonismus“ bezeichnet einen unüberbrückbaren Gegensatz. Solch einen Antagonismus, postulierte Marx, schon im fortgeschrittenen Frühwerk, für das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, der ausgebeuteten und der ausbeutenden Klasse.
In den Wortd die einen, nur auf Kosten der anderen, ein Gewinn „herausspringen“ kann. Auf andere Bausteine der Theorie, andere Begriffe - deren Ursprung und die Definition bei Marx, wie „Entfremdung“, „Arbeit“, „Gattungswesen“ oder „Demokratie“ will ich in den folgenden Kapiteln verweisen. Bei beiläufigen Verweisen muß es leider bleiben, weil eine exakte Bestimmung der Termini den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen würde.
II. Der Staat
Die meisten Hinweise zur Staatstheorie finden sich in den frühen Schriften.
Die Vorstellung vom Staat des jungen Marx war deutlich von Hegel bestimmt. „Der Staat als großer Organismus, in welchem die rechtliche, sittliche und politische Freiheit ihre Verwirklichung zu erhalten hat und der einzelne Staatsbürger in den Staatsgesetzen nur den Naturgesetzen seiner eigenen Vernunft, der menschlichen Vernunft gehorcht.“13 Das sagt schon Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, im § 257.14 Allerdings steht diese Auffassung vom Staat, für Marx, im Widerspruch zur tatsächlichen Realität des gegenwärtigen Staates. „Ein Staat, der nicht die Verwirklichung der vernünftigen Freiheit ist, ist ein schlechter Staat.“15 In seinem Artikel, über die Gesetzgebung des Rheinischen Landtags gegen den Holzdiebstahl, in der „Rheinischen Zeitung“ verurteilt er entschieden, daß der Landtag das Gewohnheitsrecht der Armen nicht gelten läßt und der Staat die Interessen der Reichen gegen die Armen vertritt.16 Dies, so Marx, sei eine Verkehrung der wirklichen Ziele und Aufgaben des Staates; das Privateigentum möge versuchen, den Staat für sich in Anspruch zu nehmen, aber jeder moderne Staat, sofern er sich selbst treu bleibt, müsse mit solchen Forderungen konfrontiert, ausrufen: „Deine Wege sind nicht meine Wege, und deine Gedanken sind nicht meine Gedanken!“17
In der „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ von 1843 löst er sich von Hegels Vorstellung des gerechten Staates, in dem die wahre Bedeutung und Wirklichkeit der Gesellschaft liegt. Im Mittelpunkt der Kritik an Hegel steht der Gedanke, der von der Äußerlichkeit der Form gegenüber dem Inhalt, auf den Inhalt zurückschließt. „Hegel ist nicht zu tadeln, weil er das Wesen des modernen Staates schildert, wie es ist, sondern weil er das, was ist, für das Wesen des Staates ausgibt.“18
Zentral in Marx´ Kritik am Hegelschen Staatsbegriff ist, daß Hegel, während er richtig die Trennung der zivilen Sozietät vom Staat feststellt, ihre Versöhnung im Staat selbst behauptet. In Hegels System wird der Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft durch die Annahme gelöst, im Staat liege die wahre Bedeutung und Wirklichkeit der Gesellschaft. Die Entfremdung des Einzelnen vom Staat, der Widerspruch zwischen dem Menschen als einem privaten Mitglied der Gesellschaft, das seine Privatinteressen verfolgt, einerseits, und dem Staatsbürger andererseits, wird gelöst im Staat als dem Ausdruck der höchsten Wirklichkeit der Gesellschaft.19
Das aber, sagt Marx, ist keine Lösung, sondern eine Mystifikation - der Widerspruch zwischen Staat, Gesellschaft und den wirklichen Menschen ist manifest.20
Dort löst er die politische Entfremdung und den Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft hauptsächlich in politischen Begriffen - im Rahmen eines Konzepts von „wahrer Demokratie“. „In der Demokratie ist das formelle Prinzip zugleich das materielle Prinzip. Sie schafft deshalb die tatsächliche Einheit des Allgemeinen und Besonderen.“21
„In allen von der Demokratie unterschiedenen Staaten ist der Staat, das Gesetz, die Verfassung das Herschende, ohne daß er wirklich herrschte, das heißt den Inhalt der Übrigen nicht politischen Sphären materiell durchdringe. In der Demokratie ist die Verfassung, das Gesetz, der Staat selbst nur eine Selbstbestimmung des Volkes, ein bestimmter Inhalt desselben, soweit er politische Verfassung ist.22
Demokratie soll hier mehr bedeuten als eine spezifische politische Form - der Kampf zwischen Monarchie und Republik, bemerkt er, ist noch ein Kampf im Rahmen dessen, was er „abstrakten Staat“ nennt, also des von der Gesellschaft entfremdeten Staates.23 „Das Eigentum etc., kurz der ganze Inhalt des Rechts und des Staats, ist mit wenigen Modifikationen in Nordamerika dasselbe wie in Preußen. Dort ist also die Republik eine bloße Staatsform wie hier die Monarchie.“24
Aber der konkrete Inhalt von „wahrer Demokratie“ bleibt hier unbestimmt. In diesem Zusammenhang verwies Marx insbesondere auf die „neueren Franzosen“, die der Ansicht waren, daß in der „wahren Demokratie“ der politische Staat untergehe. Mit größter Wahrscheinlichkeit dachte er an Saint-Simon, mit seiner Idee von der Gesellschaft der Zukunft, in welcher die Leitung der Menschen an die Stelle der Verwaltung von Dingen tritt.25
Das Auseinandertreten von Staat und Gesellschaft spaltet darüber hinaus auch das Individuum in Staats - und Wirtschaftsbürger. „Am Einzelnen erscheint hier, was das allgemeine Gesetz ist. Bürgerliche Gesellschaft und Staat sind getrennt. Also ist auch der Staatsbürger und der Bürger, als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, getrennt. Er muß also eine wesentliche Diremption mit sich selbst vornehmen.“26
Der allgemeinen Einschätzung zufolge, markieren erst die Schriften „Zur Judenfrage“ und die „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie/Einleitung“ den Marxschen Übergang zum konsequenten Materialisten.27
III. Die Gesellschaft
Marx bewertete die Arbeit als Grundtatsache der Geschichte und des Menschen. Der spätere Marx rückt den Arbeitsprozeß für die Selbstkonstitution der Menschheit immer mehr in den Vordergrund.
Der Arbeitsprozeß bildet die wirkliche Basis der Geschichte, schreibt er schon in der „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“.28 Und in der, zusammen mit Engels verfaßten, Schrift „Die heilige Familie“ heißt es:“...die ganze sogenannte Weltgeschichte ist nichts anderes als die Erzeugung des Menschen durch menschliche Arbeit, als das Werden der Natur für den Menschen, so hat er also den anschaulichen, unwiderstehlichen Beweis von seiner Geburt durch sich selbst, von seinem Entstehungsprozeß.“29
Für Marx konstituiert sich der Mensch also insoweit, als er produktiv ist, als er die Welt außerhalb seiner selbst ergreift, und indem er seine eigenen, besonderen Anlagen ausdrückt mit deren Hilfe er sich seine Umwelt aneignen kann.30 „Productive activity is at the same time both a material interchange (the combination and transformation of raw materials into goods for human consumption) and a human social process - whereby the cunning of human practice realizes ist aims within the context of definite, historically determined and transformed, socio-economic relationships.“31
Dem frühen Marx geht es um die theoretische Nachzeichnung der Logik des geschichtlichen Emanzipationsprozesses der Menschheit, der Entwicklung hin zur Demokratie. Mit der Einsicht in die Bedeutung des Arbeitsprozesses für den Geschichtsverlauf bricht diese idealistische Position auf und weicht der materialistischen Position. Der Begriff bürgerlicher Gesellschaft bezeichnet nun den jeweiligen institutionellen Rahmen, der durch den Entwicklungsstand der Produktivkräfte bestimmt ist.32
Die ablaufende Geschichte wird nun als Geschichte der sich entwickelnden Produktivkräfte interpretiert, die, mit zunehmender Gesellschaftlichkeit, mit einer ihnen entsprechenden Form des staatlichen Überbaus einhergeht. Daraus entwickelt Marx eine universelle Geschichtstheorie, in welcher dem Entwicklungsstand des Arbeitsprozesses die ausschlaggebende vorwärtstreibende Kraft, die Rolle des wirklichen Motors der Geschichte zugesprochen wird. Marx möchte mit seiner materialistischen Geschichtsschreibung also eine Einheit von Logik und Geschichte herausstellen, welche die Geschichte als Prozeß menschlicher Emanzipation, bis hin zur Möglichkeit einer nicht mehr ausgebeuteten Gesellschaft assoziierter Individuen, als Abschluß der menschlichen Vorgeschichte sieht.33
Marx´ Kritik am Kapitalismus zielt hauptsächlich darauf ab, daß dieser das Interesse an Geld und an materiellen Gewinn zum Hauptmotiv des Menschen gemacht hat, sowie die menschliche „Lebenstätigkeit“ in erzwungene, entfremdete, letztlich sinnlose Arbeit verkehrt hat.
Seine Konzeption des Sozialismus, ist diejenige einer Gesellschaft, in welcher dieses materielle Interesse aufhören würde, das Beherrschende zu sein.34.
„In seinen ökonomischen Betrachtungen zieht Marx an Hand der Tatsachen des wirklichen Lebens scharf die Grenze zwischen Vergegenständlichung in der Arbeit an sich und Entfremdung von Subjekt und Objekt in der kapitalistischen Form der Arbeit.“35
IV. Der Mensch
Marx Menschenbild wurzelt in der humanistischen philosophischen Tradition des Westens, die von Spinoza über die französische und deutsche Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts bis zu Hegel reicht, in deren Zentrum die „Sorge“ um den Menschen und um die Verwirklichung seiner Möglichkeiten steht.
„Marx´ Philosophie ist eine Protestphilosophie; ein Protest, der getragen ist vom Glauben an den Menschen, an seine Fähigkeit, sich selbst zu befreien und seine ihm innewohnenden Fähigkeiten zu verwirklichen.“36 Hiervon ausgehend betrachtete Marx den Menschen als Mitglied der Gesellschaft, als ein Wesen, das in seiner Entwicklung von der Gesellschaft gestützt und zugleich gehemmt wird.
„Der wirkliche Mensch ist der Privatmensch der jetzigen Staatsverfassung“ .Menschliche Emanzipation, welche sich von politischer Emanzipation unterscheidet, kann in der bürgerlichen Gesellschaft nicht realisiert werden, da diese „alle Gattungsbande des Menschen (zerreißt), den Egoismus, das eigennützige Bedürfnis an die Stelle dieser Gattungsbande (setzt), die Menschenwelt in eine Welt atomistischer, feindlich sich gegenüberstehender Individuen (auflöst).“37
In seinem Aufsatz, für die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“, „Zur Judenfrage“ kritisiert Marx Bruno Bauer, weil dieser politische und menschliche Emanzipation verwechselt, und bemerkt: „Die Grenze der politischen Emanzipation erscheint sogleich darin, daß der Staat sich von einer Schranke befreien kann, ohne daß der Mensch wirklich von ihr frei wäre, daß der Staat ein Freistaat sein kann, ohne daß der Mensch ein freier Mensch wäre.“38 Politische Emanzipation sei zwar ein großer Fortschritt, aber nicht die letzte Form der menschlichen Emanzipation überhaupt, sondern nur die letzte Form der menschlichen Emanzipation im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung.39
In der „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, schreibt Marx von „der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei“ und von „dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“40
In der Weiterentwicklung dieses Gedankens kommt das Proletariat als „Agent der Auflösung der bestehenden Gesellschaftsordnung“ ins Spiel. „It is this date, that is early in 1884, that Marx for the first time nominates the proletariat as the revolutionary force in Germany, in a remarkable essay which exhibits the connection of theory and practice in the highest degree of tension.“41
Das Proletariat deswegen, weil die Proletarier für ihn praktisch die Inkarnation der Entfremdung darstellen. Der von Hegel geprägte Begriff der Entfremdung bedeutet für Marx, daß sich der Mensch in seiner Aneignung der Welt nicht als Handelnder erfährt, sondern das ihm diese fremd bleibt; der Mensch hört auf, daß zu sein, was er sein sollte.42
Die Proletarier verloren das von ihnen hergestellte Produkt, die freie Tätigkeit, das eigene Ich, weil sie sich als Ware verkaufen müssen, sie verloren den sozialen Bezug als Gattungswesen und schließlich den Bezug zur Natur.43
„Eine Klasse mit radikalen Ketten, eine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, ein Stand, welcher die Auflösung aller Stände ist, eine Sphäre, welche einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und kein besonderes Recht in Anspruch nimmt, weil kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihnen verübt wird, welche nicht mehr auf einen besonderen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen Titel provozieren kann...“44 Der für die marxistische Theorie bedeutsame Terminus „Gattungswesen“, welcher einen nicht von sich selbst entfremdeten - den wirklichen Menschen bezeichnet, stammt ursprünglich von Feuerbach.45
Das von Marx angestrebte Ziel ist die Emanzipation des Menschen, eines Menschen, der sich als ein solches Gattungswesen versteht und nicht als egoistisches Einzelwesen, also der Einheit von Individuum und Allgemeinheit, der Weg dorthin führt über die vom Proletariat durchgeführte soziale Revolution. Das Schiff voll Narren, schrieb er in einem Brief an Arnold Ruge, treibt seinem Schicksal entgegen, und dieses Schicksal ist die bevorstehende Revolution.46
Das eigentliche Wesen des Menschen hat sich bislang nicht realisiert, weil die Menschen bisher in Verhältnissen gelebt haben, die ihrer eigentlichen Bestimmung, ihrer sozialen Natur zuwiderliefen. Erst wenn der wirkliche Mensch Gattungswesen geworden ist, ist die menschliche Emanzipation vollbracht. „Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als Menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen.“47
Nach Marx ist das natürlichste Verhältnis des Menschen zum Menschen, die unmittelbarste Beziehung zwischen zwei Individuen in der Liebe zwischen Mann und Frau gegeben.48
V. Das Zusammenspiel
Zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft im Kapitalismus schreibt Marx: „Die Bourgeoisie, als herschende Klasse ist dazu gezwungen, sich national zu organisieren und ihrem Durchschnittsinteresse eine allgemeine Form zu geben; diese ‘allgemeine Form’ ist der Staat, der definiert wird als ‘weiter Nichts als die Form der Organisation, welche sich die Bourgeois sowohl nach außen als nach innen hin, zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig geben’.“49
Für Hegel war die bürgerliche Gesellschaft ganz eindeutig Schöpfung der modernen Welt und erst jüngst zwischen Familie und Staat getreten. Marx sprach davon, Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben und sah im Staat nicht mehr die Wirklichkeit der sittlichen Idee, sondern eine Funktion der Gesellschaft.50
Darüber hinaus wandte sich Marx, anknüpfend an Feuerbach, generell von Hegels idealistischen Vorstellungen ab. „Das Sein ist Subjekt, das Denken Prädikat...Das Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken...Wir dürfen nur immer das Prädikat zum Subjekt und so als Subjekt zum Objekt und Prinzip machen - also die spekulative Philosophie nur umkehren, so haben wir die unverhüllte, die pure, blanke Wahrheit.“51
Ganz ohne den staatlichen Überbau geht es aber nicht, denn im Kapitalismus bedarf es einer von den individuellen Produzenten abgehobenen, ihnen fremd gegenüberstehenden Instanz, um die außerhalb ihres egoistischen Privatinteresses liegenden gesellschaftlichen Bedingungen von Produktion, im Sinne von Infrastrukturschaffung, und Reproduktion, also der Garantie der bürgerlichen Rechtsordnung, zu gewährleisten, eben der Instanz des Staates.
Dies setzt einen, gegenüber dem Reproduktionsprozeß verselbstständigten Apparat, mit eigenen organisatorischen Mitteln voraus. Der Staat überwindet manchmal sogar bestimmte private und soziale Kräfte, aber nur, um das Privateigentum zu stützen und dessen Wirklichkeit als die höchste Realität des politischen Staates, als die höchste moralische Realität zu bestätigen.52
Der Staat trägt also einen Doppelcharakter, einerseits besorgt er gewisse gemeinschaftliche Interessen der Gesellschaft und verhüllt andererseits die Partikularinteressen der herrschenden Klasse, denen er dient, indem er sie insgesamt in den Rang gemeinschaftlicher Interessen erhebt.53 Der später von Engels geprägte Begriff des „ideellen Gesamtkapitalisten“ schließt, wie gesagt, punktuelle Gegensätze zwischen dem Staat und den Kapitalisten nicht gänzlich aus. Der Begriff setzt vielmehr voraus, daß der Staat und nur der Staat bestimmte Funktionen erfüllen kann, auf welche die Kapitalisten angewiesen sind. Die Funktion des Staates besteht darin, die für das Gewinninteresse der Unternehmer notwendigen politischen Rahmenbedingungen zu schaffen und zu gewährleisten, seiner Funktion widerspricht er erst, wenn er mit eben dieser Aufgabe, nicht nur nach der subjektiven Meinung einiger Unternehmer, sondern auch objektiv, in Konflikt gerät.54
Die Selbständigkeit des Staates kommt nur dann vor, wenn kein Teil der Bevölkerung es zur Herrschaft über die Übrigen bringen kann.55
Von dieser wirklichen Selbständigkeit des Staates ist die scheinhafte Selbständigkeit zu unterscheiden, die Täuschung über den wirklichen Charakter des Staates. Die vermittelnden Momente, die in Hegels System die Lösung des Widerspruchs, zugunsten des Staates sichern sollen, der Souverän, die Bürokratie, die Mittelklassen und die Legislative, sind dazu nach Marx nicht im mindesten in der Lage. Letztlich ist Hegels Staat dem Privateigentum unterworfen und weit davon entfernt, über den Privatinteressen zu stehen oder das Allgemeininteresse zu repräsentieren. Der Staat hat, wenn eine herschende Klasse existiert, also nur die Illusion, bestimmend zu sein, während er tatsächlich bestimmt wird.56
Den Hegelschen Weltgeist bezeichnet Marx als Hieroglyphe für den Weltmarkt, welcher sich immer mehr überkommener Gesellschaftsformationen bemächtigt und diese nach eigener Logik umstrukturiert. Das System der Kapitalbewegung ordnet sich nach und nach alle Elemente der Gesellschaft unter, oder schafft die noch fehlenden Organe aus ihr heraus.
Die Vielfältigkeit der in der Menschheitsgeschichte zu beobachtenden Antagonismen war für Marx auf zwei klare Pole reduziert, auf das Kapital und die Arbeit, auf die Bourgeoisie und das Proletariat. Damit erschien der Punkt in der geschichtlichen Entwicklung erreicht, an dem die vielerlei Einzelantagonismen zusammenliefen zur letzten großen Auseinandersetzung, an dem die Dialektik ansetzte zu ihrem letzten großen Umschlag, der nach dem völligen Verlust des Menschen dessen völlige Wiedergewinnung bringen würde und damit die Einheit von Individuum und Allgemeinheit.57
Er schränkt aber ein, das diese Entwicklung nicht als gradlinig verlaufender Prozeß aufzufassen ist, der mit innerer Notwendigkeit ohne Umschweife zum industriellen Kapitalismus führt, sondern nur durch Abstraktion von der empirischen Mannigfaltigkeit beschrieben werden kann. Oder wie er selbst sagt: Unter vorläufigem Wegsehen von allen Phänomenen, welche das innere Spiel des Mechanismus verstecken.58
VI. Fazit
Marx Hinwendung zum Materialismus, seine „Übersetzung“ der Hegelschen Philosophie in einen soziologischen Ansatz, macht ihn, neben Anderen wie beispielsweise Emile Durkheim oder Max Weber, zu einem Begründer der positiven Wissenschaften.
Die Entwicklung seiner Methode vollzog sich, wie ich in den vorangegangenen Kapiteln versucht habe aufzuzeigen, schrittweise und fand erst 1844 ihren Abschluß. In der „Deutschen Ideologie“ schrieb er: „Da, wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Leben, beginnt also die wirkliche, positive Wissenschaft, die Darstellung der praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen...Die selbständige Philosophie verliert mit der Darstellung der Wirklichkeit ihr Existensmedium. An ihre Stelle kann höchstens eine Zusammenfassung der allgemeinen Resultate treten, die sich aus der Betrachtung der historischen Entwicklung der Menschen abstrahieren lassen.“59
Die Geschichte hat die Erwartungen von Karl Marx, in einem wesentlichen Punkt, bisher nicht bestätigt, nämlich dem Ende des Kapitalismus - der „Verwaltung von Menschen“, an dessen Stelle dann die „Verwaltung von Sachen“, in einer sozialistischen Weltgesellschaft, tritt, und eine umfassende Emanzipation des Menschen - hin zum Gattungswesen mit sich bringt. Der Staat ist, wie wir wissen, bisher nicht „abgestorben“. Marx konnte nicht voraussehen, bis zu welchem Grade der Kapitalismus im Stande war, sich selbst zu modifizieren und so die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Industrienationen zu befriedigen.60
Schon zu Lebzeiten ist Marx immer wieder an die Grenzen dessen gestoßen, was sein Ansatz leisten kann. Die Abweichungen von der gesollten Geschichte waren zeitweilig erdrückend.
Aber die im Frühwerk wurzelnden und im Hauptwerk, etwa dem ersten Band des „Kapital“, ausformulierten historischen Gesetzmäßigkeiten forderten ihren Tribut. H.A.Winkler spricht davon, daß etwa beim politischen Ende Napoleons III. bei Marx die „Idealsoziologie“ über die „Realsoziologie“ triumphierte.61
Schon in den hier behandelten Frühschriften, war die Annahme, daß die Staatsmacht unmittelbar im Dienst der herrschenden Klasse steht, so apodiktisch formuliert worden, daß daraus eine Art theoretischer Systemzwang wurde. Widersprach die historische Wirklichkeit der materialistischen Prämisse, so wurde der Widerspruch wohl festgehalten, aber sogleich als ein nur vordergründiger, „scheinbarer“ verortet und damit aufgehoben, denn das Wesen der geschichtlichen Entwicklung, „durfte“ durch den entgegengesetzten Schein nicht widerlegt werden. „So nützlich die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit aber auch sein mochte, wenn es um vermeintliche historische „Ausnahmen“ ging, so fraglich war es, ob es genügen würde, einen Zusammenstoß zwischen der Theorie und ihrer eigenen Gegenwart „auf dem Niveau der Geschichte“ aufzufangen.“62
Die These, der Staat sei der „ideelle Gesamtkapitalist“ beschreibt, meines Erachtens, zutreffend eine wesentliche Funktion des Staates in jeder Gesellschaft, in der privates Eigentum an den Produktionsmitteln dominiert.
Als bloßer Ausschuß, der die „gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisieklasse“ verwaltet, ist der Staat aber nur in einer historischen Situation denkbar, wo einem organisierten Bürgertum die Macht nicht durch andere durchsetzungsfähige Interessengruppen streitig gemacht wird. Das von Marx postulierte Verhältnis von Ökonomie und Politik ist aber dadurch insgesamt in Frage gestellt, daß diese historische Situation, in welcher die moderne Staatsgewalt rein aus den Interessen der Kapitalistenklasse abgeleitet werden konnte, cum grano salis nur auf die angloamerikanischen Staaten des 19.Jahrhunderts zutraf.63
Der Marxsche „Trick“ bestand jetzt aber gerade darin, die Verhältnisse im viktorianischen England zum „Normalfall“ zu erklären, der bedingt durch die Macht des Weltmarkts, über kurz oder lang zum „Normalfall“ der Weltökonomie werden wird. Laut Winkler gewinnt das „Axiom“, daß die Ökonomie in letzter Instanz die bestimmende Potenz ist, den Charakter einer Leerformel, wenn daneben die Möglichkeit eines grundlegenden Gegensatzes zwischen Wirtschaft und Politik eingeräumt wird.64 Anknüpfend an die Unterscheidung von N. Luhmann bleibt festzustellen, daß eben diese Formel Transzendenz besitzt und bei Vielen zum Glaubenssatz wurde.
„Die Grenzen des materialistischen Ansatzes nicht zu sehen, kann nur zu einer Verzerrung der historischen Wirklichkeit führen. Aber nicht bis zu den Grenzen zu gehen, an die man mit der Methode von Marx und Engels gelangen kann, heißt hinter dem historisch Erklärbaren zurückzubleiben.“65
Das gerade eine Megatheorie weit davon entfernt ist, das wirkliche Leben im Detail, die empirische Mannigfaltigkeit erschöpfend darzustellen ist einsichtig. Das beispielsweise die Gefahren einer gesellschaftlichen Stockung, durch zunehmende Bürokratisierung, oder die Institutionenkritik im allgemeinen von anderen Autoren besser und erschöpfender dargestellt wurden, reißt Marx nur dann vom Podest, wenn dieses in den Himmel ragt. „Je ne suis pas un Marxiste!“ Dieser Ausspruch stammt von ihm selbst.
Nachwort
Wie viele andere Aspekte des Marxschen Werkes wurden auch seine theoretischen Bemerkungen im Frühwerk über Staat und Gesellschaft zu oft im Licht späterer Interpretationen gesehen, die längst feste Gestalt angenommen haben, ohne allerdings als angemessener Ausdruck Marx´ eigener Anschauungen gelten zu können. Das will nicht sagen, daß diese Interpretationen keine Beziehung zu Marx´ Anschauungen haben, - aber sie heben einige Aspekte seiner Theorie auf Kosten anderer hervor und verzerren so durch unzulässige Vereinfachung ein äußerst komplexes und keineswegs eindeutiges Gedankengebäude;66 darüber hinaus ignorieren sie einige wichtige Züge des Marxschen Denkens, besonders die entscheidende Funktion die das Menschenbild „Das Konzept der Liebe“ und das dialektische Zusammenspiel verschiedener Sphären im Marxschen Werk spielen.
Die Kritik von Erich Fromm, die dieser vor 30 Jahren formulierte, trifft meines Erachtens, leider gerade heute wieder, allzuoft ins Schwarze. „Jeder fühlt sich berechtigt, über Marx zu reden, ohne ihn je gelesen zu haben, oder wenigstens so viel von ihm gelesen zu haben, um eine Vorstellung von seinem sehr komplexen, schwierigen und subtilen Gedankensystem zu bekommen.“67
Schade - es lohnt ihn zu lesen, seine brillianten Analysen haben ihn zurecht, zu einem Klassiker der Sozialwissenschaften werden lassen. Nicht zuletzt sein wortgewaltiger, sarkastischer Stil, mit dem er ihm „verbogen“ erscheinende Urteile über die wichtigen, die menschliche Existenz betreffenden, Phänomene „geradezubiegen“ versucht, macht ihn lesenswert.
Bezogen auf sein Frühwerk, mit einem zeitlichen Abstand von einhunderfünfzig Jahren, entpuppen sich heute viele, von ihm getroffene, Prämissen deutlich als Irrtümer. Jedoch die, sein Werk durchziehende, Tradition des Humanismus, seine, von tiefen Ernst geprägte Sorge um den Verlust der menschlichen Natur - die Frage nach dem Stellenwert der Liebe weisen in eine Richtung, von der ich ganz persönlich annehme, daß sie Wege aufzeigen kann, die sinnvoll sind. „Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette Zerpflückt, nicht damit der Mensch die phantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche.“68
Literatur
- Marx-Engels-Werke (MEW), Bände 1 bis 35, Berlin 1956-1967
- Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, J. Hoffmeister, Hrsg, Hamburg
- Feuerbach, L., Gesammelte Werke, Band 9, Berlin 1970
- Lenin, W.I., Werke, Band 29, Berlin 1955
- Fromm, E., Das Menschenbild bei Marx, Frankfurt 1963
- Hennig, E., Hrsg., Karl Marx / Friedrich Engels Staatstheorie, Frankfurt 1974
- Arthur, C.J., Dialectics of Labour, Oxford 1986
- Böhme, W., Hrsg., Kleines politisches Wörterbuch, Berlin 1978
- Miliband, R., Marx und der Staat, in: Internationale Marxistische Diskussion 15, Berlin
- Winkler, H.A., Revolution, Staat, Faschismus: zur Revision des historischen Materialismus, Göttingen 1978
- Fenske, H., Hrsg., Geschichte der politischen Ideen, Frankfurt 1987
- Fedossejew, P.N., Hrsg., Karl Marx Biographie, Berlin 1977
- Friedenthal, R., Karl Marx - Sein Leben und seine Zeit, München 1981
- Lukács, G., Der Junge Hegel, Werke Band 8, 3.Auflage, Berlin 1967
[...]
1 Miliband, S.3
2 MEW,29,S.312 f.
3 Miliband, S.3
4 Miliband, S.4
5 Fromm, S.71
6 Böhme, S.620
7 Böhme, S.171
8 Böhme, S.620
9 MEW,20,S.131/132
10 Böhme, S.171
11 Lenin, S.410
12 MEW,3,S.311
13 MEW,1,S.104
14 Hegel, § 257
15 MEW,1,S.103
16 Miliband, S.5
17 MEW,1,S.126
18 MEW,1,S.266
19 Miliband, S.6
20 Mew,1,S.285
21 MEW,1,S.260
22 MEW,1,S.260
23 Miliband, S.7
24 MEW,1,S.232
25 Fedossejew, S.56
26 MEW,1,S.321
27 Miliband, S.8
28 Hennig, S.33
29 MEW,3,S.125
30 Fromm, S.37
31 Arthur, S.7
32 Hennig, S.75
33 Hennig, S.71
34 Fromm, S.24
35 Lucács, S.71
36 Fromm, S.5
37 MEW,1,S.376
38 MEW,1,S.353
39 MEW,1,S.356
40 MEW,1,S.385
41 Arthur, S.111
42 Fromm, S.49
43 Fenske, S.440
44 MEW,1,S.619
45 Friedenthal, S.244
46 MEW,1,S.338
47 MEW,1,S.370
48 MEW,3,S.113
49 MEW,3,S.62
50 Winkler, S.35
51 Feuerbach, S.258 u. 244
52 Hennig, S.84 ff.
53 Winkler, S.40
54 Winkler, S.48
55 MEW,3,S.62
56 Miliband, S.6
57 Fenske, S.440
58 MEW,3,S.62
59 MEW,3,S.27
60 Fromm, S.8
61 Winkler, S.58
62 Winkler, S.40
63 Winkler, S.63
64 Winkler, S.64
65 Winkler, S.64
66 Miliband, S.3
67 Fromm, S.17
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Fokus der "Die Frühen Schriften"?
Die Arbeit analysiert die im Marxschen Frühwerk formulierten Grundlagen der materialistischen Geschichtsschreibung, mit besonderer Berücksichtigung der Staatstheorie.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Vorwort, Die Dialektik, Der Mensch, Der Staat, Die Gesellschaft, Das Zusammenspiel, Fazit, Nachwort und Literatur.
Welche Rolle spielt die Dialektik in Marx' Frühwerk?
Die Dialektik, insbesondere das Gesetz der Negation der Negation, ist eine zentrale Methode, die Marx von Hegel übernimmt und zur Analyse gesellschaftlicher und historischer Entwicklungen einsetzt.
Wie bewertet Marx den Staat in seinen frühen Schriften?
Anfangs von Hegel beeinflusst, kritisiert Marx später die Vorstellung eines gerechten Staates und betont den Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft. Er strebt nach einer "wahren Demokratie", in der der Staat nicht von der Gesellschaft entfremdet ist.
Welche Bedeutung hat die Arbeit in Marx' Theorie?
Marx sieht die Arbeit als Grundtatsache der Geschichte und des Menschen. Er betont den Arbeitsprozess für die Selbstkonstitution der Menschheit und kritisiert, wie der Kapitalismus die Arbeit in entfremdete Tätigkeit verkehrt.
Was ist Marx' Menschenbild?
Marx' Menschenbild wurzelt in der humanistischen Tradition und betont die "Sorge" um den Menschen und die Verwirklichung seiner Möglichkeiten. Er sieht den Menschen als ein gesellschaftliches Wesen, das von der Gesellschaft sowohl gefördert als auch gehemmt wird.
Welche Rolle spielt das Proletariat in Marx' Theorie?
Marx sieht das Proletariat als "Agent der Auflösung der bestehenden Gesellschaftsordnung", da es die Inkarnation der Entfremdung darstellt. Er strebt eine soziale Revolution an, die vom Proletariat durchgeführt wird.
Wie beschreibt Marx das Verhältnis von Staat und Gesellschaft im Kapitalismus?
Marx argumentiert, dass der Staat im Kapitalismus eine "allgemeine Form" ist, die die Bourgeoisie zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig gibt. Er kritisiert Hegels idealistische Vorstellung, dass der Staat über den Privatinteressen steht.
Was ist die Bedeutung des Begriffs "Gattungswesen" bei Marx?
Der Begriff "Gattungswesen", ursprünglich von Feuerbach stammend, bezeichnet den nicht von sich selbst entfremdeten – den wirklichen Menschen. Das angestrebte Ziel ist die Emanzipation des Menschen, der sich als ein solches Gattungswesen versteht und nicht als egoistisches Einzelwesen.
Welche Kritik übt Marx am Kapitalismus?
Marx kritisiert, dass der Kapitalismus das Interesse an Geld und materiellen Gewinn zum Hauptmotiv des Menschen gemacht hat und die menschliche "Lebenstätigkeit" in erzwungene, entfremdete und letztlich sinnlose Arbeit verkehrt hat.
Inwiefern wird Marx als Begründer der positiven Wissenschaften gesehen?
Marx' Hinwendung zum Materialismus und seine "Übersetzung" der Hegelschen Philosophie in einen soziologischen Ansatz machen ihn zu einem Begründer der positiven Wissenschaften, ähnlich wie Emile Durkheim oder Max Weber.
Welche Kritik wird an Marx' Ansatz geübt?
Kritiker bemängeln, dass Marx' Erwartungen bezüglich des Endes des Kapitalismus bisher nicht bestätigt wurden und dass seine Annahme einer unmittelbaren Abhängigkeit der Staatsmacht von der herrschenden Klasse zu einem theoretischen Systemzwang führte.
Was betont das Nachwort der Arbeit?
Das Nachwort betont, dass Marx' theoretische Bemerkungen im Frühwerk oft im Licht späterer Interpretationen gesehen wurden, die möglicherweise nicht seine eigenen Anschauungen angemessen widerspiegeln. Es plädiert für eine erneute Lektüre von Marx, um seine komplexen Gedanken besser zu verstehen.
- Quote paper
- Klaus Spieler (Author), 1996, Die frühen Schriften von Karl Marx, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106083