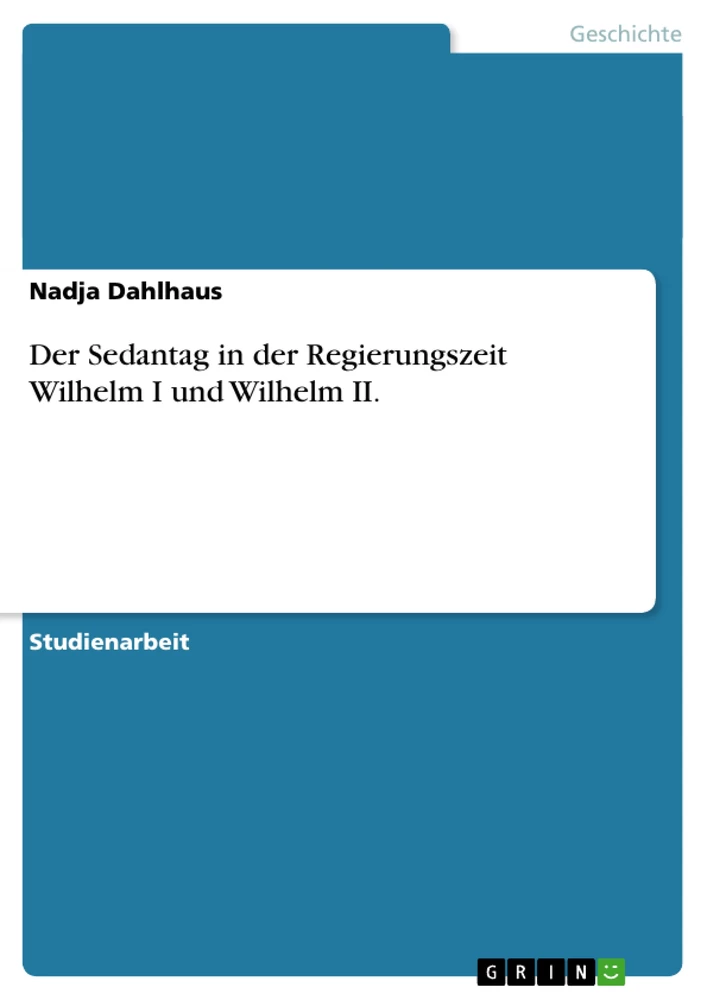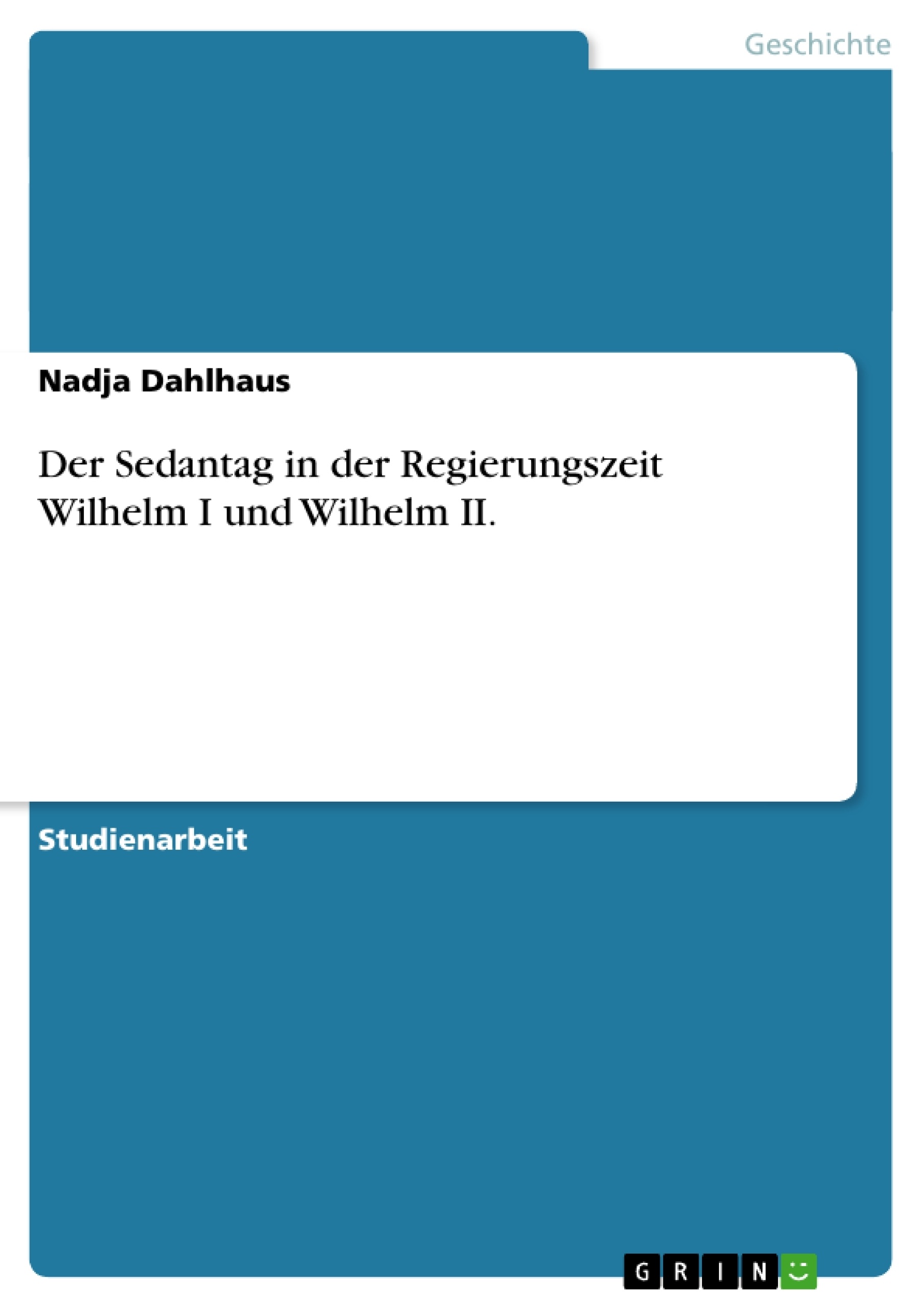Wie ein Schatten liegt der Sedantag über dem Kaiserreich, ein vermeintliches Fest der Einheit, das in Wahrheit tiefe Risse offenbart. Diese umfassende Analyse enthüllt die intrigenreiche Geschichte dieses Nationalfeiertags, von seinen idealistischen Ursprüngen in den Kreisen um Friedrich von Bodelschwingh bis zu seiner instumentellen Vereinnahmung durch den preußischen Staat. Tauchen Sie ein in die Welt der patriotischen Schulfeiern, der monumentalen Denkmalsstiftungen und der militaristischen Zurschaustellungen, die den Sedantag prägten. Doch hinter der glänzenden Fassade lauerte die Realität einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Der Kulturkampf und die aufkeimende Arbeiterbewegung stellten die Legitimität des Festes in Frage, Katholiken und Sozialisten boykottierten die Feierlichkeiten und prangerten den Militarismus und die Ausgrenzung Andersdenkender an. Erfahren Sie, wie der Sedantag, anstatt die Nation zu einen, die konfessionellen und politischen Gegensätze verstärkte und zum Ausdruck brachte. Verfolgen Sie die Entwicklung des Festes unter Wilhelm I. und Wilhelm II., die unterschiedlichen Schwerpunkte und die zunehmende Instrumentalisierung für propagandistische Zwecke. Diese tiefgreifende Untersuchung des Sedantages bietet neue Einblicke in die deutsche Nationalstaatsbildung, die Rolle von Festen und Symbolen in der Politik sowie die gesellschaftlichen Konflikte, die das Kaiserreich prägten. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für deutsche Geschichte, politische Kultur und die ambivalente Natur von Nationalfeiertagen interessieren. Entdecken Sie die verborgenen Geschichten hinter den Paraden und Festreden, die subtilen Widerstände und die unerfüllten Hoffnungen, die mit dem Sedantag verbunden waren. Ein essentielles Werk, um die komplexe Vergangenheit Deutschlands zu verstehen. Lassen Sie sich entführen in eine Zeit, in der nationale Begeisterung und politische Spaltung auf dramatische Weise aufeinanderprallten. Der Sedantag: Mehr als nur ein Datum, ein Spiegelbild der deutschen Seele.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1. Die Entstehung des Sedantages
2. Friedrich von Bodelschwingh und das Sedanfest
3. Festablauf und bedeutende Elemente
3.1 Die Schulfeierlichkeiten
3.2 Die Nationaldenkmalsstiftungen während der Sedanfeiern
4. Sedanfeste in der Regierungszeit Wilhelm I. und Wilhelm II.
5. Die Problematik mit dem Sedanfest
5.1 Auswirkungen des Kulturkampfes auf den Sedantag
5.2 Die Problematik mit den Sozialisten
Resümee
Einführung
Bei Nationalfeiertagen zeigt sich, wie der Staat sich nach außen darstellt und wie die Bevölkerung darauf reagiert. Neben der Nationalflagge und der Nationalhymne gehören auch die Nationalfeiertage zu dem deutschen Kaiserreich. Im Deutschen Kaiserreich existierten als Nationalfeiertage die Kaisergeburtstagsfeste und der Sedantag1. Während sich bei den Kaisergeburtstagsfesten der Gegenstand der Feier an einer Person orientierte, feierte man am Sedantag ein historisches Ereignis. In diesem Zusammenhang ergibt sich schon die erste Frage, nämlich in wieweit die unterschiedlichen Grundlagen, auf denen die Feiern beruhten, diese beeinflussten. Des weiteren wird dargestellt wie der Sedantag entstand, in diesem Zusammenhang möchte ich besonders auf die Rolle Friedrich Bodelschwinghs eingehen. Außerdem wird beschrieben wie gefeiert wurde -speziell am Beispiel Greifswalds- und welche Probleme im Zusammenhang mit den Feiern existierten.
Die innenpolitischen Spannungen konfessioneller und politischer Art, die das Deutsche Kaiserreich belasteten, sollten durch die Einführung des Sedantages vermindert werden. Das gelang jedoch nur unzureichend, denn der Sedantag besaß keinen integrativen Charakter, sondern grenzte eher aus. Der Sedantag sollte also eine konkrete innenpolitische Funktion haben, die er aber nicht erfüllte.
Zwar wurden verschiedene Teilaspekte des Sedantags untersucht, dennoch fehlt eine umfassende Darstellung. Während sich Harald Müller auf die Beziehung zwischen Arbeiterklasse und Sedanfest beschränkte, bezog sich Hartmut Lehmann auf die Darstellung der engen Beziehung Friedrichs von Bodelschwinghs zum Sedanfest. Autoren wie Ute Schneider und Fritz Schellack versuchten den Sedantag von allen Seiten zu beleuchten, wobei sich Ute Schneider bei der Untersuchung regional auf die Rheinprovinzen beschränkte.
1. Die Entstehung des Sedantages
Am 1. September 1870 wurde Napoleon III. während der Schlacht bei Sedan gefangen genommen. Einen Tag darauf kapitulierte die französische Hauptarmee, und der deutsch-französische Krieg war beendet. Als sich am 3. September im Deutschen Reich die Siegesnachricht verbreitete, kam es zu spontanen Feiern der Bevölkerung.2 Bereits im Frühjahr des Jahres 1871 nahm in Deutschland der Gedanke an die Einführung eines nationalen Festes Gestalt an. Das vordergründige Ziel war, dem neugegründeten Kaiserreich ein einheitlich festgelegtes Volks- und Kirchenfest zu geben.3 Anfangs engagierten sich hauptsächlich kirchliche Kreise für die Einführung eines Festtages. So gab es drei unterschiedliche Initiativen, den liberalen Protestantenverein, den Berliner Oberkirchenrat und den Rheinisch-Westfälischen Provinzialausschuss.4
Mitte Februar 1871 formulierte Franz von Hollzendorff einen Aufruf zur Stiftung eines neuen deutschen Volks- und Friedensfestes.5
Bei dem neuen Fest sollte die Kirche eine bedeutende Rolle spielen. Gemeinsam sollte dazu beigetragen werden, das deutsche Volk auch in der Gesinnung zu vereinen.6 Dem Projekt wurde somit eine große innenpolitische Funktion zugewiesen. Franz von Hollzendorff formulierte diese Funktionen des Projektes wie folgt:
„Kein Gesetz und keine Parlamentsdebatte vermag den Radikalen und Sozialisten sowie den Jesuiten und Ultramontanen soviel zu schaden, wie ein Volksfest, an dem jährlich daran erinnert wird, wer die Begründer und wer die Feinde des deutschen Reiches im Jahre 1870 gewesen sind.7 “
Es wurde also nicht eine Integration der reichskritischen Gruppen angestrebt, vielmehr sollte der Festtag eine Art Waffe in den Händen der reichstreuen Gruppen darstellen. Im März 1871 versuchten die Initiatoren weitere Personen für die Schaffung eines neuen Feiertags zu begeistern, da man auf Unterstützung der restlichen Gesellschaft angewiesen war. Diese fand man unter anderem beim badischen Großherzog Friedrich8, und weiteren 88 Unterzeichnenden zu denen Professoren, Kirchenräte, Verleger und Redakteure zählten. Der Brief wurde an den deutschen Kaiser Wilhelm I. weitergeleitet, der der Bitte aber nicht entsprach.9
Pastor Friedrich Bodelschwingh, der fast parallel zur Badischen Initiative sein Engagement für die Einführung von Friedensfesten verstärkte, schwebte das Vorbild der Leipziger Völkerschlachtfeiern vor, als er am 27. Juni vor der Generalversammlung des Rheinisch- Westfälischen Provinzialausschusses sprach. Bodelschwingh machte zwar sehr genaue Ausführungen zu der Gestaltung des Festes, aber keinen konkreten Terminvorschlag.10 Schließlich sollten die Gedanken des Provinzialausschusses einem breiten Publikum mit Hilfe eines Flugblattes unterbreitet werden. Die Auflage betrug 3000 Exemplare und enthielt die klaren Vorstellungen wie der Festablauf auszusehen hatte.11 Im Mai 1872 erfolgte erneut ein Aufruf des Sedantages. Wieder unterzeichneten 200 Personen, darunter bekannte Persönlichkeiten, den Aufruf, der sich diesmal allerdings gezielt an bestimmte Institutionen richtete.12 Die Antworten ergaben, dass die große Mehrheit sich für den 2. September als Nationalfeiertag aussprachen.13
Trotz der Ablehnung des Königs, Sedan als staatlichen Feiertag einzuführen, ergriff die Regierung Maßnahmen, um die Sedanfeierlichkeiten zu unterstützen. So gestattete die Regierung schon im August 1871 den Schulen und Beamten die Teilnahme an den Sedanfeiern und deren Förderung.14 Dieses Verhalten wertet Fritz Schellack als Versuch des Staates, den nicht-staatlichen Feiertag unter Kontrolle zu bringen und auch hier seinen Einfluss geltend zu machen.15
Der halboffizielle Charakter des Sedantages änderte sich im Jahr 1873, als Wilhelm I. im Verlaufe der Sedanfeiern in Berlin ein Denkmal einweihte. Durch die offizielle Teilnahme des Kaisers entwickelte sich der „spontane“ Feiertag zum Nationalfeiertag des Deutschen Kaiserreiches, und gelangte somit immer mehr unter staatlicher Kontrolle. Der spontane Charakter, den Wilhelm I. noch zu Anfang der Initiative hervorheben und beibehalten wollte, hatte sich so schon in den Anfangsjahren erschöpft. Durch das frühe Eingreifen und Reglementieren des Staates verloren die Sedanfeste ihre Eigendynamik, was sich in der schwankenden Teilnahme der Bevölkerung wiederspiegelte. Schon 1872 befanden sich der Feiertag in einigen Gebieten des neuen Reiches in einer Krise.16 In den weiteren Jahren bedurfte es einer regelrechten Werbekampagne von Seiten des Staates und anderer Unterstützung, um das Interesse der Bevölkerung an den Sedanfeierlichkeiten weiterhin zu erhalten, was nicht in allen Fällen gelang.17
Nach dem ersten Weltkrieg verlor der Sedantag entgültig an Bedeutung.18
2. Friedrich von Bodelschwingh und das Sedanfest
Da Bodelschwingh einerseits durch seine Initiative für die Einführung neuer Feiertage mit der Entstehung des Sedantages stark verknüpft ist, andererseits durch seine Eigenschaft als Pastor fernab vom Staatsgeschehen steht, soll in dieser Arbeit anhand einer Person die Motivation für die Erschaffung eines Feiertages näher erläutert werden. Gerade die damalige negative Einstellung gegenüber Frankreich stellt ein Grund für diese Art Programmgestaltung der „neuen“ deutschen Friedensfeste dar.19 Bei Bodelschwingh mag es sich ähnlich gestaltet haben, da er während seines Pastorats in Paris genug Erfahrungen über die französischen Festtraditionen sammeln konnte, die von den Initiatoren der Sedanfeste abgelehnt wurden. Sie versuchten sich mit dem Sedantag von den französischen Feiern abzugrenzen. Friedrich von Bodelschwingh scheint für mich eine geeignete Wahl, da seine Gedanken den Ablauf und die Entstehung des Sedanfestes weitgehend prägten.
Der junge Bodelschwingh absolvierte seinen Militärdienst, arbeitete als Verwalter auf einem Gut und engagierte sich im Rahmen dieser Tätigkeit auch für die Landarbeiter. Während dieses Engagements begann sich auch sein Interesse für Feste zu entwickeln, denn die üblichen Festen, bei denen die Arbeiter dem Alkohol für Bodelschwinghs Geschmack zu sehr zusprachen, stießen ihn ab.
Er gestaltete ein neues Fest, das im Freien statt fand und bei dem für die Bewirtung der Arbeiter und ihrer Familien gesorgt wurde. Abgerundet wurde der Festakt mit gemeinsamen Singen von Kirchenliedern, einer kurzen Ansprache und einem abschließenden Gebet.20 Allerdings gelang es den Festteilnehmern, Alkohol auf die Veranstaltung zu schmuggeln. Eine dadurch anschließend entstandene Schlägerei führte dazu, dass Bodelschwingh vorerst das weitere Interesse an der Stiftung von neuen Feiern verlor. Im Jahre 1864, nach mehreren Ortswechseln und einem abgeschlossenen Theologiestudium, trat Bodelschwingh eine Pastoratsstelle in der westfälischen Gemeinde Dellwig an.21 Erneut wurde sein Interesse für Feste geweckt. Eine seiner ersten Amtshandlungen bestand darin, dass er das örtliche Schützenfest durch ein Missionsfest ersetzte. Dieses Missionsfest gestaltete er ähnlich wie das Arbeiterfest auf dem von ihm früher betreuten Gut.
Dadurch ermutigt, wollte Bodelschwingh andere Menschen für seine Feste begeistern. In einem Artikel, der im „Westfälischen Hausfreund“22 erschien, schrieb er, dass die Volksfeste nicht zu unterdrücken seien, sondern zu verbessern und mit der Kirche vielleicht zu versöhnen seien.23 Seiner Meinung nach war die Gestaltung der Missionsfeste und mancher patriotischer Feste schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch noch verbesserungswürdig. Es folgte am Ende des Jahres 1865 eine weitere Artikelserie im „Westfälischen Hausfreund“, die präzise Vorschläge für die Gestaltung von Festen im Familienkreise enthielten. Auch nach dem Ende des deutsch- österreichischen Konflikts regte Bodelschwingh weitere Friedensfeste an.24 Das Engagement Bodelschwinghs für die Festkultur begann also schon vor 1871. Wahrscheinlich weckten die spontanen Feiern der Bevölkerung nach dem deutsch- französischen Krieg erneut sein Interesse für Feste, konnte er doch so ein größeres Publikum beeinflussen und die neuen Feiern in seinem Sinne prägen. Hartmut Lehmann legt in seinem Aufsatz den Gedanken nahe, dass Bodelschwinghs Engagement nicht nur auf Eigenmotivation beruhte, sondern von anderer Seite dazu angeregt wurde.25 In einem weiteren Artikel des „Westfälischen Hausfreundes“ formulierte Bodelschwingh den Wunsch, das es bei den Festakten nicht mehr zu Saufgelagen kommen solle, sondern statt dessen “ ...nüchterne, keusche, fröhliche, fromme Friedensfeste...“ gefeiert werden sollten.26
In der folgenden Zeit wurden Bodelschwinghs Vorstellungen von einem solchen Friedensfest immer präziser. Nach Lehmann wollte Bodelschwingh den religiösen Ernst des Krieges in die Zeiten des Friedens transportieren.27 Er nutze seine Erfahrungen aus den Dellwiger Festen, publizierte die Festordnung im „Westfälischen Hausfreund“ und forderte seine Leser auf, ihm eventuell eigene Verbesserungsvorschläge mitzuteilen.28 Die Vorstellungen Bodelschwinghs basierten auf der Gestaltung der Oktoberfeste nach den Freiheitskriegen.
Der Werbefeldzug für seine Festideen begann am 10. Mai 1871 auf der Presbyterkonferenz zu Unna und wurde im „Westfälischen Hausfreund“ weiter geführt indem sich seine vorher allgemeingehaltenen Thesen präzisierten. Dort äußerte er sich auch erstmals zu dem Termin dieser Friedensfeier, nämlich nicht den 2. September, sondern dem 18. Juni, dem Schlusstag der Siegesfeiern in Berlin. Anschießend sprach er am 27. Juni 1871 vor dem Rheinischen Provinzialausschuss. In seiner Rede verurteilte er den verderblichen Charakter der französischen Volksfeste und forderte, dass ein Friedensfest - gestaltet wie die Oktoberfeste - wieder eingeführt werden müsste.29 Von Bodelschwingh ging also der grundsätzliche Vorschlag aus. Das Flugblatt, das hinterher vom Provinzialausschuss in Auftrag gegeben wurde, enthielt die bedeutendsten Bestandteile von Bodelschwinghs Rede. Dies ist der Grund, warum viele Autoren Bodelschwingh eine große Rolle bei der Initiative „ Sedanfest“ zuweisen. Bei dem weiteren Vorgang hielt sich Bodelschwingh im Hintergrund, es folgte lediglich am 2. September in der Ausgabe des „Westfälischen Hausfreundes“ ein Aufruf Bodelschwinghs, an den Sedanfesten teilzunehmen. Auch in den folgenden Jahren versuchte Bodelschwingh weitere Friedensfeste zu stiften.30 Er strebte mit seinem Einsatz eine Verbindung von Volks- und Kirchenfesten an. Dadurch wird ersichtlich, warum einem Fest, das einen politischen Hintergrund hatte, viele klassisch kirchliche Elemente beigefügt wurden.31
Bodelschwinghs Engagement war mit der Stiftung von neuen Friedensfesten nicht erschöpft. Nach seinem Ermessen hatte sich in den Kriegervereinen, wie zuvor bei den Festen, eine negative Entwicklung vollzogen. Seiner Ansicht nach wurde zu viel getrunken und der religiöse Ernst wurde nicht verwirklicht. Außerdem missfiel es Bodelschwingh, dass die Kriegervereine nicht gemeinsam feierten.32 Da die Kriegervereine Hauptorganisatoren der Sedanfeiern waren, verstand es sich für Bodelschwingh von selbst, diesem Einfluss entgegen zu wirken, in dem er selber Kriegervereine gründete.33 Allerdings führten seine Bemühungen zu keinem Ergebnis.34
Nach der Niederlage mit den Kriegervereinen unternahm Bodelschwingh keinen Versuch mehr, die Kriegervereine und Feierlichkeiten zu reformieren.
Am Ende war es Bodelschwingh nicht möglich, den von ihm gewünschten religiösen Ernst bei den Festen zu verankern.
3. Festablauf und bedeutende Elemente
Der Festablauf orientierte sich stark an den von Bodelschwingh unterbreiteten Vorschlägen. Die meisten Festelemente waren von traditionell-klassischer Art und enthielten nichts Neues. Am Beispiel Greifswalds soll exemplarisch der Festablauf kurz dargestellt werden.
Begonnen wurden die Feierlichkeiten schon um acht Uhr morgens in der Schule. Danach folgte der Festgottesdienst, bei denen die Predigten meistens patriotischen Inhalts waren. Im weiteren Verlauf des Programms war wieder eine Schulfeier zeitgleich mit einem Frühschoppen vorgesehen. Es folgte ein einstündiges Geläut der Glocken. Anschließend fanden nacheinander Spiele der Schuljugend (meist sportlichen Charakters), Volksbelustigung und ein Konzert statt. Zuletzt wurde ein Ball veranstaltet.35 Die Gestaltung in den einzelnen Gemeinden unterschied sich, es waren aber doch immer die traditionellen Festelemente enthalten. Ergänzt wurde der Festablauf zum Beispiel mit Umzügen, Veteranenspeisungen und Feuerwerk. In den folgenden Jahren wurden die Sedanfeierlichkeiten zum Anlass von Spendenaktionen genommen. Da das Fest an die große Schlacht von Sedan erinnerte, ergab es sich von selbst, dass die Spenden hauptsächlich Kriegsveteranen oder deren Hinterbliebenen zu gute kamen.36 Zentrale Elemente während der Sedanfeste waren die Schulfeierlichkeiten und die Gottesdienste.
Organisiert wurden die Sedanfeste von Kriegervereinen37 oder den Festkomitees, die sich aus Mitgliedern der Kriegervereine und führenden Mitgliedern anderer Vereine zusammen setzten. Diese Festkomitees mussten sich um den Ablauf des Festes und um die Finanzierung kümmern. Dies gestaltete sich oft schwierig, da die Veranstalter auf Spenden der Bürger oder der Wirtschaft angewiesen waren. Vom Staat wurden die Feiern nur teilweise finanziell unterstützt. Somit ergab sich eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage des Staates.38
Zu Regierungszeiten Wilhelm II. veränderte sich der Festablauf. Er wurde zunehmend militarisiert. Die Festumzüge wurden genutzt um neuste militärische Errungenschaften oder generell die militärische Schlagkraft des Staates zur Schau zustellen.39 Außerdem wurden zu diesem Zeitpunkt Denkmalsstiftungen immer bedeutender.
3.1 Die Schulfeierlichkeiten
Die Jugend wurde auf besondere Art und Weise in das Feiergeschehen mit einbezogen. 1873 hieß es in einer Anordnung
„... dass überall, wo von anderer Seite am 2.Septemeber als dem Jahrestage der Schlacht von Sedan eine patriotische Erinnerungsfeier veranstaltet werde, die Schulen sich in angemessener Weise daran betheiligten und für diesen Tag den Unterricht aussetzen.“40
Fritz Schellack wertet diese Anordnung als einen weiteren Versuch der Behörden Kontrolle über einen nicht von oben angeregten Festtag zu erlangen. Ein anderer Grund mag sein, dass sich dadurch eine Möglichkeit ergab die zukünftige „Kriegergeneration“ zu nationalisieren und auf das Deutsche Kaiserreich einzuschwören.
Zwar waren bei den Schulfeierlichkeiten auch kirchliche Elemente enthalten41, dennoch stand der patriotische Aspekt im Mittelpunkt. So wurden mit den Kindern Manöver besichtigt und sie erhielten als Festgeschenk „Sedanbüchlein“42. Nachmittags wurde dann auf den Schülerfesten gemeinsam Kaffee getrunken und Spiele veranstaltet.43 Welche große Bedeutung der Teilnahme beigemessen wurde zeigt auch, dass während des Kulturkampfes damit begonnen wurde die Teilnahme der einzelnen Schüler zu dokumentieren. Man ging sogar soweit die Teilnahme der Kinder bei den Eltern zu erzwingen.44 Außerdem hatten die Schulfeierlichkeiten einen nicht unerheblichen Einfluß darauf, die Akzeptanz der Sedanfeiern in den Gebieten wo sie anfangs auf Kritik stießen, zu fördern.
Aber selbst die Schulfeierlichkeiten konnten der späteren Entwicklung - der abnehmenden Teilnahme an den Festen - nicht entgegen wirken. Zu Beginn des 20. Jhs. feierten auch die Schulen immer seltener. Um dies zu unterbinden forderten der Kulturminister und der Innenminister im Jahre 1905 die Schulen auf, wieder Gedenkfeiern zu veranstalten und den Unterricht am 2. September auszusetzen. Doch schon 15 Jahre später wurde es den Schülern bei Strafe verboten, während der Schulzeit an Feierlichkeiten zum 2. September teilzunehmen.45
3.2 Die Nationaldenkmalsstiftung während der Sedanfeiern.
Denkmalsstiftungen waren auch schon in der Regierungszeit Wilhelm I. üblich. Eines der bekanntesten ist die Siegessäule in Berlin. Sie sollte den glorreichen Sieg über Frankreich repräsentieren. Allerdings entwickelten sich die Denkmalsstiftung erst in der Regierungszeit Wilhelm II. zum zentralen Bestandteil des Festablaufes. Es handelte sich regelrecht um eine Modeerscheinung. Selbst kleine Gemeinden errichteten ihr eigenes Denkmal, oft scheiterte die Fertigstellung aber an den finanziellen Mitteln.46 Meist gestaltete es sich so, dass am Sedantag der Grundstein des Denkmals feierlich gelegt wurde und ein Jahr später erfolgte dann die feierliche Einweihung.47 Die Anregung zur Errichtung eines Denkmals ging beinahe immer von Kriegervereinen oder Beamten aus. Der Vorteil war, dass sie als Komiteevorsitzende oder Ehrenmitglieder nachgesagt wurde, es habe bei der Schilderung übertrieben. Trotzdem ist es wahrscheinlich ist es, dass die Bewirtung von Bier zum Beispiel auf heiße Schokolade umgestellt worden ist. Vgl. U. Schneider, 248.
für die Seriosität des Planes standen. Außerdem konnte dem Vorhaben so ein offizieller Anstrich gegeben werden, ohne dass es den freiwilligen Charakter einbüßte.48
Die Denkmäler die auf Initiative des Staates errichtet wurden, finanzierte auch der Staat.49
Kaiser Wilhelm II. hatte eine Schwäche dafür, Denkmäler seines Großvaters Wilhelm I. zu errichten.50 Es wurden ungefähr dreihundert bis vierhundert Denkmäler erbaut, die Wilhelm I. darstellten, die aber bei weitem nicht alle auf die Initiative Wilhelm II. zurückzuführen sind. Die Denkmäler sind immer weniger individuelle Denkmäler des dargestellten Monarchen, sie sind vielmehr Denkmäler des fürstlichen Berufes, der Monarchie als Regierungsform und auch Denkmäler der Nation. Sie symbolisierten den monarchisch-militärischen Staat und waren Ausdruck tiefen Patriotismusses. Bismarckdenkmäler wurden nicht gerne gesehen. Allerdings ist auch eine geringere Anzahl Wilhelm I.-Denkmälern in den katholischen Gebieten und in den Westprovinzen des Reiches zu verzeichnen in Hannover gab es am wenigsten.51
4. Sedanfeste in der Regierungszeit Wilhelm I. und Wilhelm II.
Bis 1873 sah der Staat keinen Anlass die Sedanfeiern offiziell zu begehen. Wilhelm I. verlieh dem Feiertag im Jahr 1873 den Status eines staatlichen Feiertages.52 Es existiert zwar keine offizielle Erklärung von staatlicher Seite in der dem Sedantag der Status eines offiziellen Nationalfeiertag verliehen wird, doch gibt es Anordnungen, die als solche gewertet werden können.53
Der Festablauf orientierte sich an den gemachten Vorschlägen der Sedan-Initiatoren. Dass das neue Kaiserreich schon in der Anfangszeit mit innenpolitischen Schwierigkeiten zukämpfen hatte, wirkte sich wie gesagt auch auf den Festakt aus.
Wilhelm I. hatte aber während seiner Regierungszeit vordergründig mit konfessionellen Problemen zu kämpfen. Am 10. Jahrestag der Schlacht von Sedan wurden Stimmen laut, die forderten den Sedantag lieber in ruhiger Atmosphäre zu begehen um so das allgemeine Friedensbedürfnis auszudrücken. Außerdem wurde der zunehmende militärische Charakter des Festes kritisiert, der den Volksfestcharakter immer mehr überwog. Dadurch würde das Sedanfest dem Begriff Nationalfest nicht mehr gerecht.54 Zwar begann die Militarisierung während der Regierungszeit Wilhelm I., erreichte aber seinen Höhepunkt erst in der Regierungszeit Wilhelm II.55
Dieser benutze die Sedanfeiern dazu die Kriegsleistungen seines Großvaters und seiner Armee zu glorifizieren. Bemerkenswert ist, dass sich die Bevölkerung trotz der Auswirkung des Kulturkampfes auf die Sedanfeiern am „Wilhelm I.- Kult“ beteiligte. Die Schuld an den sich aus dem Kulturkampf ergebenen innenpolitischen Spannungen wurden nicht dem Kaiser sondern Bismarck angelastet.56
In der Regierungszeit Wilhelm II. erreichten die Feierlichkeiten im Jahr 1895 zum 25.-jährigen Jubiläum ihren Höhepunkt. Erstmals griff der Staat massiv in den Festablauf ein.57 Das Hauptaugenmerk wurde auf die Feiern in Berlin gerichtet, den eigentlichen Feiern zum 2. September gingen aber andere festliche Akte voraus.58 Der es von 1886 eine Anordnung die verfügte, dass alle öffentlichen Gebäude beflaggt werden sollten. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, S.103.
Aufwand, der bei der Begehung der Feiern zum 25. Jubiläum getätigt wurde, verschärfte auch die innenpolitische Situation. Zwar hatten sich nach der Beendigung des Kulturkampfes die Katholiken mit den Sedanfeiern arrangiert, aber nun verschärfte sich die Situation mit den Sozialisten. So traten bei Wilhelm I. während der Sedanfeiern eher die konfessionellen Unterschiede zutage, wogegen bei Wilhelm II. die politischen Unterschiede sichtbar wurden.
5. Die Problematik mit dem Sedanfest
Da der Sedantag als patriotisches Fest ausgelegt war, das Zustimmung zum Staat voraussetzte, wurden gerade bei den Sedanfeiern innenpolitische Probleme offensichtlich, die sich direkt auf die Feste auswirkten . Das Ziel die einzelnen Länder zu einem Staat zu vereinen war zwar gelungen, aber nicht eine einheitliche Gesinnung zu schaffen. Auch die Einführung eines Nationalfeiertages konnte dies nicht erreichen. Der Staat reagierte auf Andersdenkende mit Ächtung, Verboten und dem Versuch einer zwanghaften Gleichschaltung. Gerade ein Feiertag der als „Prüfstein nationaler Gesinnung“ galt, eignete sich hervorragend als politisches Forum, um den Staat mit offenem Protest oder Boykottierung zu kritisieren.
5.1 Auswirkungen des Kulturkampfes auf den Sedantag
Da der Sedantag auf Initiative protestantischer Kreise zurückzuführen ist, entstanden wahrscheinlich schon so die Proteste der Katholiken. Aber auch die abwehrende Haltung des Staates gegenüber der katholischen Konfession erschwerte die Lage. Gerade in Staatsgebieten in denen die meisten Einwohner katholischer Glaubensrichtung waren, kam es zu Problemen während der Sedanfeierlichkeiten. Die katholischen Bürger und die katholischen Geistlichen standen dem Sedantag skeptisch gegenüber. Wurde doch an dem Tag ein Staat gefeiert, der sie als „Reichsfeind“ titulierte und versuchte, sie ins politische Abseits zu drängen.
Die Reaktion der Katholiken bestand darin, dass sie zum Beispiel Glockengeläut und Festgottesdienst verwehrten. Außerdem wurde den katholischen Geistlichen die Teilnahme an den Sedanfeiern untersagt.59 Dadurch sahen sich die örtlichen Beamten und Bürgermeister der betroffenen Gemeinden provoziert. Schließlich gehörte sowohl der Gottesdienst sowie das Glockengeläut zu einem zentralen Bestandteil des Festes.60 Es wird berichtet, das sogar vereinzelt evangelische Geistliche nicht an den Feierlichkeiten teilnahmen.61 Zum offenen Protest der katholischen Bevölkerung kam es allerdings nicht, man beschränkte sich darauf den Feiertag zu ignorieren und durch „Nicht-Teilnahme“ zu boykottieren.
Selbst unter den Kriegervereinen machte sich der konfessionelle Unterschied bemerkbar, die konfessionellen Interessen wurden über die nationalen gestellt.62
Während des Kulturkampfes fielen deshalb in vielen ländlichen katholischen Gebieten die Kriegervereine als Organisatoren der Sedanfeierlichkeiten aus - und somit auch die Sedanfeste.
In den Städten hingegen nahmen die katholischen Kriegervereine an den Nationalfeiertagen teil. Der politische Katholizismus verfügte dort über eine bessere Organisationsstruktur, und war somit auf Unterstützung der Kriegervereine nicht angewiesen. Aus diesem Grund war es den katholischen Kriegervereinen möglich ihre nationale Gesinnung auszuleben.63
Erst nach Beendigung des Kulturkampfes erhielt der Sedantag auch unter katholischen Bevölkerungsgruppen Aufmerksamkeit. Dies war den Schulfeierlichkeiten und Kinderfesten, die auch in katholischen Gebieten durchgeführt wurden, zu verdanken. Die ultramontane Presse kritisierte zwar weiterhin die Sedanfeste, allerdings standen nicht mehr innenpolitische Konflikte im Vordergrund, sondern die negative außenpolitische Bedeutung des Feiertags.64
5.2 Die Problematik mit den Sozialisten
Die Sozialdemokratie lehnte den Militarismus des neuen Staates entschieden ab. Sie sah keinen Anlass ein Ereignis zu feiern, das einen „ ...Massenmord durch Festlichkeiten verherrliche“.65
Auch Arbeiterverbände, die der Sozialdemokratie politisch nahe standen, gingen mit dieser Auffassung konform. Die Sozialisten wurden ebenfalls von staatlicher Seite zu den „Reichsfeinden“ gezählt.66 Die beiden Attentate auf Wilhelm I. verschärften die Situation und Bismarck gelang es nach Neuwahlen im Parlament das Sozialistengesetz67 durchzusetzen. Zusätzlich wurde von der konservativen Presse die Sozialistenfurcht bei der Öffentlichkeit geschürt.
Durch die bedeutende Rolle die dem Sedantag von Seiten des Staates und der Initiatoren zugewiesen wurde, ergaben sich zwangsläufig Angriffspunkte bei den Sedanfeiern. Die Proteste setzten aber nicht erst während des Sozialistengesetzes oder danach ein, sondern schon in dem Anfangsjahr des Sedantages.
In Braunschweig fand die erste Protestversammlung gegen den Sedantag bereits am ersten September 1871 statt.68 Im Folgejahr verschärfte sich die Situation. Die Parteipresse der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gab die Erklärung ab, das sie keinen Anlass sehe den Sedantag feierlich zu begehen. Die Zeitung „ der Volksstaat“ richtete sich direkt in einem Artikel mit folgendem Inhalt an das Initiativkomitee “ Wir raten den Herren, einen viereckigen Denkstein aufzustellen, der auf einer Seite die Namen der Viertelmillion junger Männer enthält, die im `heiligen` gefallen oder an dessen Folgen gestorben sind; und gegenüber die Namen der Hunderttausende, die der `heilige` mit seinen `Siegen` aus dem ruhmreichen Vaterlande der Stieber, Steuern und Kasernen hinausgetrieben hat. Auf den anderen zwei Seiten könnte man die Pressprozesse, Zeitungskonfiskationen, Haussuchungen, Majestätsbeleidigungs- und Hochverratsprozesse nebst den Säbelaffären, Rekruten-Tottretung und -Aufknüpfen und anderen `Eigentümlichkeiten` des `neuen Reiches` verzeichnen.“ Obwohl man eigentlich davon ausgehen müsste, dass das Militär die Sozialisten nicht unterstütze, gab es auch in den Reihen des Militärs Symphatisanten.69 Die Sozialisten vermuteten hinter den Sedanfesten den Versuch des Staates als Demagoge aufzutreten, und warnte vor der Gefahr, dass die „Verpreußung“ Deutschlands gerade für die Arbeiter unangenehme Folgen haben könne. Um ihren Protest zu zeigen sollten sie an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen.70 Außerdem wurden Gegenkundgebungen angeregt. Falls diese durch Einschreiten der Behörden nicht durchführbar seien, sollten die Arbeiter trotzdem an den Umzügen teilnehmen und durch „Stehen-bleiben“ oder ähnliche Aktionen den Umzug behindern.71
Waren es im Jahre `71 hauptsächlich die Braunschweiger Arbeiter und Sozialisten die sich gegen die Sedanfeiern wandten, ergriff die Bewegung im Jahr 1872 auch andere Teile Deutschlands.72
Der Protest gestaltete sich unterschiedlich. Man beschränkte sich entweder auf das Hissen der roten oder schwarzen Flagge, organisierte Gegenveranstaltungen, oder nahm einfach nicht an den Umzügen teil.73 Der Staat reagierte mit Verhaftungen. Angeklagt wurden die Protestierenden meist wegen Majestätsbeleidigung. Selbst die Hauptstadt Berlin wurde nicht von Protesten der Arbeiter und Sozialisten verschont. Am 2. September 1873 sollte die Berliner Siegessäule eingeweiht werden, da die Zimmerleute im Frühjahr streikten war der vorgesehene Einweihungstermin gefährdet.74
Das Sozialistengesetz entzog offenen Protesten der Sozialisten erst einmal die Grundlage.75 Nach der Aufhebung des Gesetzes waren die meisten Menschen im Kaiserreich verunsichert. Dies hatte einen negativen Einfluss auf die Teilnahme der „normalen“ Bevölkerung am Sedantag. Auch veränderte sich die Art und Weise des Protestes. Die Sozialisten beschränkten sich nun nicht mehr auf einfache Gegenveranstaltungen, Flaggenhissen usw., sondern schufen sich ihren eigenen Feiertag.
Zu Ehren Ferdinand Lassalles76, wurden die sogenannten Lassallefeiern ins Leben gerufen. Die zeitliche Nähe nutzen die Sozialdemokraten aus, indem sie den Termin für die Feier auf den selben Tag festsetzten, an dem auch die Sedanfeiern statt fanden. Man rief auf, die Sedanfeiern zu boykottieren und statt dessen lieber an den Lassallfeiern teilzunehmen. Trotz einer Vielzahl von Veranstaltungen und einem hohen Mobilisierungsgrad blieben die Lassallfeiern im Jahre 1895 hinter den Erwartungen zurück. Die Sedanfeiern besaßen in den Augen der Menschen eine größere Attraktivität als die Lassallefeiern.
Die Haltung der Sozialdemokraten gegenüber dem Sedantag war nicht generell ablehnend.77 Nach 1895 verlor der Sedantag für die Sozialdemokratischen Proteste an Bedeutung, da nur noch Jubiläen öffentlich gefeiert wurden. Somit hatte sich die Angriffsfläche verkleinert.
Resümee
Meiner Ansicht nach konnte der Sedantag dem Begriff Nationalfeiertag nicht gerecht werden. Bei den Festen wurde zwar die Nation gefeiert, dennoch beteiligten sich nicht die gesamte Nation gleichermaßen an den Feierlichkeiten zum Sedantag.78 Sedan vereinte nicht, sondern brachte eher die politischen Spannungen zu tage und entzweite das Land. Auch ließen sich die Vorstellungen des Pastor Bodelschwinghs, einem der Hauptinitiatoren des Sedantages, auf Dauer nicht verwirklichen. Sedan gestaltete sich nicht als Friedensfest, an dem würdevoll und mit Einhaltung kirchlicher Festtraditionen dem Ereignis gedacht wurde, sondern er entwickelte sich immer mehr zu einem Feiertag des preußischen Militärstaates, der den Sedantag dazu nutzte, das Volk zu nationalisieren und seine militärische Macht zur Schau zu stellen. Da der Sedantag sich auf ein historisch abstraktes Ereignis bezog, im Gegensatz zu den Kaisergeburtstagsfeiern, in deren Mittelpunkt die reale Person des Kaisers stand, hatte er zusätzlich zu den innenpolitischen Problemen mit dem Generationswechsel und der dadurch entstehenden mangelnden Identifikation zu kämpfen.
Trotzdem hatte der Sedantag entscheidenden Einfluss auf die weitere Entwicklung Deutschlands, zum Beispiel hatten die stark national und militärisch geprägten Schulfeierlichkeiten keinen unerheblichen Einfluss auf die Kriegswilligkeit der deutschen Bevölkerung am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
Literaturverzeichnis
1.Becker, Joachim, Liberaler Staat und Kirche in der Ära von Reichsgründung und Kulturkampf, Mainz, 1973.
2.Düding, Dieter / Friedmann, Paul / Münch, Paul ( Hgg.), Öffentliche Festkultur: politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg, Hamburg, 1988.
3.Lehmann, Hartmut, Friedrich von Bodelschwingh und das Sedanfest, in: Historische Zeitschrift 202, 1966, S. 542 - 573.
4.Müller, Harald, Die deutsche Arbeiterklasse und die Sedanfeiern, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 1969, S. 1554-1564.
5.Nipperdey, Thomas, Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jh., in: Historische Zeitschrift 206, 1986, S. 529-585.
6.Schellack, Fritz, Nationalfeiertage in Deutschland von 1881 bis 1945, in: Europäische Hochschulschriften III., B. 415, Frankfurt a. M. u. a., 1990.
7.Schneider, Ute, Politische Festkultur im 19 Jh. : die Rheinprovinz in der Französischen Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1806 bis 1918, Essen, 1995.
8.Wehler, Hans-Ulrich, Das Deutsche Kaiserreich: 1871 bis 1918, Goettingen, 1988.
[...]
1 Die Kaisergeburtstagsfeste und der Sedantag entsprechen zwei alten Feiertraditionen. Vgl. Fritz Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, in: D. Düding, P. Friedmann, P. Münch, Öffentliche Festkultur, Hamburg 1988, S. 278.
2 Vgl. Ute Schneider, Politische Festkultur im 19. Jh.: die Rheinprovinz in der Französischen Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1806 bis 1918, Essen, 1995, S. 239.
3 Vgl. F. Schellack , Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 278-297.
4 Der Initiative des Oberkirchenrates soll hier keine große Bedeutung beigemessen werden, weil die Initiative sich nur um die Organisation eines einmaligen Festes bemühte. Allerdings ist interessant, dass er sich vorstellte, Friedensfeste und Gedenkfeiern zu Ehren der Gefallenen getrennt zu veranstalten. Mit diesem Gedanken konnte der Staat sich aber nicht anfreunden. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, S. 71.
5 Der Strafrechtler Franz von Holzendorff war einer der Gründer des liberalen Protestantenvereins. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 279
6 Johann Caspar Bluntschli, Vorsitzender des Protestantenvereins in Karlsruhe, zeigte großes Interesse für den Vorschlag und schlug vor, eine politische Konfirmation in die Mitte des Festes zu stellen. Vgl. F. Schelllack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1971 bis 1945, S. 70.
7 Zitiert nach J. Becker, Liberaler Staat und Kirche in der Ära von Reichsgründung und Kulturkampf, Mainz 1973, S. 311.
8 Man warb um seine Unterstützung während einer Audienz anlässlich der Einweihung des Reichstages, ein sehr gut gewählter Augenblick, wenn man beachtetet, dass es um eine nationale Feier ging, und ein nationales Gebäude eingeweiht wurde.
9 Die Initiative hatte nicht mit der Ablehnung des Kaisers gerechnet. Dem Kaiser aber war es lieber, wenn die Feiern sich spontan aus der Bevölkerung heraus ergaben. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 279.
10 Pastor Schürmann aus Capellen hingegen schlug den 1. September als Termin für die Feier vor. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1971 bis 1945, S. 76.
11 Vorbild für die neue Feier war die Leipziger Völkerschlachtfeier, die sich gewollt abgrenzte gegen die französischen Feiern. Die Feier sollte aus zwei Teilen bestehen, einer Vorfeier am Abend des 1. Septembers und einer Hauptfeier am 2. September. Man stellte sich vor, dass Freudenfeuer, patriotische Gesänge und Glockengeläut den Sedantag ankündigen könnten. Der Festgottesdienst sollte Lobesgesänge, Dankesgebete und Predigten, die an die ruhmreiche Vergangenheit erinnerten, enthalten. Danach war geplant, dass sich die Menschen im Freien vergnügen mit Musik und Festreden, weiteren patriotischen Liedern und anschließender 4 Volksbelustigung. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S.281.
12 Zum Beispiel an Schul- und Kirchenbehörden, Stadtverordnetenversammlungen und an des Kabinett des badischen Großherzogs. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, S. 79.
13 Die Terminwahl war vorher nicht eindeutig gewesen, da drei Termine zur Verfügung standen, nämlich der 18. Januar (Kaiserproklamation), der 10. Mai (Unterzeichnung des Frankfurter Friedens) und der 2. September. Vgl. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, S. 83.
14 Den Schulen wurde erlaubt, sich in angemessener Weise an den Feierlichkeiten zu beteiligen, um dies zu ermöglichen sollte am 2. September kein Unterricht statt finden. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 282.
15 Ob das frühe Eingreifen des Staates von vornherein den Sedantag zum Scheitern verurteilte sei dahingestellt. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S.282.
16 Beispielsweise im Rheinland war der Sedantag nicht so anerkannt, genauso wie in den neuen Provinzen, was einerseits an der Mehrzahl der Katholischen Bevölkerung lag, andererseits an der unmittelbaren Nähe zum Nachbarland Frankreich. Vgl. U. Schneider, S. 241.
17 Gerade den finanziellen Belastung der Gemeinden, die mit den Feiern einhergingen versuchte Wilhelm II. zum Beispiel mit der Aufhebung der Lustbarkeitssteuer entgegen zu treten. Gegen andere Umstände, wie zum
18 Offizielle Feiern wurden zwar nicht mehr veranstaltet, aber trotzdem ist bekannt, dass die Menschen im privaten Bereich der Schlacht von Sedan gedachten indem sie sich zum Beispiel die Flagge Preußens an die Kleidung hefteten.
19 Vgl. Hartmut Lehmann, Friedrich von Bodelschwingh und das Sedanfest, in: Historische Zeitschrift 202, 1966, S. 542 - 573.
20 Der ganze Ton der Feier wurde geprägt durch Lob, Dank, Demut und Verpflichtung. Vgl. H. Lehmann, S. 544.
21 Vorher hatte Bodelschwingh schon in Paris als Pfarrer gearbeitet, nahm dort aber nur an einigen Missionsfesten teil oder gestaltete einzelne Ereignisse in seiner Gemeinde zu größeren Festlichkeiten vgl. H. Lehmann, S. 544.
22 Der „Westfälische Hausfreund“ wurde seit dem 1. Januar 1865 von Bodelschwingh selber herausgegeben und war sein wichtigstes Publikationsmedium. Vgl. H. Lehmann, S. 545.
23 Der Artikel erschien am 17. Dezember 1865 unter dem Titel „ Die Kirche und die Volksfeste“ Vgl. H. Lehmann, S.545.
24 Allerdings hielten sich in dem Falle die Vorschläge sehr allgemein. Vgl. H. Lehmann, S. 545.
25 Das kirchliche Gemeindeblatt in Leipzig mokierte sich schon im Januar `71 darüber, dass der Buß- und Bettag nicht an einem Tag von allen Deutschen Ländern gefeiert wurde und hoffte, dass nach dem Sieg über Frankreich dies wieder eingeführt würde. Einen zweiten Denkanstoß könnte Bodelschwingh von einer Beilage in der „Karlsruher Zeitung“ erhalten haben, in der der liberale Protestantenverein dazu aufrief, ein Volks- und Friedenfest einzurichten, das an die Einigung des deutschen Reiches erinnere. Vgl. H. Lehmann S. 547.
26 Vordergründig ging es in dem Artikel um die Frage „ welches Geburtstaggeschenk“ dem König gemacht werden könne. Er schlug vor den evangelischen Dom in Berlin zu errichten und formulierte anschließend seinen Wunsch der die Friedensfeste betraf. Vgl. 546
27 Vgl. H. Lehmann, S. 546.
28 Gestaltungselemente des Dellwigerfestes waren ein Dankgottesdienst, die Grundsteinlegung für einen weiteren Teil der Kirche, Pflanzung einer Friedenseiche, Festzug, Reden, Volksbeköstigung, gemeinsames Singen und ein Freudenfeuer. Anschließend wurde ein Hoch auf den Kaiser ausgebracht und nach dem Singen eines Schlussliedes war die Feier beendet. Vgl. H. Lehmann, S. 548.
29 Ursprünglich sollte Bodelschwingh über ein anderes Thema referieren. Dies wurde aber kurzfristig geändert. Vgl. H. Lehmann, S.552.
30 Vgl. H. Lehmann, S.556.
31 Vgl. Anmerkung 5.
32 Für diese gemeinsamen Feiern hatte er den Sedantag ins Auge gefasst. Vgl. H. Lehmann, S. 527.
33 Die Kriegervereine, an deren Gründung Bodelschwingh mitwirkte, waren christlich geprägt, was sich auch in der Namensgebung niederschlagen sollte. Dies führte zu Konflikten mit dem „ deutschen Kriegerbund“, die christlichen Kriegervereine wurden nicht anerkannt. Somit waren die christlichen Kriegervereine dazu gezwungen bei ihrer Namensgebung sorgfältiger zu sein und nannten sich fortan „ Verein alter Krieger und Landswehrleute“. Vgl. H. Lehmann, S. 571.
34 Zusammen mit der Namensänderung und der Bitte an den Staat, seine Initiative in Bezug auf Kriegervereine zu unterstützen, gab Bodelschwingh sich indirekt geschlagen, da er die weitere Verantwortung an den Staat abtrat.
35 Das Festprogramm beendete eine Ankündigung zur Nationalfeier im Greifswalder Wochenblatt vom 30.08.1873. In dem Artikel werden außerdem noch die Spender erwähnt und die Bewohner zur Teilnahme an dem Fest und zum schmücken der Häuser aufgerufen. Vgl. Greifswalder Wochenblatt 101, 30.08.1873.
36 Die Spenden wurden von den Städten oder von Stiftungen finanziert. Gegen Ende des 19Jhs. nahmen auch Privatpersonen, zum Beispiel Fabrikanten, Anteil am Kriegerschicksal und ließen ihren Arbeitern, die am Krieg teilgenommen hatten, Geldgaben zukommen. Vgl. U. Schneider, S. 254.
37 Der „Deutsche Kriegerbund“ umfasste 1873 etwas weniger als 30.000 Mitglieder, bis 1910 stieg die Mitgliederzahl auf 1,7 Millionen an. Andere Kriegerverbände fassten noch mal 2,5 Millionen Mitglieder. Diese Kriegerverbände stellten eine nicht unbedeutende Macht dar. Vgl. Hans - Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich: 1817 bis 1918, Goettingen, 1988, S. 164.
38 Die Weltwirtschaftskrise von 1882 dürfte einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Sedanfeste genommen haben
39 Die Militarisierung der Feier hatte schon in der Regierungszeit Wilhelm I. begonnen und verschärfte sich in der Regierungszeit Wilhelm II., wodurch der Sedantag immer mehr einem Militärfest glich und fast seinen Volksfestcharakter verlor. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S.284.
40 Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 282.
41 Es fanden ein Gottesdienst oder eine Andacht am Anfang und am Ende der Veranstaltungen statt. Vgl. U. Schneider, S. 281.
42 „Sedanbüchlein“ waren kleine Bücher die Bilder und Texte über den Kriegsverlauf 1870/71, die Schlacht von Sedan, den Kaiser und des Militärs enthielten. Vgl. U. Schneider, S. 248. , und F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 282.
43 Diese Schulfeste konnten auch schon einmal ein beträchtliches Ausmaß annehmen. In Düsseldorf wurden 1876 die Kinder zu den nachmittäglichen Aktivitäten zusammengelegt. Da das Wetter die Veranstalter und Organisatoren dazu zwang die Kinder drinnen zu bewirten, unter anderem auch mit Bier, soll es zu unschönen Szenen gekommen sein. Allerdings wurde dieser Festbericht in einem katholischen Tageblatt verfasst, dem
44 Die Bürgermeister wurden bei Boykottverdacht als Schulvorstände eingeschaltet. Vgl. U. Schneider, S. 249.
45 Vgl. U. Schneider, S. 252.
46 Für die Finanzierung waren die Initiatoren selbstverantwortlich, sie waren auf Spenden und Sammlungen angewiesen. Vgl. U. Schneider, S. 254.
47 Vgl. U. Schneider, S. 253-254.
48 Eines der bekanntesten ist das „Kyffhäuserdenkmal“ am Deutschen Eck. Barbarossa und Wilhelm I. werden zusammen dargestellt. Vgl. Thomas Nipperdey, Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jh., in : Historische Zeitschrift 206, 1968, S. 529 - 585.
49 Das „offizielle“ Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. in Berlin (1897), dessen Errichtung auf Beschluss des Reichstages zurückging und das aus der Staatskasse mit vier Millionen Mark finanziert worden war, nennt darum in der Innschrift „ das deutsche Volk“ als Stifter. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 285.
50 Am 4. September 1894 weihte Wilhelm II. feierlich ein Kaiser-Wilhelmdenkmal in Königsberg ein, zwei Jahre später eins in Breslau. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, S. 286.
51 Vgl. T. Nipperdey, S. 543.
52 Da Wilhelm I. im Laufe der Sedanfeiern in Berlin die Siegessäule einweihte.
53 Zum Beispiel die Anordnung vom 13. August 1873, in der den Schulen gestattet wurde den Unterricht am Sedantag ausfallen zu lassen. Vgl. F. Schellack, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste S. 282. Desweiteren gibt
54 Diese Überzeugungen vertrat vor allen Dingen Johan Casper Bluntschli, der sich im Jahr 1871 auch für die Einrichtung eines allgemeinen Volks- und Friedenfestes engagiert hatte. Er war der Ansicht, dass die Sedanfeiern zu sehr auf ein geschichtliches Ereignis beschränkt seien und müssten von daher zwangsläufig verblassen. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, S. 105.
55 Förderlich war in dieser Hinsicht, dass der Sedantag in die Zeit der kaiserlichen Herbstmanöver fiel, die unter Wilhelm II. von zahlreichen gesellschaftlichen Anlässen begleitet wurden. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 19 45, S. 107.
56 Vgl. U. Schneider, S. 253.
57 Um möglichst große Teile der Bevölkerung zu mobilisieren wurde verfügt, dass am 2. September in staatlichen Betrieben den Arbeitern mit Einschränkungen freigegeben werden sollte. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, S. 111.
58 Am 18. August war die feierliche Grundsteinlegung des Kaiser Wilhelm I. Nationaldenkmals, am 19. August fand die feierliche Abnahme einer Parade von über 15000 Mitgliedern der Kriegervereine statt. Vgl. F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945. S. 111.
59 Zum Beispiel erteilte der Mainzer Bischof Kettlerer am 22. August 1874 ein solches Verbot.
60 In Kleve ging es sogar soweit, dass der Bürgermeister bei der Landesregierung anfragte, ob der katholische Pastor mit Polizeigewalt zum Läuten der Glocken gezwungen werden könne. Vgl. U. Schneider, S. 242.
61 Vgl. U. Schneider, S. 242.
62 Kriegervereine, deren Mitglieder mehrheitlich zum politischen Katholizismus gehörten, beschränkten ihren Protest auf die „Nicht-Teilnahme“ an den Kaisergeburtstagsfesten und dem Sedanfest. Vgl. U. Schneider, S. 244.
63 Vgl. U. Schneider, S. 245.
64 Schließlich stellten die Feiern zum Sedantag eine Provokation des Nachbarland Frankreich da. Vgl. U. Schneider, S. 250.
65 Vgl. Harald Müller, Die deutsche Arbeiterklasse und die Sedanfeiern, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 17, 1969, S. 1554-1564.
66 In ihrem internationalen Charakter sah er ein Sprengmittel gegen die Einheit des jungen deutschen Nationalstaates.
67 Mit Hilfe des Sozialistengesetzes wurde den Sozialisten die Grundlage zum Publizieren und zur parteilichen Organisation entzogen. Das Ziel wurde jedoch verfehlt, die Aktionen der Sozialisten verlagerten sich nur in den Untergrund. Durch dieses harte Gesetz erhielten sie die Symphatien der Arbeiterschaft. Das Sozialistengesetz erschwerte jedoch die Integration der Sozialisten und Arbeiter in den Staat und belastete auch nach seiner Aufhebung das politische Leben.
68 Vgl. H. Müller, S. 1557.
69 In Braunschweig fand vom 20. bis 22. Juli 1872 eine Versammlung der Arbeiter statt. Die örtlichen Behörden hatten den in Braunschweig stationierten Soldaten die Teilnahme an den Versammlungen verboten. Trotzdem schickten einige Soldaten einen Brief an die Veranstaltung, der ihre Unterstützung der Arbeiterbewegung ausdrücken sollte. Vgl. H. Müller, S. 1558.
70 Vgl. H. Müller, S. 1558.
71 Der letzte Vorschlag den Umzug direkt zu sabotieren wurde hinterher fallengelassen, da die Gefahr bestand polizeilichen Vergeltungsmaßnahmen zum Opfer zu fallen. Vgl. H. Müller, S. 1558.
72 In Crimmtschau wurde in der Nacht zum 2. September auf dem geschmückten Marktplatz die rote Fahne gehisst, in Chemnitz wurden schwarze Flaggen gehisst und ein Demonstrationszug veranstaltet. Bei Beendigung des Demonstrationszuges wurden Ovationen ausgebracht auf die Helden der Pariser Kommune und inhaftierte Kämpfer der deutschen Arbeiterpartei. Vgl. H. Müller, S. 1559.
73 In der Stadt Hof hatte man die Fabriken und Werkstätten geschlossen um eine stärkere Anteilnahme der Bevölkerung zu erreichen. Die Arbeiter arbeiteten trotzdem und nahmen nicht an den Umzügen teil. Vgl. H. Müller, S. 1560.
74 Die Siegessäule sollte den Sieg über Frankreich repräsentieren. Trotz des Arbeiterstreikes konnte sie pünktlich eingeweiht werden, da Pionierabteilungen der Preußischen Armee die Fertigstellung gewährleisteten. Vgl. H. Müller, S. 1560.
75 Die Sozialisten zeigten ihren Unmut gegen die Sedanveranstaltung indem sie weiter die rote Flagge hissten, zu offenen Protesten kam es erst einmal nicht mehr. Vgl. U. Schneider, S. 258.
76 Ferdinand Lassalle kämpfte für das allgemeine und gleiche Wahlrecht und hoffte den Staat mit friedlichen Mitteln verändern zu können. Einige von Lassalle erarbeiteten theoretischen Grundlagen prägten die praktische Politik der Sozialdemokratie. Lassalle starb nach einem Duelle am 31. August 1864.
77 So nahmen einige sozialdemokratische Veteranen vielleicht wegen den Geldgeschenken an den Feiern teil.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Sedantag und warum ist er wichtig?
Der Sedantag war ein Nationalfeiertag im Deutschen Kaiserreich, der am 2. September gefeiert wurde. Er erinnerte an den Sieg der deutschen Truppen über Frankreich in der Schlacht von Sedan im Jahr 1870 und die Gefangennahme von Napoleon III. Der Sedantag sollte die Einheit des neu gegründeten Kaiserreichs stärken, tat dies aber nicht in allen Fällen. Es führte zu Konflikten.
Wie ist der Sedantag entstanden?
Nach der Schlacht von Sedan gab es spontane Feiern in Deutschland. Religiöse Kreise initiierten dann die Idee eines nationalen Festes. Pastor Friedrich von Bodelschwingh spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Festes.
Wie wurde der Sedantag gefeiert?
Die Feiern umfassten oft Schulveranstaltungen, Gottesdienste mit patriotischen Predigten, Glockengeläut, Spiele, Konzerte und Bälle. Kriegervereine und Festkomitees organisierten die Veranstaltungen, die oft durch Spenden finanziert wurden. Unter Wilhelm II. wurden die Feiern zunehmend militarisiert und Denkmalsstiftungen wurden wichtiger.
Welche Rolle spielte Friedrich von Bodelschwingh beim Sedantag?
Friedrich von Bodelschwingh war ein Pastor, dessen Vorstellungen den Ablauf und die Entstehung des Sedanfestes maßgeblich prägten. Er setzte sich für Friedensfeste mit religiösen Elementen ein, konnte seine Vorstellungen jedoch nicht vollständig durchsetzen.
Welche Probleme gab es mit dem Sedantag?
Der Sedantag hatte keinen integrativen Charakter und spiegelte die innenpolitischen Spannungen im Kaiserreich wider. Katholiken boykottierten die Feiern oft während des Kulturkampfes. Sozialisten lehnten den Militarismus ab und protestierten gegen die Verherrlichung des Krieges.
Wie wirkte sich der Kulturkampf auf den Sedantag aus?
Katholische Bürger und Geistliche standen dem Sedantag skeptisch gegenüber, da sie sich vom Staat als "Reichsfeinde" behandelt fühlten. Dies führte zu Boykotten und Konflikten in katholisch geprägten Regionen.
Wie reagierten die Sozialisten auf den Sedantag?
Sozialisten sahen im Sedantag eine Verherrlichung des Krieges und lehnten den Militarismus ab. Sie organisierten Proteste, Gegenveranstaltungen und riefen zum Boykott der Feiern auf.
Was geschah mit dem Sedantag nach dem Ersten Weltkrieg?
Nach dem Ersten Weltkrieg verlor der Sedantag an Bedeutung und wurde nicht mehr offiziell gefeiert.
Welchen Einfluss hatten Schulfeierlichkeiten auf den Sedantag?
Die Schulen wurden frühzeitig miteinbezogen um die kommende Kriegergeneration auf das Deutsche Kaiserreich einzuschwören. Dies führte zu nationalisierten Kindern. Am Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Schulen aber auch nicht mehr an den Feiern teilgenommen.
Warum gab es Nationaldenkmalsstiftungen während der Sedanfeiern?
Die Denkmalsstiftungen wurden von Kriegervereinen oder Beamten initiiert um die Seriosität des Planes zu stehen. Meistens wurde am Sedantag der Grundstein gelegt.
- Quote paper
- Nadja Dahlhaus (Author), 2001, Der Sedantag in der Regierungszeit Wilhelm I und Wilhelm II., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106030