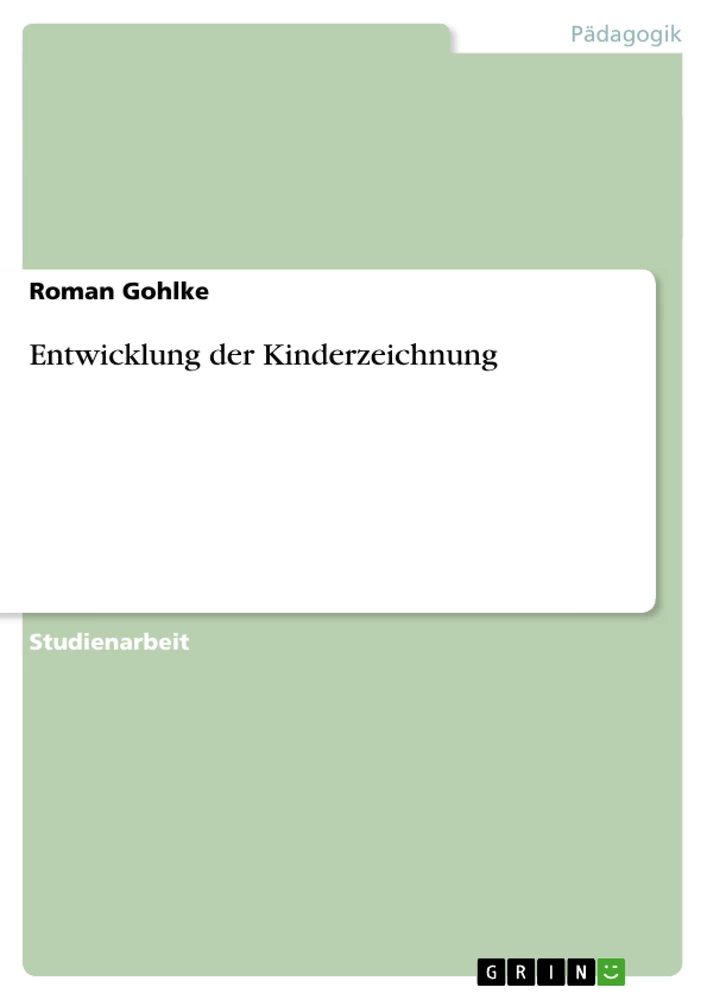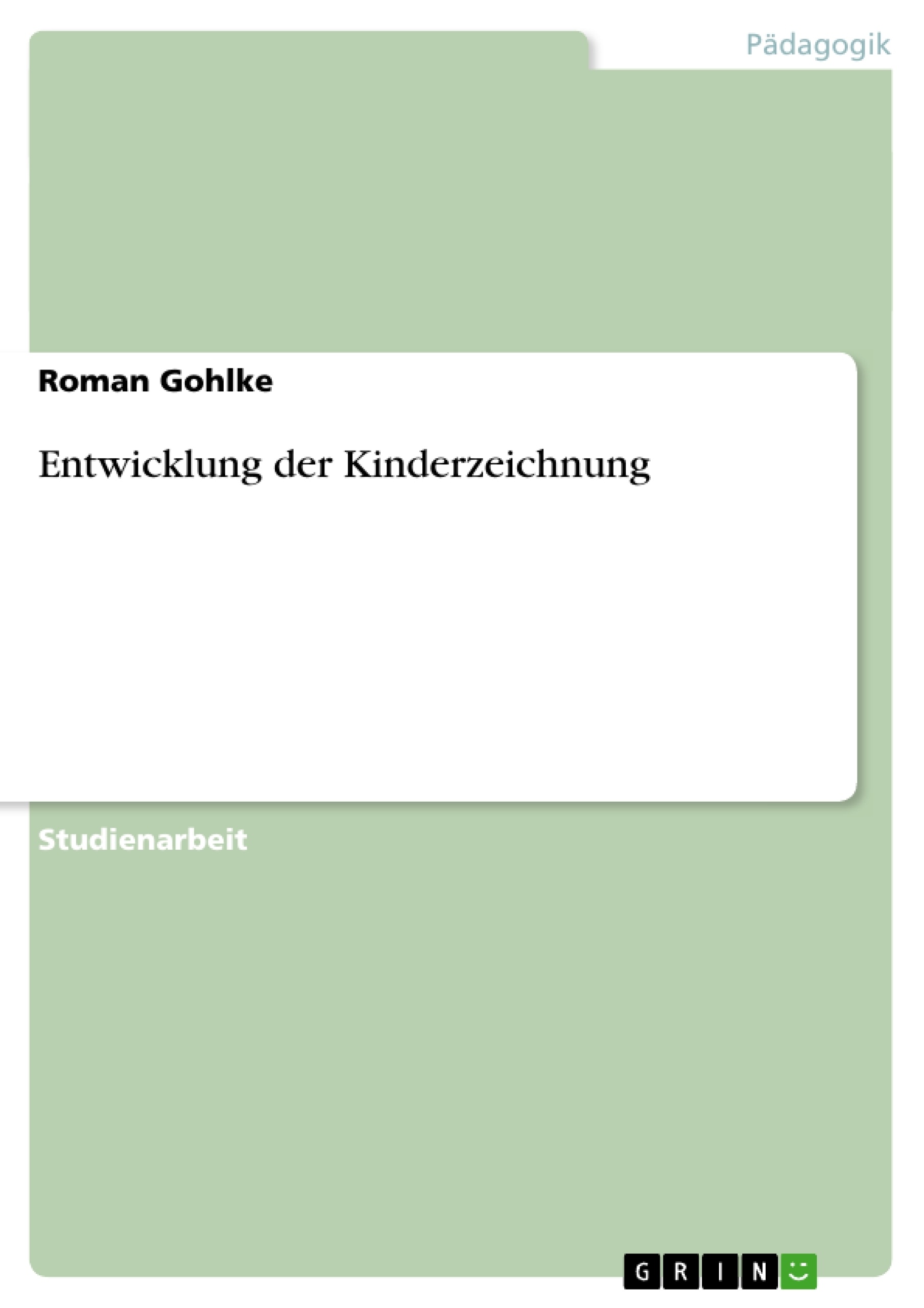Entdecken Sie die faszinierende Welt der Kinderzeichnung, ein Fenster zur kindlichen Seele und kognitiven Entwicklung. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die verschiedenen Phasen der künstlerischen Entfaltung, von den ersten unkontrollierten Kritzeleien bis hin zu komplexen, ausdrucksstarken Bildern. Anhand fundierter entwicklungspsychologischer Erkenntnisse und anschaulicher Beispiele werden die charakteristischen Merkmale jeder Phase detailliert beleuchtet: die Kritzelphase mit ihren Schmierobjektivationen und Gestenkritzeln, die Vorschemaphase, in der sich die ersten Bildkonzepte herausbilden, und die Schemaphase, in der Kinder lernen, ihre Umwelt systematisch darzustellen. Besonderes Augenmerk gilt den formalen Charakteristika wie Richtungsdifferenzierungen, Röntgenbildern und der Bedeutungsperspektive, die Aufschluss über das kindliche Denken geben. Erfahren Sie, wie sich die Individualisierung des Bildkonzepts, die Ausdruckssteigerung und die Verdeutlichung des Mitteilungsgehalts im Laufe der Entwicklung manifestieren. Das Buch bietet wertvolle Einblicke für Eltern, Pädagogen und alle, die sich für die kreative Entwicklung von Kindern interessieren. Es zeigt, wie Kinderzeichnungen interpretiert werden können, um ihre individuellen Erfahrungen, Emotionen und kognitiven Fähigkeiten besser zu verstehen. Tauchen Sie ein in die verborgene Sprache der Linien, Formen und Farben und entdecken Sie die erstaunliche Kreativität, die in jeder Kinderzeichnung steckt. Lassen Sie sich von der unvoreingenommenen Perspektive der Kinder inspirieren und erfahren Sie, wie ihre Kunst uns neue Wege des Sehens und Verstehens eröffnen kann. Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die die Entwicklung und Interpretation von Kinderzeichnungen besser verstehen möchten, und bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anleitungen zur Förderung der kindlichen Kreativität. Es beleuchtet die Entwicklung von Kritzeln über Schemata bis hin zur Individualisierung und Ausdruckssteigerung, wodurch es für Erzieher, Eltern und Kunsttherapeuten gleichermaßen relevant ist. Die detaillierte Analyse der formalen Charakteristika und der späten Schemaphase ermöglicht ein tiefes Verständnis der kindlichen Bildsprache und ihrer Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis:
Die Entwicklung der Kinderzeichnung
1. Die Kritzelphase
1.1 Schmierobjektivationen und Spurflecken
1.2 Spurkritzel
1.3 Gestenkritzel
1.4 Konzeptkritzel
2. Die Vorschemaphase
2.1 Respektierung der Flächenkoordinaten
2.2 Binnendifferenzierung
2.3 Ausweitung des Repertoires an Motiven
2.4 Handlungs- und Erzählstruktur des Bildes
3. Zeichnen nach der „Werkreife“
3.1 Individualisierung des Bildkonzepts
3.2 Ausdruckssteigerung des Bildes
3.3 Verdeutlichung des Mitteilungsgehaltes
4. Die formalen Charakteristika der Schemaphase
4.1 Richtungsdifferenzierungen
4.2 Röntgenbild/Transparenz
4.3 Bedeutungsgröße/Bedeutungsperspektive
4.4 Exemplarisches Detail
4.5 Prägnanztendenz
5. Die späte Schemaphase
5.1 Zunahme an gegenstandsanalogen Details
5.2 Umstrukturierung des Bildschemas
5.3 Veränderung der Motivstruktur
5.4 Momente von Karikatur und Ironisierung
1. Die Kritzelphase
Die Kritzelphase beginnt eigentlich mit dem zweiten Lebensjahr, sie wird aber zurückgeführt auf ein pränatales „rotierendes Raumgefühl“(Grötzinger1952 nach Richter 1997,20). „Mit dieser Bezeichnung wollte er deutlich machen, dass sich in diesen Gebilden Erfahrungsweisen/Erlebnisspuren niederschlagen, die in die vorgeburtliche Existenz des Kindes, den Geburtsvorgang und die ersten extrauterinen Bewegungserfahrungen zurückreichen. Das Kind befreit sich nach seiner Auffassung im zweiten Lebensjahr in den ersten zeichnerischen Aktivitäten, die er „Urknäuel“ und „Urkreuz“ genannt hat, von diesen frühen (Raum- )Erlebnissen. Im dritten Lebensjahr treten zu den beiden genannten Figurationen noch eine (Ur-)“Zickzackstrecke“ und ein (Ur-)2Kasten“, d.h. ein Liniengebilde, das eine Art Viereck bildet, hinzu.“(Richter 1997,20)
Die sichtbaren Ereignisse der Kritzelphase lassen sich in vier Gruppen aufteilen, die sukkzesive auftreten, aber in der Genese der Entwicklung auch nebeneinander bzw. in Beziehung zueinander existieren können.
1.1 Die Schmierobjektivationen und Spurflecken :
Ab dem fünften Lebensmonat, „wenn die Reifung der Motorik, ...die von den zentralen zu den peripheren Körperabschnitten verläuft, eine koordinierte Schmierbewegung/Spurbewegung- gespreizte Hand, Bewegung aus dem ganzen Arm heraus - zulässt“(vgl. Mussen 1976 nach Richter 1997,34); entstehen als Ergebnis frühester Aktivitäten Schmier- oder Spurflecken, aus einer Art Bewegungsfreude und Funktionsfreude (vgl. Bühler nach Richter 1997, 34)heraus, aber auch aus Befriedigung über die Dauerhaftigkeit des Produkts ( tiefenpsychologisch an die libidinöse Erfahrung der analen Phase gebunden)(nach Richter 1997,34). Es liegen allerdings keine Zeugnisse aus dieser frühesten Phase vor.
1.2 Spurkritzel ist eine Art des Spurschmierens ab dem achten/neunten
Lebensmonat, wenn die Fähigkeit des Greifens so ausgebildet ist, daß motorische Abläufe mit einem Spurgebenden Gegenstand koordiniert werden können. Motivation erfahren die ungesteuerten (aber mit zunehmender Augen- Hand Kontrolle) motorischen Bewegungen durch die selben beim Spurschmieren und durch die Befriedigung über den Gebrauch des Werkzeugs.(nach Richter 1997,34)
1.3 Gestenkritzel:
Gestenkritzel sind die Ereignisse, „in denen sich der Umschlag von den ungesteuerten, „zufälligen Bewegungsabdrücken (mittels eines Stiftes) zu einem Gestus, d. h. zu einem Gebärdensystem, abzeichnet. Dieses Gebärdensystem manifestiert sich in der Abfolge: “ verschieden geformte Kritzel, isolierte Kreiskritzel, „Kopffüßler“. (Richter 1997,34) Nun ist das Kind in der Lage motorische Bewegungen abzusetzen, neu anzusetzen, Verbindungen zuschaffen und zum Anfangspunkt einer Rundung zurückzukehren. Es kann somit ein Bewegungskonzept verwirklichen. Das Gestenkritzeln ist ohne ein repräsentationales Schema(Piaget) auf der Ebene der
Wahrnehmungsverarbeitung/Vorstellungsbildung, das die Wiederholung der Aktionen zulässt, nicht denkbar. „In diese Phase der Kritzelereignisse(mit ca. 18 Monaten) fällt ja auch nach der Auffassung Piagets der Übergang von den rein sensomotorischen zu den operatorischen(begrifflich-kognitiven) und den figurativen(bildhaften9 Handlungskonzepten, die von Vorstellungen begleitet werden.“(vgl. Piaget1969 nach Richter 1997,35) In einzelnen Gesten findet man auch verschiedenartige Emotionen wieder.
1.4 Das Konzeptkritzeln(im dritten Lebensjahr) ist die Grenze zur Vorschemaphase im vierten Lebensjahr, in der das Bild festen Bestand erhält. Die dargestellten In halte sind, neben noch zu findenden Kritzeleien, Kopffüßler, Kasten-( Haus- ) formen und Leiter- (Baum-)Formen. Die Bezeichnung Konzeptkritzel soll verdeutlichen, dass die Vorstellungen des Kindes zwar schon gefestigt sind aber die Umsetzung auf zeichnerische Darstellungen noch nicht recht realisierbar ist. „Die Realisationsfähigkeiten entsprechen in diesem Alter wohl am wenigsten(internen)Repräsentationsmöglichkeiten.“(Richter 1997,35)
Darstellungsweisen auf sprachlicher Ebene in diesem Alter unterstreichen diese These. „Der „vorgreifende Entwurf“ (Piaget/Inhelder) in der Vorstellung des Kindes eilt in diesem letzten Stadium des Kritzelns der zeichnerischen Realisation noch voraus, um dann in der Vorschemaphase in einem Bildkonzept(vgl. Lowenfeld/Brittain 1967:“Form-concept“) berücksichtigt werden, das nach eigenen, bildnerischen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut ist.“(Richter 1997,35)
2. Die Vorschemaphase:
„Gegen Ende des vierten Lebensjahres lernt das Kind, die vorhandenen Figurationen auf der vorgegebenen Zeichenfläche so zu organisieren, dass man von der „Geburt des Bildes“(Pfleiderer 1930) sprechen kann.“(Richter 1997,43) Eine Schematisierung nimmt zu, das Bild verliert seine individuellen Anteile, aber Mühle sagt: „Die Schematisierung ist von Zeit zu Zeit notwendig, weil sie den Formenbestand verfestigt und dem „motorischen“ wie dem „visuellen“ Gedächtnis einverleibt.“(Mühle 1955,57) Die Entwicklung zu stabilisierten Darstellungsformen lässt sich an vier Merkmalen charakterisieren:
2.1 Respektierung der Flächenkoordinaten:
Das Kind zieht anfangs noch die freien Stellen des Papiers durch Drehen zu sich hin(noch Merkmal für die Kritzelphase). „aus diesen disjunktiven Lokalisationen ... entwickelt sich ... eine stabile, gerichtete und relationale
Flächenorganisation.“(Richter 1997,43) Das Kind lernt die Ausrichtung oben/unten und Links/rechts und ordnet die Motivelemente auf einer eingezogenen Standlinie/Standfläche, dies ist der „entscheidende Wechsel in der Organisation des Bildes“(Richter 1997,43).
2.2 Binnendifferenzierung:
Die einzelnen graphischen Elemente werden mit zunehmender Organisation immer differenzierter. „Die jeweiligen Bildzeichen erhalten immer mehr Merkmale, die eine (slektive9 Analogie zischen Objekt (bzw. dessen innerer
Repräsentanz) und Bildzeichen sichern. Damit wird das spezielle Verhältnis von „Mitgemeinten“ und mitgegebenen Inhalten, ... , abgelöst von einer realen Ähnlichkeitsbeziehung zwischen zeichnerischer Repräsentation und dargestelltem Objektzusammenhang. (Richter 1997,42)
2.3 Ausweitung des Repertoires an Motiven.
Das Repertoire an dargestellten Motiven wird immer größer hin zu allen Motiven der typischen Kinderzeichnung: Menschen, Häuser, Bäume, Wolken, Tiere(bes. Vögel, Hunde, Katzen), Autos, Schiffe, Flugzeuge u.v.m. „Einige Elemente dieses Repertoires sind situationsgebunden, kulturabhängig und Traditionen unterworfen. Die Auswahl der Motive hängt wohl ... auch von ihrer (optischen) „Prägnanz“, d.h. ihrer Nähe zu „guten“(leicht zu reproduzierenden) Gestalten, ab.“(Richter 1997,44)
2.4 Handlungs- und Erzählstruktur des Bildes:
Die dargestellten Gegenstände(Motive) werden in einer (anfangs relativ lockeren) Beziehung zueinander gesetzt, und es werden Handlungs- und Erzählmuster aufgebaut, die zuerst noch additiv (parataktisch) organisiert sind, später aus einem komplexen netz von syntaktischen(formalen) und semantischen(inhaltlichen9 Beziehungen bestehen. (nach Richter 1997,44) So kristallisieren sich zwei Tendenzen heraus: die partielle Differenzierung der Einzelfigur (Binnendifferenzierung/ Ausweitung des Repertoires)
Und die Synthese des Bildzusammenhangs
(Flächenkoordination/Handlungs- und Erzählstruktur) Der Vorgang der
Schematisierung dient der Flüssigkeit von Darstellung und Erzählung, die Auflockerung/Aufhebung des Schemas dagegen der Umstrukturierung und Weiterentwicklung. ( nach Mühle 1955,28ff.)
3. Zeichnen nach der „Werkreife“ :
Der Begriff „Werkreife“ (Bühler 1967 nach Richter 1997,45) bezeichnet die Formen der Kinderzeichnung, ab dem fünften Lebensjahr, die sich dadurch auszeichnen, „dass die grundlegenden (graphischen) Merkmale der Personen und Gegenstände erarbeitet sind und die Entwicklung von Motiven zu einem (vorläufigen) Abschluss gekommen ist.“(Richter 1997,45) Die Zeichnungen werden zwar noch detailreicher, aber es treten keine grundsätzlich neuen Ereignisse auf. In der Entwicklung des Zeichnens in der Schemaphase ist die Werkreife Der Beginn von Ausdrucks- und Darstellungstendenzen, die sich im weiteren Verlauf der Entwicklung fortsetzen:
3.1 Individualisierung des Bildkonzepts:
In der zeit um den Schuleintritt gewinnt die Kinderzeichnung an individueller Unverwechselbarkeit. „Mit dem wachsenden Reichtum an Erfahrung und den Möglichkeiten, diese Erfahrungen intellektuell zu sichern, entwickeln sich jetzt auch besondere Formvarianten und Bildkonzepte, welche als Ergebnisse individueller Erarbeitung zu erkennen sind.“(Richter 1997,46)
3.2 Ausdruckssteigerung des Bildes ist die unmittelbare folge der
Individualisierung des Zeichengeschehens. „Das Kind entdeckt zunehmend die Möglichkeit der Darstellungsmittel, den Gegenstand (graphisch) prägnanter zu „bezeichnen“ und in dieser Bezeichn und emotionale (motivationale) Wertungen vorzunehmen. Es verändert also den gezeichneten Gegenstand (Motiv) und die Organisationsstruktur des Bildes, um gefühlsartige Befindlichkeiten auszudrücken.“(Richter 1997,46)
3.3 Verdeutlichung des Mitteilungsgehalts:
Das Kind reagiert nach der Werkreife zunehmend auf die Verständnisbereitschaft und Verstehensabsicht des Betrachters mit einer
Wiederholung/Verdeutlichung der Darstellungsformen. Es gibt damit eine Mitteilungsabsicht kund, die sogar zu einer Umorganisation der Motive führen kann, wenn es sich nicht verstanden fühlt. Es versteht sich als zeichnender als Kommunikationspartner, der einem Betrachter etwas mitteilen möchte und findet den Mitteilungsgehalt von einem schwankendem zu einem verständlichen. (nach Richter 1997,48)
4. Die formalen Charakteristika der Schemaphase
Im Folgenden werden die typischen Merkmale des Bildschemas in dieser Phase der Kinderzeichnung (ca. sechstes bis achtes Lebensjahr) dargestellt:
4.1 Richtungsdifferenzierungen:
In den frühen schematischen Darstellungen herrscht das Prinzip der Rechtwinkligkeit (oder Prinzip der größtmöglichen
Richtungsunterscheidung) vor, das heißt die einzelnen
Bildelemente(„Molekularzeichen“) werden möglichst rechtwinklig zueinander gesetzt(vgl. Mühle 1955,90ff.). „In der Schemaphase verliert sich diese besondere Darstellungsweise zugunsten einer relationalen Wiedergabe; d.h. die Bildelemente werden so zueinander in Beziehung gesetzt, wie es die Darstellungsintentionen und der Mitteilungsgehalt (Ähnlichkeitsbeziehungen!) erfordern und wie es die Gesamtstruktur des Bildes zulässt. (Richter 1997,52)
4.2 Röntgenbild/Transparenz:
Das Röntgenbild kann als besonderes Merkmal des Stils der Zeichnung angesehen werden. „In ihm vereinigen sich optisch erkennbare und vorhandene, aber aktuell nicht sichtbare Gegenstandsformen zu einem „Gesichtspukt2. Das Röntgenbild diente vielen Theoretikern als Beleg für die These, dass das zeichnende Kind mehr vom Wissen um die Dinge als von derer visueller Erscheinung ausgehe (so vor allem Luquet 1927; vgl. Kapitel XVIII, Abschnitt1).“(Richter1997,53)
4.3 Bedeutungsgröße/Bedeutungsperspektive:
„ Innerhalb der Topologie der Bildfläche, d.h. des Gefüges von horizontalen und vertikalen Formen fallen immer wieder Gegenstandsformen auf, die durch ihre Größe von anderen Formgruppen zu unterscheiden sind. Dieses Merkmal übernimmt das Kind aus den vorangegangenen Phasen, wo die Größe des Motivs etwas Relatives, Zufälliges war, weil die optische Kontrolle nicht genügend ausgeprägt war. Im Bild der Schemaphase dagegen soll dieses Motivelement hervorgehoben werden, weil es dem Zeichner besonders bedeutungsvoll erscheint.“ (nach Richter 1997,53f)
4.4 Exemplarisches Detail:
Dieses Merkmal ist eng mit dem vorhergehenden verwandt. „Zur Charakterisierung einer Person bzw. eines Gegenstandes benutzt der Zeichner ein besonders hervorgehobenes Detail, z.B. eine pfeife für „Mann“ (bei sonst gleichartiger Kleidung) oder lange Zöpfe für Mädchen Usw. (vgl. auch Widlöcher 1974 nach Richter 1997,54)
4.5 Prägnanztendenz:
Die Bezeichnung Prägnanztendenz stammt aus der Gestalttheorie und bezeichnet die Zunahme an gestalterischen Qualitäten bei optischen Konfigurationen; hier wird diese Bezeichnung nur Optisch-autonom in Anspruch genommen; um auffallende Erscheinungen des Schemabildes zu bezeichnen, die unter dem Begriff „Umklappung“ zusammengefasst werden.(z.B. Autos häufig als Kasten und Räder angesetzt als Kreisformen). (nach Richter 1997,54)
5. Die späte Schemaphase:
In der späten Schemaphase, auch „zweite Schemaphase“(Richter1997, 63) genannt (ca. im neunten Lebensjahr), ist mit einer Veränderung im zeichnerischen Verhalten zu rechnen. Die zweite Schemaphase geht ca. bis zum zwölften Lebensjahr, wie nach den angaben der genetischen Psychologie Piagets (nach Richter 1997,62). Hier sollen nun die Entwicklungstendenzen und besondere Merkmale der späten Schemaphase aufgezeigt werden:
5.1 Zunahme an gegenstandsanalogen Details:
In dieser Phase findet eine besondere Binnendifferenzierung des Menschzeichnens statt, die sich in Richtung einer gegenstandsanalogen Darstellung bewegt. Die Detailfreude erstreckt sich auch auf alle anderen Motive und die so genannte freie Zeichnung. (nach Richter 1997,63)
5.2 Umstrukturierung des Bildschemas:
Die Entwicklung des Bildschemas läuft in zwei Richtungen: „Einmal stehen differenzierte Bildzeichen innerhalb eines weniger komplexen Bildschemas; zum anderen wird der Versuch des Kindes Deutlich, das gesamte Bild gegenstandsanalog-visuell zu organisieren. Im ersten Fall könnte man von einerselektiven Bildkonzeption, im zweiten von einer ökologischen. Das Prinzip der größtmöglichen Deutlichkeit verlangt nur die Differenzierung eines bestimmten Motivzusammenhangs, der im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Andererseits machen sich in diesem Alter bestimmte Persönlichkeitsmerkmale des Kindes deutlicher bemerkbar als in vorangegangenen Phasen. (nach Richter 1997,64f)
5.3 Veränderung in der Motivstruktur:
Die neue sozio-emotionale Situation des Zeichnenden am Ende der Kindheit bringt einen Wechsel der Motive mit sich; z.B. Weltraumphantasien, Autoträume, Comicdarstellungen, Werbemotive und auch politische und kulturspezifische Inhalte. (nach Richter 1997,66f)
5.4 Momente von Karikatur und Ironisierung:
Die Kinderzeichnung zeigt eine Tendenz zur Übertreibung, Karikirung, Ironisierung, die mit einer Vergröberung des Einzelzeichens einhergeht. Dies setzt eine gewisse gute Beherrschung der Darstellungsmittel voraus. Die Tendenz zur Übertreibung lässt sich auch mit Angst vorunrealistischer Wiedergabe und Unsicherheit über eigene Fähigkeiten erklären. Die Abkehr von der Visualisierung des Bildschemas kann bis zum Einfügen von Sprachelementen gehen.
Ohne einen Ausblick auf die Jugendzeichnung wäre die Entwicklung der Kinderzeichnung unvollständig. Richter (1997,71)sagt:“...die Jugendzeichnung ist... kein Anhängsel der Kinderzeichnung, sondern etwas qualitativ Andersartiges. Mühle sagt hierzu (1955,18): „Während die bildnerische Intention des Jugendlichen in der Vorpubertät noch ganz auf das Abbilden im Sinne einer erscheinungstreuen Wiedergabe des 2Gegenstandes“ zielt, tritt mit fortschreitender Pubertät immer deutlicher eine völlig neue Form des Bezugs zum bildnerischen schaffen in den Vordergrund: der (bewusste oder noch öfter unbewusste ) Versuch, in dem nachgestalteten Gegenstand sich selbst zum Ausdruck zu bringen“
Literaturverzeichnis:
Richter, Hans-Günther: Die Kinderzeichnung Entwicklung Interpretation Ästhetik; Cornelsen Verlag 1997
Richter, Hans-Günther: Der Begriff der Entwicklung und das bildnerische Gestalten des Kindes in Zeitschrift für Kunstpädagogik 1972, Heft1
Mühle, Günther: Entwicklungspsychologie des zeichnerischen Gestaltens; Johann Ambrosius Barth Verlag 1955
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der "Entwicklung der Kinderzeichnung"?
Das Hauptthema ist die Entwicklung der Kinderzeichnung von der Kritzelphase bis zur späten Schemaphase, einschließlich der formalen Charakteristika und Veränderungen, die im Laufe der Zeit auftreten.
Welche Phasen der Kinderzeichnung werden in dem Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Kritzelphase, die Vorschemaphase, die Phase nach der "Werkreife" und die späte Schemaphase.
Was sind die Unterteilungen der Kritzelphase?
Die Kritzelphase ist unterteilt in Schmierobjektivationen und Spurflecken, Spurkritzel, Gestenkritzel und Konzeptkritzel.
Welche Merkmale charakterisieren die Vorschemaphase?
Die Vorschemaphase wird durch die Respektierung der Flächenkoordinaten, Binnendifferenzierung, Ausweitung des Repertoires an Motiven sowie Handlungs- und Erzählstruktur des Bildes charakterisiert.
Was versteht man unter "Werkreife" in Bezug auf Kinderzeichnungen?
"Werkreife" bezeichnet den Zeitpunkt ab dem fünften Lebensjahr, an dem die grundlegenden graphischen Merkmale von Personen und Gegenständen erarbeitet sind und die Entwicklung von Motiven zu einem vorläufigen Abschluss gekommen ist.
Welche formalen Charakteristika kennzeichnen die Schemaphase?
Die formalen Charakteristika der Schemaphase umfassen Richtungsdifferenzierungen, Röntgenbild/Transparenz, Bedeutungsgröße/Bedeutungsperspektive, exemplarisches Detail und Prägnanztendenz.
Was sind die Entwicklungstendenzen in der späten Schemaphase?
In der späten Schemaphase gibt es eine Zunahme an gegenstandsanalogen Details, eine Umstrukturierung des Bildschemas sowie eine Veränderung der Motivstruktur mit Momenten von Karikatur und Ironisierung.
Was ist das Röntgenbild in der Kinderzeichnung?
Das Röntgenbild ist ein Stilmerkmal, bei dem optisch erkennbare und vorhandene, aber aktuell nicht sichtbare Gegenstandsformen zu einem Gesamtbild vereinigt werden.
Was bedeutet Bedeutungsgröße/Bedeutungsperspektive in Kinderzeichnungen?
Bedeutungsgröße/Bedeutungsperspektive bezieht sich darauf, dass bestimmte Gegenstandsformen durch ihre Größe von anderen unterschieden werden, um ihre Bedeutung für den Zeichner hervorzuheben.
Was ist das exemplarische Detail in einer Kinderzeichnung?
Das exemplarische Detail ist ein besonders hervorgehobenes Detail, das zur Charakterisierung einer Person oder eines Gegenstandes verwendet wird.
Was ist die Prägnanztendenz in Bezug auf Kinderzeichnungen?
Die Prägnanztendenz bezieht sich auf die Zunahme an gestalterischen Qualitäten bei optischen Konfigurationen im Schemabild, oft in Form von Vereinfachungen oder "Umklappungen".
Welche Literatur wird in dem Dokument zitiert?
Das Dokument zitiert Hans-Günther Richter, Günther Mühle und Jean Piaget.
Was ist die Bedeutung der Flächenkoordination in der Vorschemaphase?
Die Flächenkoordination bezieht sich auf die Entwicklung von einer disjunktiven Lokalisation der Motive auf dem Papier zu einer stabilen, gerichteten und relationalen Flächenorganisation, wobei das Kind lernt, die Ausrichtung oben/unten und Links/rechts zu respektieren.
Was ist das Konzeptkritzeln?
Das Konzeptkritzeln ist ein Stadium in der Kritzelphase im dritten Lebensjahr, in dem die Vorstellungen des Kindes schon gefestigt sind, aber die Umsetzung auf zeichnerische Darstellungen noch nicht recht realisierbar ist.
- Citation du texte
- Roman Gohlke (Auteur), 2002, Entwicklung der Kinderzeichnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106006