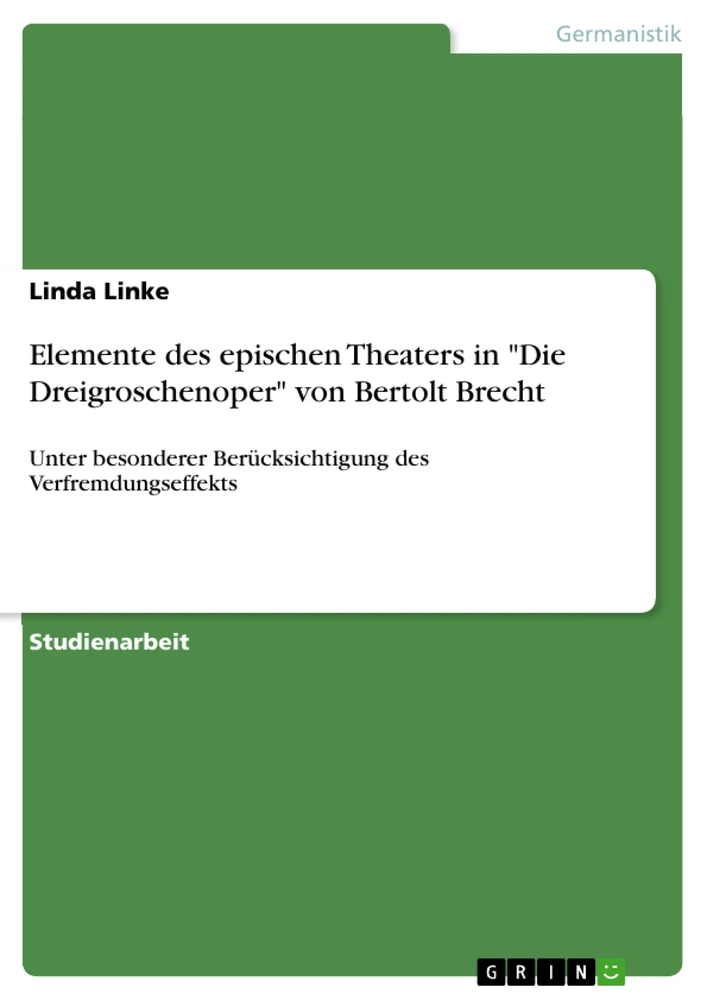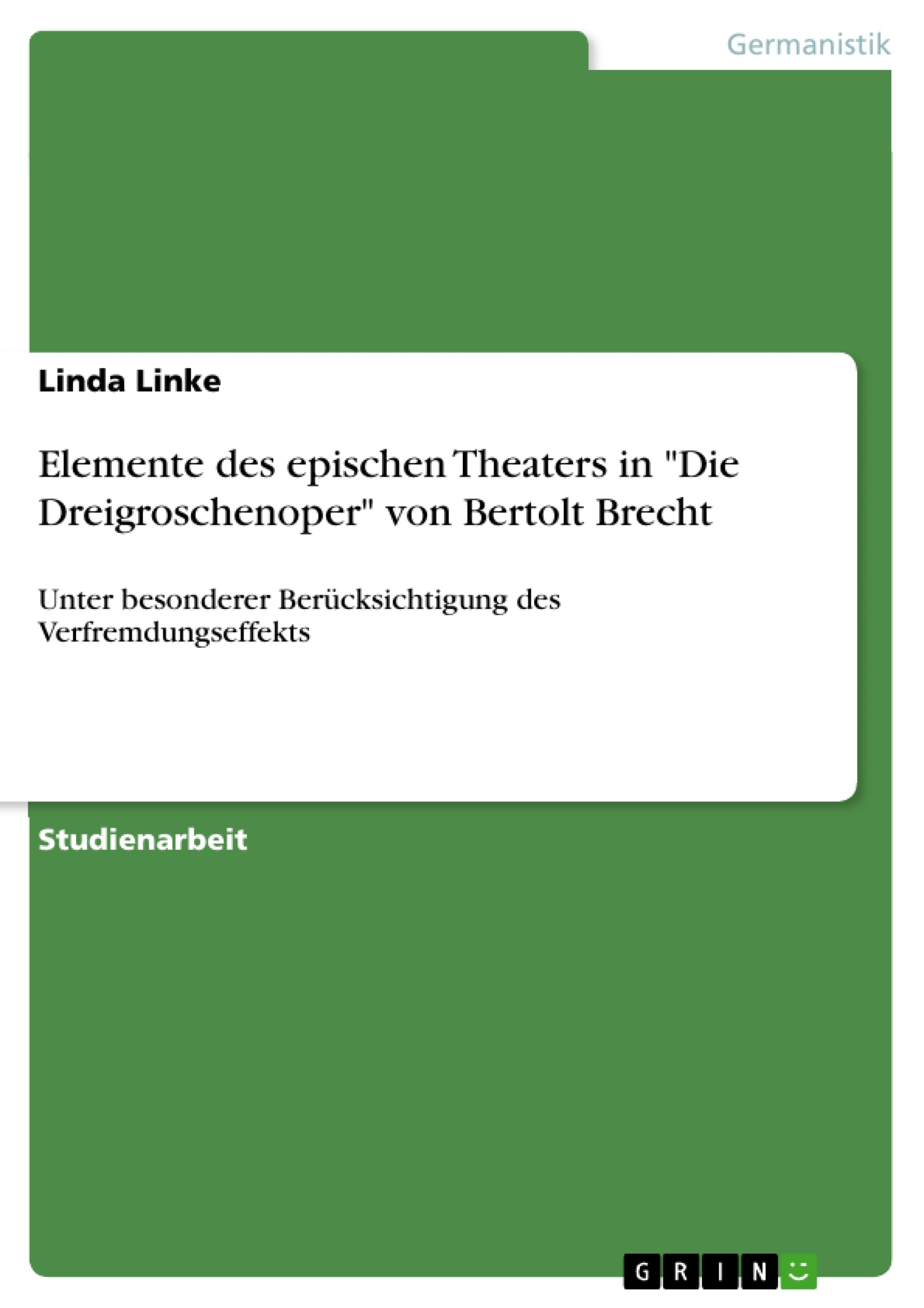Meine Ausarbeitung beschäftigt sich mit folgender Frage: Welche Elemente des epischen Theaters und Mittel der Verfremdung sind in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht realisiert? Für die Beantwortung dieser Frage wähle ich eine produktionsästhetische Betrachtungsweise des Dramas. Die Untersuchung der Textstrategie soll den Blick auf die besondere Weise der Mitteilung des Gegenstands, also des durch den Autor gezeigten Ausschnitts der Wirklichkeit, richten. Das autorbezogene Vorgehen bedeutet für meine Recherche und Beantwortung der Frage die intensive Auseinandersetzung mit Brechts theoretischen Schriften, um auf diese Weise die Absicht hinter seinen epischen Stil zu verstehen und auf die Dreigroschenoper anzuwenden.
Bertolt Brecht weckte mit seinem Drama "Die Dreigroschenoper" eine Faszination, welche bis heute anhält und schuf einen bedeutenden Gegenstand für die literaturwissenschaftliche Forschung. Die Besonderheit dieser Einschätzung besteht darin, dass die Formulierung seiner Theatertheorie und die schriftliche Auseinandersetzung mit der epischen Form des Theaters lange Zeit nach der Uraufführung erfolgte. Dies zeigt einmal mehr die Bedeutung der Dreigroschenoper für seine theoretischen Schriften – nicht umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bertolt Brechts Theatertheorie
- 2.1 Das epische Theater und ausgewählte Akzentverschiebungen
- 2.2 Der Verfremdungseffekt
- 3 Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht
- 3.1 Epische Elemente im Werk
- 3.2 Besonderheiten der epischen Inszenierung auf der Bühne
- 3.3 Beitrag der Schauspieler
- 4 Auftretende Verfremdungseffekte
- 4.1 Die Musik
- 4.2 Die Bibel in der Dreigroschenoper
- 4.3 Die Schlussszene
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Elemente des epischen Theaters und die Mittel der Verfremdung in Bertolt Brechts "Dreigroschenoper". Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Elemente des epischen Theaters und Mittel der Verfremdung sind in der Dreigroschenoper realisiert? Die Analyse erfolgt aus einer produktionsästhetischen Perspektive, wobei Brechts theoretische Schriften herangezogen werden, um seine Intentionen zu verstehen.
- Brechts epische Theatertheorie und ihre Abkehr vom traditionellen Drama
- Der Verfremdungseffekt als zentrales Element des epischen Theaters
- Analyse epischer Elemente in der "Dreigroschenoper"
- Die Rolle der Musik, der Bibel und der Schlussszene als Mittel der Verfremdung
- Die besondere Interaktion zwischen Bühne und Publikum im epischen Theater
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt die zentrale Forschungsfrage: Welche Elemente des epischen Theaters und Mittel der Verfremdung sind in Brechts "Dreigroschenoper" realisiert? Sie begründet die Wahl einer produktionsästhetischen Betrachtungsweise und hebt die Bedeutung der "Dreigroschenoper" für Brechts Theatertheorie hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf eine exemplarische Auswahl von Beispielen, um das breite Spektrum der brechtschen Techniken sichtbar zu machen. Die methodische Vorgehensweise, die intensive Auseinandersetzung mit Brechts theoretischen Schriften, wird ebenfalls dargelegt.
2 Bertolt Brechts Theatertheorie: Dieses Kapitel beleuchtet Brechts umfassende Theatertheorie, die in zahlreichen Schriften zum Ausdruck kommt. Es beschreibt Brechts Kritik am traditionellen Theater, welches er als unfähig betrachtet, gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen. Brecht plädiert für ein episches Theater, das aktuelle Stoffe behandelt, erzählend und berichtend ist und die Einfühlung des Zuschauers vermeidet. Das Kapitel erwähnt auch den Einfluss von Piscators Experimenten und die spätere Entwicklung des dialektischen Theaters bei Brecht, das die Widersprüchlichkeit der Welt hervorhebt.
2.1 Das epische Theater und ausgewählte Akzentverschiebungen: Dieses Kapitel vergleicht das epische Theater mit der aristotelischen Dramenform und beschreibt die Akzentverschiebungen, die Brecht vornimmt. Erzählende Elemente, ein nicht-linearer Handlungsverlauf und die veränderte Rolle des Zuschauers, der aktiv und kritisch an der Handlung teilhaben soll, werden hervorgehoben. Die veränderte Funktion des Schauspielers und die Verwendung der Umwelt als selbstständiges Element werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Episches Theater, Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper, Verfremdungseffekt, Produktionsästhetik, Theatertheorie, Akzentverschiebung, Zuschauerrolle, Dramaturgie.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Brechts "Dreigroschenoper"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Elemente des epischen Theaters und die Mittel der Verfremdung in Bertolt Brechts "Dreigroschenoper". Der Fokus liegt auf der Frage, welche Elemente des epischen Theaters und der Verfremdung in diesem Werk realisiert werden. Die Analyse betrachtet die "Dreigroschenoper" aus einer produktionsästhetischen Perspektive und bezieht Brechts theoretische Schriften zur Kontextualisierung mit ein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Brechts epische Theatertheorie und ihre Abkehr vom traditionellen Drama, den Verfremdungseffekt als zentrales Element, die Analyse epischer Elemente in der "Dreigroschenoper", die Rolle der Musik, der Bibel und der Schlussszene als Mittel der Verfremdung, sowie die besondere Interaktion zwischen Bühne und Publikum im epischen Theater.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Brechts Theatertheorie (inkl. Unterkapitel zum epischen Theater und ausgewählten Akzentverschiebungen), ein Kapitel zur "Dreigroschenoper" (mit Unterkapiteln zu epischen Elementen, Inszenierung und der Rolle der Schauspieler), ein Kapitel zu auftretenden Verfremdungseffekten (Musik, Bibel, Schlussszene) und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Wie wird die Arbeit methodisch angegangen?
Die Arbeit verfolgt einen produktionsästhetischen Ansatz. Brechts theoretische Schriften dienen als Grundlage zum Verständnis seiner Intentionen. Die Analyse konzentriert sich auf eine exemplarische Auswahl von Beispielen aus der "Dreigroschenoper", um die brechtschen Techniken zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt der Verfremdungseffekt?
Der Verfremdungseffekt ist ein zentrales Element der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie dieser Effekt durch verschiedene Mittel wie Musik, die Einbeziehung der Bibel und die Gestaltung der Schlussszene in der "Dreigroschenoper" realisiert wird.
Wie wird das epische Theater im Vergleich zum traditionellen Drama dargestellt?
Die Arbeit vergleicht das epische Theater mit der aristotelischen Dramenform und hebt die Unterschiede in Bezug auf Erzählstruktur, Handlungsverlauf, Zuschauerrolle und die Funktion des Schauspielers hervor. Brechts Kritik am traditionellen Theater und seine Intentionen mit dem epischen Theater werden erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Episches Theater, Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper, Verfremdungseffekt, Produktionsästhetik, Theatertheorie, Akzentverschiebung, Zuschauerrolle, Dramaturgie.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Elemente des epischen Theaters und Mittel der Verfremdung sind in Brechts "Dreigroschenoper" realisiert?
- Quote paper
- Linda Linke (Author), 2021, Elemente des epischen Theaters in "Die Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060069