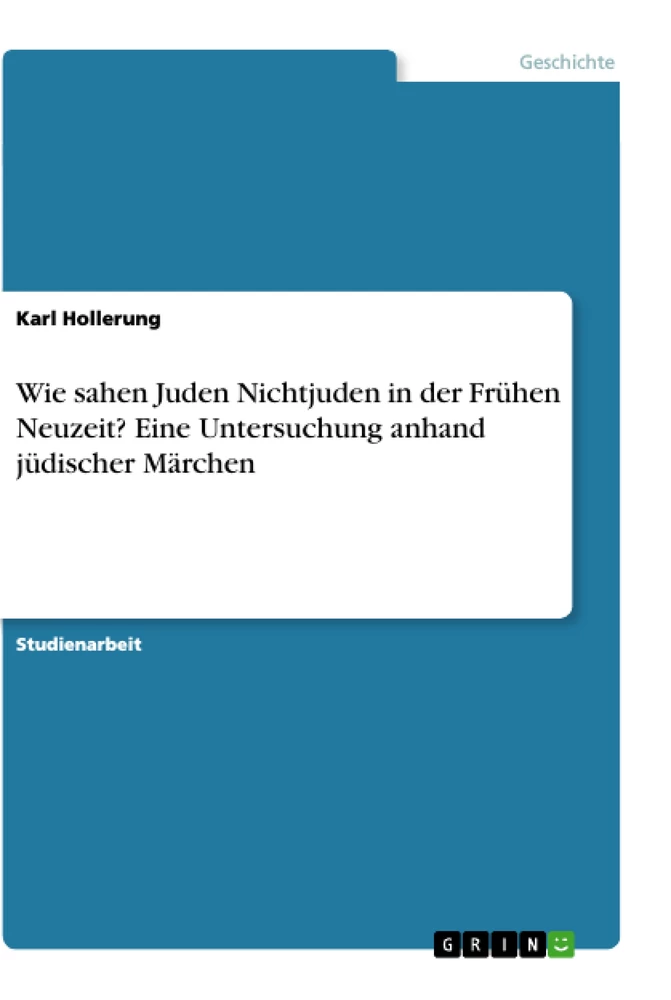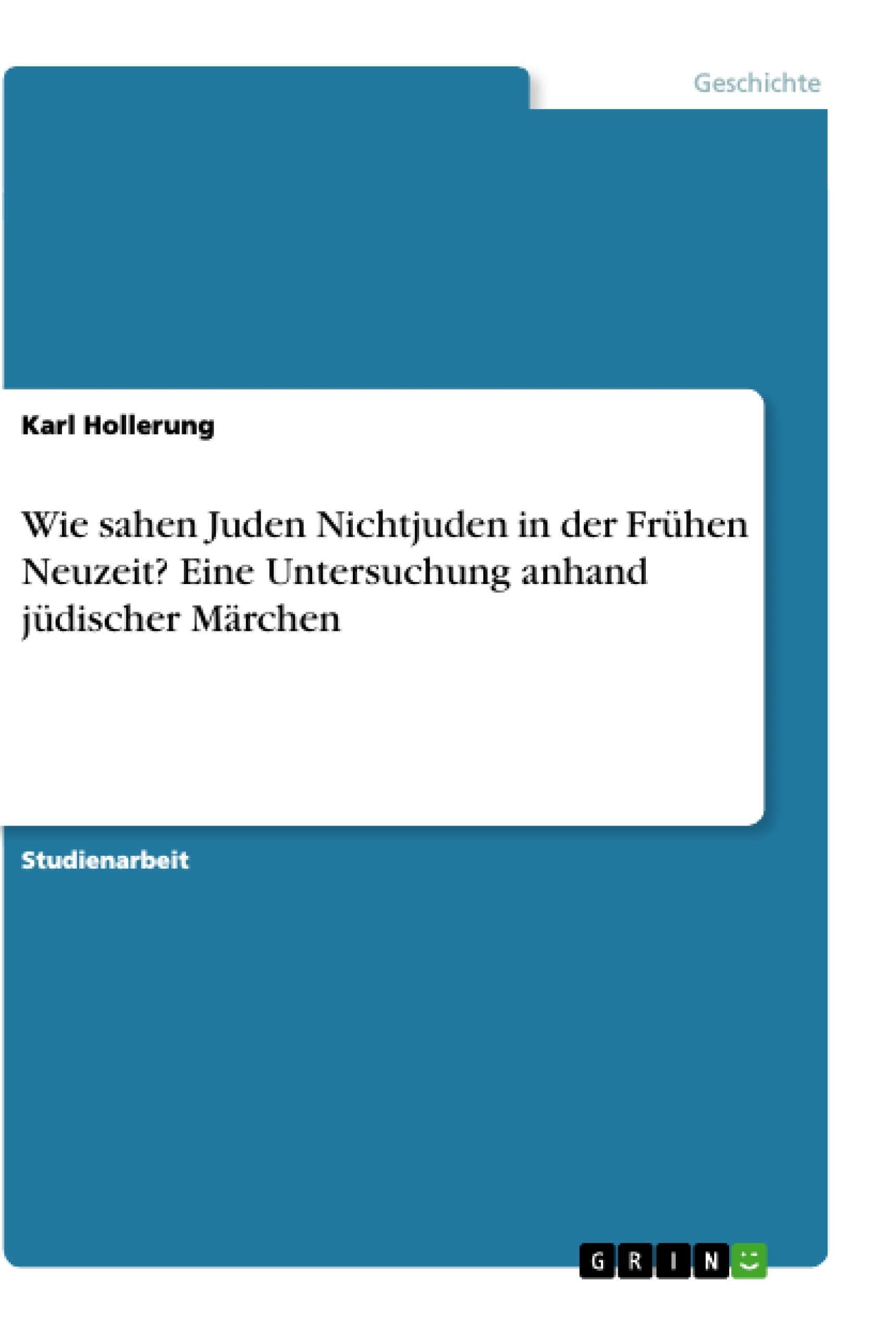Die Frage, wie Juden Nichtjuden gesehen haben, wird bislang in der Forschung erstaunlich wenig thematisiert. Dieser Frage soll deshalb in der hier vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.
Meist wird vielmehr umgekehrt erörtert, wie Nichtjuden Juden gesehen haben. Bereits Hannah Arendt beklagte diesen Trend in der Geschichtswissenschaft und betonte, dass die Abneigung der Christen gegenüber den Juden durchaus auf Gegenseitigkeit beruht hätte und die Juden ihren christlichen Nachbarn in ihrem religiösen Fanatismus allgemein sehr ähnlich gewesen wären. Die Gründe dafür sind mit Sicherheit auch in der Befürchtung zu suchen, bei der Untersuchung dieser Frage auf negative Einstellungen von Juden über Nichtjuden zu stoßen und sich somit möglicherweise dem Vorwurf des Antisemitismus auszusetzen. Dabei ist es bei der Betrachtung zwischenmenschlicher Konflikte natürlich immer notwendig, die Ansichten beider Seiten im Blick zu haben, auch wenn eine Seite in jeder Hinsicht vom Wohlwollen der anderen abhängig ist.
Der hier untersuchte Zeitraum erstreckt sich vom 16. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das ist der Zeitraum, den die neben den jüdischen Märchen verwendeten Quellen abdecken. Untersucht wird das aschkenasische Judentum in den deutschsprachigen Gebieten, Polen sowie Böhmen/Mähren. Zunächst einmal soll ein Überblick über die Art der vorliegenden Märchen verschafft werden, wobei hier auch auf die Frage eingegangen werden soll, inwiefern es sich überhaupt um Märchen handle. Untersucht werden soll dann anschließend im Einzelnen (in der Reihenfolge) die Sichtweise der Juden auf die nichtjüdische Obrigkeit, auf Nichtjuden im Allgemeinen sowie auf die christliche Religion. Dies bietet sich an, da es in der Einstellung der Juden zu den jeweiligen Herrschern der von ihnen bewohnten Länder einerseits und den restlichen Nichtjuden andererseits Unterschiede gab, wie wir noch sehen werden. Weiterhin versteht es sich von selbst, dass in diesem behandelten Zeitraum die Religion eine außerordentlich wichtige Rolle spielte, nicht zuletzt wegen der Reformation. Aus diesem Grunde muss auch die Sichtweise der Juden auf die christliche Religion untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundsätzliches über die vorliegenden Märchen
- Die Einstellung der Juden zur nichtjüdischen Obrigkeit
- Die Einstellung der Juden zu Nichtjuden allgemein
- Jüdische Einstellung zum Christentum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung von Nichtjuden aus der Sicht des aschkenasischen Judentums im 16. und 17. Jahrhundert anhand jüdischer Märchen. Ziel ist es, einen bisher wenig erforschten Aspekt der frühneuzeitlichen jüdisch-nichtjüdischen Beziehungen zu beleuchten und die gängige Sichtweise, die sich primär auf die Perspektive der Nichtjuden konzentriert, zu ergänzen.
- Die Natur und der Ursprung der untersuchten Märchen
- Die Darstellung des Verhältnisses zwischen Juden und der nichtjüdischen Obrigkeit
- Die allgemeine Sichtweise der Juden auf Nichtjuden
- Die jüdische Perspektive auf das Christentum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Forschungslücke bezüglich der jüdischen Wahrnehmung von Nichtjuden in der Frühen Neuzeit. Sie hebt die Tendenz hervor, sich primär mit der nichtjüdischen Perspektive zu befassen und die mögliche Angst vor dem Vorwurf des Antisemitismus als Grund für diese Forschungslücke zu identifizieren. Die Arbeit konzentriert sich auf aschkenasische Juden in deutschsprachigen Gebieten, Polen und Böhmen/Mähren im 16. und frühen 17. Jahrhundert, basierend auf der Quellenlage der verwendeten Märchen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Analyse der Märchen in Bezug auf die Sichtweise der Juden auf die Obrigkeit, Nichtjuden allgemein und das Christentum umfasst.
Grundsätzliches über die vorliegenden Märchen: Dieses Kapitel analysiert die 82 untersuchten Märchen aus „Der Born Judas“ und „Der Golem“, wobei die unterschiedlichen Ursprünge und den zeitlichen Kontext der Märchen kritisch hinterfragt werden. Es wird die Frage diskutiert, inwieweit diese Märchen, die aus unterschiedlichen Zeiten und Regionen stammen, als zuverlässige Quellen für die frühneuzeitliche jüdische Sichtweise dienen können. Der Text beleuchtet den Unterschied zwischen Märchen und Sagen und argumentiert, dass die untersuchten Texte Merkmale beider Genres aufweisen. Die Schwierigkeit, die Geschichten eindeutig als Märchen oder Sagen zu klassifizieren, wird herausgestellt, und es wird entschieden, den Begriff "Märchen" im weiteren Verlauf der Arbeit beizubehalten.
Die Einstellung der Juden zur nichtjüdischen Obrigkeit: Die Analyse dieses Kapitels zeigt, dass knapp die Hälfte der Märchen das Verhältnis zwischen Juden und nichtjüdischen Herrschern thematisieren. Die Märchen werden in zwei Kategorien unterteilt: solche mit negativer und solche mit positiver Darstellung der Herrscher. Ein Teil der Märchen beschreibt die Angst vor Verfolgung, Vertreibung oder dem Verbot des jüdischen Glaubens. Andere Märchen zeigen Herrscher, die hohe Forderungen an die Juden stellen und ihre Machtposition ausnutzen. Insgesamt verdeutlicht das Kapitel die Machtlosigkeit der Juden gegenüber den herrschenden Mächten.
Schlüsselwörter
Frühneuzeit, aschkenasisches Judentum, jüdische Märchen, Nichtjuden, nichtjüdische Obrigkeit, Christentum, Religiöse Minderheiten, Machtverhältnisse, Antisemitismus, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse jüdischer Märchen der Frühen Neuzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert jüdische Märchen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, um die Wahrnehmung von Nichtjuden aus der Sicht des aschkenasischen Judentums zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen Juden und der nichtjüdischen Obrigkeit, der allgemeinen Einstellung zu Nichtjuden und der jüdischen Perspektive auf das Christentum.
Welche Märchen wurden untersucht?
Die Analyse basiert auf 82 Märchen aus den Sammlungen „Der Born Judas“ und „Der Golem“. Die Arbeit diskutiert kritisch die Herkunft und den zeitlichen Kontext dieser Märchen und die Frage, inwieweit sie als zuverlässige Quellen für die frühneuzeitliche jüdische Sichtweise dienen können. Die Texte werden, trotz gewisser Merkmale von Sagen, als Märchen klassifiziert.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit adressiert die Forschungslücke bezüglich der jüdischen Wahrnehmung von Nichtjuden in der Frühen Neuzeit. Bisherige Forschung konzentrierte sich hauptsächlich auf die nichtjüdische Perspektive. Diese Arbeit ergänzt diese Perspektive durch die Analyse der jüdischen Märchen und beleuchtet so einen bisher wenig erforschten Aspekt der frühneuzeitlichen jüdisch-nichtjüdischen Beziehungen.
Wie wird das Verhältnis der Juden zur nichtjüdischen Obrigkeit dargestellt?
Etwa die Hälfte der analysierten Märchen thematisiert das Verhältnis zwischen Juden und nichtjüdischen Herrschern. Die Darstellungen variieren zwischen positiv und negativ. Negative Darstellungen zeigen die Angst vor Verfolgung, Vertreibung oder dem Verbot des jüdischen Glaubens. Positive Darstellungen zeigen hingegen Herrscher, die hohe Forderungen stellen oder ihre Machtposition ausnutzen. Insgesamt verdeutlicht die Analyse die Machtlosigkeit der Juden gegenüber den herrschenden Mächten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Natur und den Ursprung der Märchen, die Darstellung des Verhältnisses zwischen Juden und nichtjüdischer Obrigkeit, die allgemeine Sichtweise der Juden auf Nichtjuden und die jüdische Perspektive auf das Christentum.
Welche geographische und zeitliche Eingrenzung hat die Studie?
Die Studie konzentriert sich auf aschkenasische Juden in deutschsprachigen Gebieten, Polen und Böhmen/Mähren im 16. und frühen 17. Jahrhundert, basierend auf der Quellenlage der verwendeten Märchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Frühneuzeit, aschkenasisches Judentum, jüdische Märchen, Nichtjuden, nichtjüdische Obrigkeit, Christentum, religiöse Minderheiten, Machtverhältnisse, Antisemitismus, Quellenkritik.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die grundsätzlichen Aspekte der untersuchten Märchen, ein Kapitel über die Einstellung der Juden zur nichtjüdischen Obrigkeit und ein abschließendes Fazit.
- Citar trabajo
- Karl Hollerung (Autor), 2013, Wie sahen Juden Nichtjuden in der Frühen Neuzeit? Eine Untersuchung anhand jüdischer Märchen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1059955