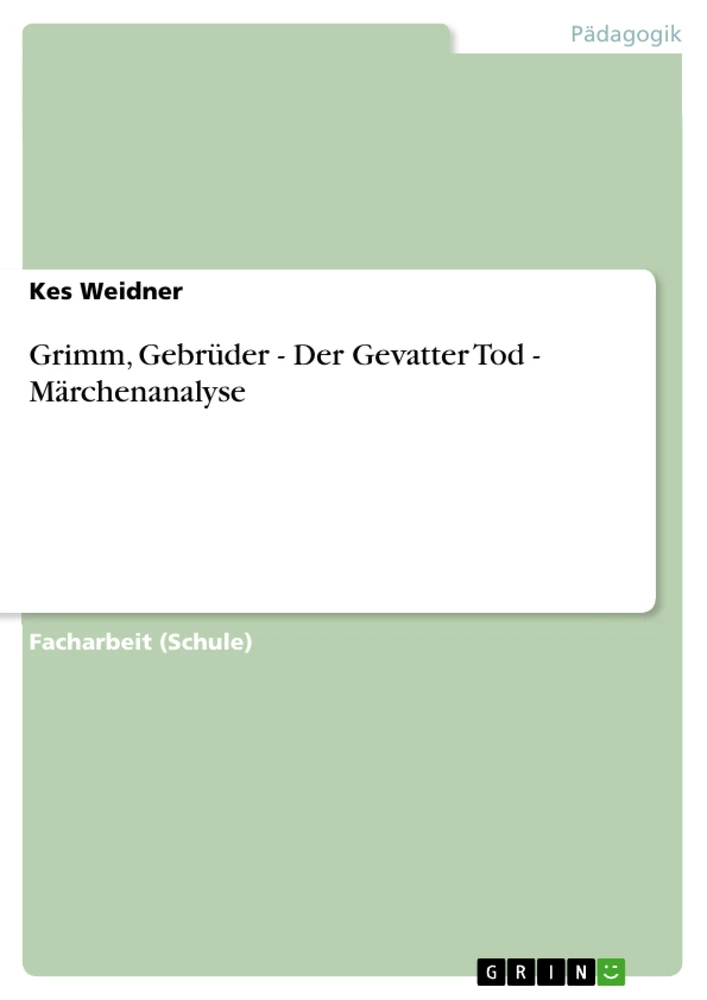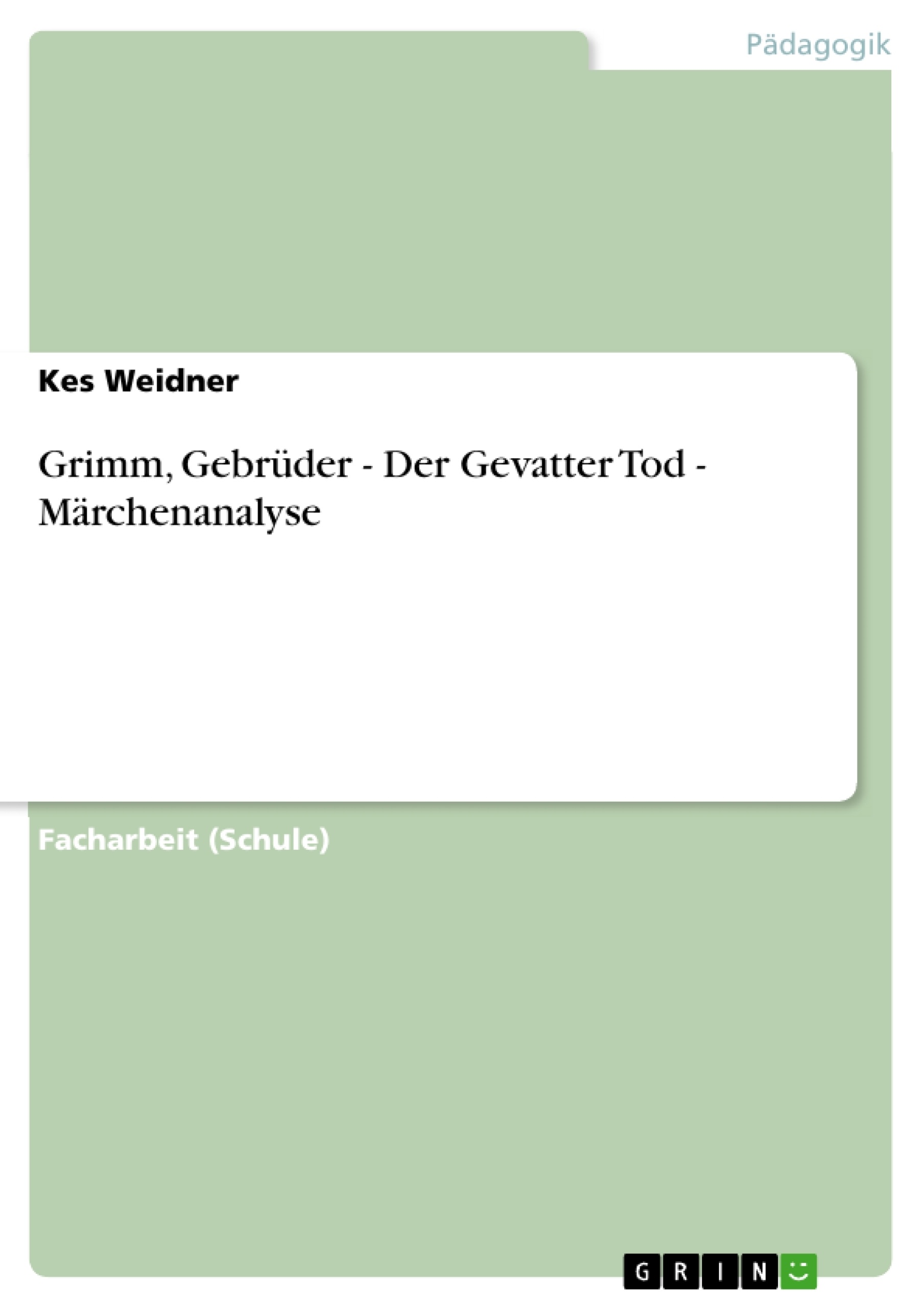Es gibt kaum eine mündliche oder schriftliche Erzählgattung - den Kriminalroman inbegriffen -, in der Tod, Grausamkeit und tödliche Bedrohung so allgegenwärtig wären wie im Märchen. Alles in allem hat man etwa in den Grimmschen Kinder- und Hausmärchen 303 tote Menschen und 24 tote Tiere gezählt. Die Todesmotive sind dabei sehr unterschiedlich und reichen vom natürlichen Tod (Krankheit, Alter, ...) über Todesstrafen, Morde bis hin zu Scheintoten (wie das schlafende Dornröschen). Allgemein kann man sagen, dass es fast ausschließlich Nebenfiguren sind, die wirklich sterben. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Held bzw. die Heldin des Märchens am Ende glücklich und vor allem lebendig.
In den meisten Märchen tritt der Tod nicht als Person auf, sondern nur der Vorgang des Sterbens. Oft wirken Figuren noch nach ihrem Tod auf das Leben der Hauptfigur ein. So deckt zum Beispiel im Märchen "Die Gänsemagd" ein eigentlich totes sprechendes Pferd den Betrug der Kammerjungfer auf und verhilft der Königstochter zu ihrem Recht. Nur selten greift der Tod als Person direkt in das Geschehen ein. Ein Beispiel ist das Märchen "Der Gevatter Tod", um das es in dieser Arbeit geht.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Leben im Mittelalter
1.2 Tod im Märchen
1.3 Definition
2 Aufbau und Inhalt
2.1.1 Figuren
2.1.2 Sprache
2.1.3 Struktur
2.2 Inhalt
2.2.1 Suche nach einem Taufpaten
2.2.1.1 Begegnung mit Gott
2.2.1.2 Begegnung mit dem Teufel
2.2.1.3 Begegnung mit dem Tod
2.2.2 Arzt und Tod
2.2.2.1 Das Patengeschenk
2.2.2.2 Verteilung der Kompetenzen zwischen Arzt und Tod
2.2.3 Verstoß gegen die Regeln
2.2.3.1 Der erste Betrug
2.2.3.2 Die Drohung
2.2.3.3 Der zweite Betrug
2.2.4 Im Reich des Todes
2.2.4.1 Die Lebenslichter
2.2.4.2 Grenzen der Macht des Todes
2.3 Verhältnis zw ischen Mensch und übermenschlichen Kräften
3 Schlussbemerkungen
3.1 Offene Fragen
3.2 Reichtum und Charakter
4 Anhang
4.1 Text - Der Gevatter Tod
4.2 Quellen; Internetseiten
5 Literaturverzeichnis
1 Einführung
1.1 Leben im Mittelalter
,,Ein Knecht der Todes"1
,,Der Mensch ist ein Knecht des Todes ... da er dem Tod nicht entrinnen kann und dieser ihm alle Tage und alle Arbeit nimmt ... der Mensch ist ein Wanderer, ob er nun gerade schläft oder wach ist, ob er nun gerade isst oder trinkt, immer eilt er dem Tod entgegen ... der Mensch lebt mit sieben Gefährten, die ihn immer bedrängen. Diese Gefährten sind Hunger und Durst, es sind Hitze und Kälte und Müdigkeit und Krankheit, und schließlich ist es der Tod."
Diese Kurzgeschichte aus dem 13. Jahrhundert drückt das Verhältnis der überwiegend armen Bevölkerung im Mittelalter zum Tod aus.
Die Gesellschaft im Mittelalter war streng in verschiedene Stände unterteilt. Die Macht lag bei einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung, dem Adel und dem Klerus. Einen weiteren, nicht allzu großen Teil machten die wohlhabenden Bürger aus. Die große Masse des Volkes stellten jedoch einfache Menschen wie Bauern und Handwerker. Für diese Menschen war das Leben oft schwer, denn wie die Macht lag auch der Besitz bei dem geringen von Geburt an besser gestellten Ständen des Adels und Bürgertum. Der Großteil der Bevölkerung musste von morgens bis abends hart arbeiten um den Lebensunterhalt zu verdienen, trotzdem reichte es oft nicht einmal für genügend Nahrung. Die Lebenserwartung der Menschen betrug durchschnittlich 30 Jahre. Neben Hunger und Kälte vor allem im Winter forderten Infektionskrankheiten wie Lepra, Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und Cholera gerade unter der ärmeren, schlecht ernährten Bevölkerung ,,alljährlich unzählige Menschenleben"2. Aufgrund der Häufigkeit der Todesfälle, die man alltäglich sah, waren die Menschen mit dem Tod wesentlich vertrauter als heute. Er gesellte sich zu den Widrigkeiten des Lebens, denen man sonst noch ausgesetzt war. Der einzige Unterschied war, dass man ihm nicht entkommen kann, sondern im Gegenteil das ganze Leben auf den Zeitpunkt zusteuert, an dem der Tod einen selbst holt.
1.2 Tod im Märchen
Es gibt ,,kaum eine mündliche oder schriftliche Erzählgattung - den Kriminalroman inbegriffen! -, in der Tod, Grausamkeit und tödliche Bedrohung so allgegenwärtig wären wie im Märchen."3 "Alles in allem hat man etwa in den Grimmschen Kinder- und Hausmärchen4 303 tote Menschen und 24 tote Tiere gezählt."5 Die Todesmotive sind dabei sehr unterschiedlich und reichen vom natürlichen Tod (Krankheit, Alter,...) über Todesstrafen, Morde bis hin zu Scheintoten (wie das schlafende Dornröschen).
Allgemein kann man sagen, dass es fast ausschließlich Nebenfiguren sind, die wirklich sterben. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Held bzw. die Heldin des Märchens am Ende glücklich und vor allem lebendig.
In den meisten Märchen tritt der Tod nicht als Person auf, sondern nur der Vorgang des Sterbens. Oft wirken Figuren noch nach ihrem Tod auf das Leben der Hauptfigur ein. So deckt zum Beispiel im Märchen Die Gänsemagd (KHM 89) ein eigentlich totes sprechendes Pferd den Betrug der Kammerjungfer auf und verhilft der Königstochter zu ihrem Recht.
Nur selten greift der Tod als Person direkt in das Geschehen ein. Ein Beispiel ist das Märchen Der Gevatter Tod (KHM 44), um das es im Folgenden geht.
1.3 Definition
Der Begriff Märchen geht auf das altdeutsche Wort maere zurück, das Bericht, Kunde oder Erzählung bedeutet6.Diese Bezeichnung für eine literarische Gattung geht auf die Brüder Grimm zurück. Diese trugen mit ihrer weltberühmten Sammlung der Kinder- und Hausmärchen wesentlich dazu bei, die ursprünglich als ,,Armeleutedichtungen"7 und ,,Volkspoesie"8 verpönten Märchen gesellschaftsfähig zu machen.
Die Herkunft des Märchens ist unklar. Von vielen Märchenforschern wird ,,Indien als Ursprungsland des eigentlichen Märchens"9 angenommen. Aber auch viele Motive aus antiken griechischen und römischen, keltischen und germanischen Sagen und Legenden finden sich in Märchen wieder. ,,Die Dichtung des Mittelalters enthält zahlreiche Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten mit den später schriftlich fixierten Märchenmotiven und Handlungsabläufen"10. Aus diesem Grund wird oft das Hoch- und Spätmittelalter als Entstehungszeit der Märchen, wie sie zum Beispiel in den KHM gesammelt sind, angegeben. Märchen dienten meist der Unterhaltung Erwachsener und wurden vorwiegend bei ,,Gemeinschaftsarbeiten (Korbmachen, Kohlenbrennen, Fischernetze flicken, Spinnen, usw.)"11 erzählt.
2 Aufbau und Inhalt
2.1.1 Figuren
Die Anzahl der Akteure im Märchen ist begrenzt und überschaubar.12
Die Personen des Märchens können nach einem ,,Kontrastprinzip"13 geordnet werden. Es stehen sich Figuren aus extrem unterschiedlichen Milieus gegenüber. So findet sich Gott seinem Gegenspieler, dem Teufel gegenüber. Der arme Mann (Z 2-3)14 wird im Kontrast zu seinem reichen und berühmten Sohn (Z 33), sowie dem König (Z 34) und dessen Tochter (Z 44) gezeigt.
Es ist für Märchen im Allgemeinen typisch, dass die handelnden Personen nicht näher charakterisiert15 werden. So findet man auch im vorliegenden Märchen keine näheren Informationen wie Namen, Aussehen, Charakter usw. über die Figuren. Sie werden lediglich durch ihren Beruf (z.B.: Arzt), ihre gesellschaftliche Stellung (z.B.: König) oder einer Eigenschaft (z.B.: arm) beschrieben. Außerdem gibt es noch Gott, Teufel und Tod, bei denen eine allgemeine Charakterisierung nicht nötig ist, da man davon ausgehen kann, dass jeder Leser oder Hörer ein Bild von diesen Figuren im Kopf hat. Die Akteure sind nicht als Individuen, sondern als Typen gekennzeichnet.16 Bestimmte Typen sind fast immer gleich. So ist der König in den meisten Märchen alt oder krank, aber er steht als Inbegriff für ,,die Herrschaft, die Macht und die Gewalt"17 ; die Prinzessin wird als wunderschön beschrieben und Held entweder besonders schlau oder er hat besonders viel Glück.
2.1.2 Sprache
Wie seine Herkunft aus dem einfachen Volk schon nahe legt, ist die Sprache des Märchens relativ einfach gehalten. Es kommen weder Fremdwörter noch komplizierte Satzstrukturen darin vor.
Dies ist auf den Anspruch der Brüder Grimm zurückzuführen ,,alles durch den Mund des Volkes überlieferte so rein als möglich ... treu und genau mit aller Eigentümlichkeit selbst des Dialekts, ohne Zusatz und sogenannte Verschönerung wiederzugeben."18 Sie hatten also vor, die Märchen so aufzuschreiben, wie sie ihnen erzählt wurden. Allerdings ist bekannt, dass die Brüder Grimm ,,durchaus eine Bearbeitung der mündlich überlieferten Texte vornahmen; sie ergänzten Bruchstückhafte Überlieferungen, kompilierten verschiedene Versionen und glichen die Märchen stilistisch einander an; [ ... ] [verschiedene Stilmittel] und vor allem die Einführung der direkten Rede belebten [ ... ] die Texte, die aus der Erzählform des Präsens in das Imperfekt gestellt wurden."19
So werden auch in Der Gevatter Tod die meisten wichtigen Szenen in direkter Rede wiedergegeben, wodurch der Leser das Gefühl bekommt unmittelbarer Beobachter des Geschehens zu sein. Die heute nicht mehr gebräuchlichen Ausdrücke wie ,,du dauerst mich" (Z 6) anstelle von ich bedaure dich oder ,,Gevatter" für Pate sind Hinweise auf das Alter des Märchens.
2.1.3 Struktur
Märchen weisen ,,eine schematische Erzählstruktur"20 auf. Dabei ist der Ausgangspunkt wie in Der Gevatter Tod oft eine Notlage oder ein anderes einschneidendes Erlebnis im Leben der Hauptfigur. Meist nimmt das Märchen ein glückliches Ende, was oft durch die berühmte Formel ...und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute ausgedrückt wird. Hier bildet Der Gevatter Tod eine Ausnahme, denn die Hauptfigur stirbt am Ende. Daneben gibt es noch viele weitere Motive, die in den meisten Märchen sehr ähnlich sind. Ein Beispiel ist die Entscheidung des Königs, die Herrschaft über das Land (bzw. die Hälfte desselben) und seine Tochter als Braut zur Belohnung anzubieten (Z 46), wie man außer in Der Gevatter Tod unter anderem in Das tapfere Schneiderlein (KHM 20) finden kann.
Die Handlung ist einsträngig, das heißt es wird nur der Teil des Lebens des Arztes betrachtet, in dem er etwas mit seinem Gevatter, dem Tod, zu tun hat. Das Märchen wird ohne Rückblenden oder Einschübe erzählt, es werden lediglich Zeitraffungen vorgenommen, der Handlungsablauf bleibt aber chronologisch.
Die Handlung des Märchens ist vierteilig.
2.1 Inhalt
2.1.1 Suche nach einem Taufpaten
Der erste Abschnitt (Z 2-21) behandelt die Suche des Vaters nach einem geeigneten Taufpaten.
Durch die Taufe wird ein Kind in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Taufpaten21. Die Aufgabe der Paten ist es in erster Linie die Eltern bei der christlichen Erziehung des Kindes zu unterstützen und ihm zu helfen in den Glauben und die Gemeinde hineinzuwachsen22. Schon immer spielten aber auch finanzielle Aspekte eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Wahl der Taufpaten. Es wurden zum Beispiel Geschenke zur Taufe, Geburtstagen und Weihnachten erwartet und somit ist ein wohlhabender Pate vorteilhafter für das Kind als jemand, der wie der arme Mann in diesem Märchen selbst kaum weiß wie er seine Familie ernähren soll (Z 2-3).
Man kann also den Entschluss des Vaters, den ersten Menschen den er auf der Strasse trifft das Amt des Paten anzutragen (Z 4-5), als ziemliches Glücksspiel bezeichnen, es hätte nämlich durchaus nur ein armer Wanderer sein können. Andererseits ist bei einem Mann mit 13 Kindern anzunehmen, dass alle anderen in Frage kommenden Personen in seiner Verwandund Bekanntschaft bereits Paten eines seiner anderen Kinder sind. So bleibt ihm in Ermangelung eines Kandidaten nichts anderes übrig als den ersten zu nehmen, der ihm begegnet. Wie schon erwähnt ist eine Patenschaft auch mit Kosten verbunden und bei einem armen Mann ist nicht anzunehmen, dass er so viele wohlhabendere Bekannte hat, denen er diese Ausgaben zumuten kann und somit wird es mit wachsender Anzahl Kinder zunehmend schwieriger geeignete Paten zu finden.
2.1.1.1 Begegnung mit Gott
Schließlich ist es Gott persönlich, dem der Mann als erster auf der Strasse begegnet (Z 5). Im Sinne der Taufe wäre dieser die ideale Person für dieses Amt, denn wer könnte ein Kind besser im christlichen Glauben erziehen als der christliche Gott selbst? Insofern ist es zunächst überraschend, dass Gott als Pate abgelehnt wird. Aufgrund der Begründung welche der Mann abgibt, nämlich dass Gott in der Verteilung von Besitz ungerecht sei (Z 8-9), ist diese Entscheidung jedoch durchaus verständlich. Wenn das Leben von Hunger und Armut gekennzeichnet ist, fällt es den Menschen schwer an einen gerechten Gott zu glauben, wenn man gleichzeitig sieht, wie ein kleiner Teil der Bevölkerung immer reicher wird. Da Märchen hauptsächlich in ärmeren Bevölkerungsschichten verbreitet waren, ist diese Ansicht oft auf offene Ohren gestoßen und machte es den Zuhörern leicht, sich mit dem armen Mann zu identifizieren.
Im Gegensatz zur Erstfassung haben die Brüder Grimm laut Hark23 in späteren Ausgaben eine Abschwächung der Gotteskritik eingefügt, wahrscheinlich um Ärger mit der Kirche und der gebildeten Bevölkerungsschicht zu vermeiden. Sie hängen dem Mann Unwissenheit und Uneinsichtigkeit in bezug auf die Weisheit Gottes an (Z 9-10).
Es stellt sich allerdings die Frage, warum der Mann sein Kind überhaupt taufen lässt, wenn er so sehr an Gott zweifelt. Das Märchen lässt diese Frage völlig offen. Meiner Meinung nach ist die Taufe einfach zu einer Tradition verkommen, die man einhält, aber an deren ursprünglichen Sinn man nicht mehr denkt. Ähnlich verhält es sich mit dem Weihnachtsfest. Viele Familien denken nicht mehr an den Ursprung und den Sinn dieses Festes. Man trifft sich zwar, tauscht Geschenke aus und schlägt sich den Bauch voll, aber warum man dieses Fest eigentlich feiern sollte, darüber wird oft gar nicht mehr oder nur kurz und oberflächlich nachgedacht. Diese These würde auch erklären, warum der Mann zunächst scheinbar keine Ansprüche an den Paten stellt, sondern den ersten besten nehmen will, der ihm auf der Strasse begegnet.
2.1.1.2 Begegnung mit dem Teufel
Nach der Begegnung mit Gott trifft der arme Mann den Teufel. Dieser ist bekanntlich der Gegenspieler von Gott und somit wäre zunächst anzunehmen, dass der von Gott Enttäuschte sich dem Teufel zuwendet, zumal dieser ihm Gold für sein Kind anbietet, was auch dem Vater zugute käme. Zum einen kann man annehmen, dass dieser Reichtum dazu genutzt werden würde die ganze Familie zu versorgen, und selbst wenn dem nicht so wäre, würde der Vater die Kosten für ein Kind einsparen.
Der Teufel erscheint hier objektiv betrachtet nicht in der vom Christentum geprägten Rolle als Personifikation des Bösen, sondern als Wesen, dass die christliche Tradition der Taufe achtet und darüber hinaus sehr opulente Patengeschenke, nämlich Gold und alle Lust der Welt, in Aussicht stellt. Man kann weder das Gold noch die Lust objektiv betrachtet als schlecht bewerten. Gold ist ein Edelmetall wie es noch etliche andere gibt, ist weder giftig noch hat es irgendeine andere negative Wirkung. Im Gegenteil, schließlich war Gold eines der Geschenke, die Jesus von den drei heiligen Königen bekommen hat.
Aber wie unter anderem auch Goethe in seinem Faust das Gold als Mittel zur Verführung Gretchens24 einsetzt, verbinden speziell ärmere Bevölkerungsschichten Gold mit Verführung und Sünde. Prinzipiell ist diese Verbindung auch gar nicht so weit hergeholt, denn reiche Leute konnten und haben sich oft vieles geleistet, was in den strengen Regeln der Kirche als Sünde geführt wurde (beispielweise viel Essen, Wein, Mätressen,...). Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass arme Leute, die sich von Sünden auch nicht so einfach loskaufen konnten (beispielweise durch Ablässe) und die auf ein solches Leben meistens neidisch waren (selbst wenn sie es nicht zugegeben hätten), Reichtum bzw. Gold mit Sünde und Verführung verbanden.
Der Vater lehnt also auch den Teufel als Paten ab, weil er dessen Angebot für schlecht und ihn selbst für den bösen Verführer schlechthin hält Prinzipiell bietet der Teufel aber nichts anderes als Gott an. Beide bieten materielle Güter (Gott: ,,[ich] will für es sorgen"(Z 7); Teufel: ,,[ich] will ihm Gold die Hülle und Fülle ... geben (Z 12)) und emotionale Befriedigung (Gott: ,,[ich] will ... es glücklich machen"(Z 7); Teufel: ,,[ich] will ... ihm ... alle Lust der Welt ... geben"(Z 12) für das Kind an. Obwohl beide das gleiche bieten lehnt er sie mit unterschiedlichen Begründungen ab.
Er hält sich also absolut nicht an seinen Vorsatz, den ersten ,,zu Gevatter [zu] bitten", den er trifft (Z 4-5), sondern wählt subjektiv und durch Vorurteile belastet (Gott ist ungerecht; Teufel betrügt und verführt) den Gevatter aus. Dabei tritt für den Vater der Nutzen für das Kind in den Hintergrund. Seine Auswahlkriterien beinhalten weder wer am besten die Aufgabe eines Paten im eigentlichen Sinne erfüllen kann, noch von welcher Patenschaft das Kind profitiert.
2.1.1.3 Begegnung mit dem Tod
Anders als Gott und Teufel spricht der Tod den armen Mann nicht mit einer Bitte an, sondern gibt mit den Worten ,,Nimm mich zu Gevatter"(Z 15) beinah die Anweisung zum Gevatter gemacht zu werden. Auf Nachfrage des Mannes gibt er sich als der Tod zu erkennen und betont gleich darauf, dass er ,,alle gleich" macht (Z 16). Durch diese Aussage und mit seiner direkten Art bei der Begrüßung spricht er den einfachen Mann mehr an als Gott und Teufel, die erst auf den Mann einreden und ihm materielle und emotionale Güter in Aussicht stellen, die er in diesem Umfang bisher wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen hat und denen er misstrauisch gegenüber steht.
Der Vater wählt also ihn zum Gevatter und damit die Macht, die für ihn am präsentesten ist bzw. die er am besten kennt. Gott und Teufel sind Mächte mit denen sich die Theologie auseinandersetzt. Das Studium der Zusammenhänge und theologischen Lehren war fast ausschließlich der gebildeten, wohlhabenderen Bevölkerungsschicht und den Mönchen, Priestern, usw. vorbehalten. Die einfachen, armen Menschen hatten weder die Zeit noch das nötige Hintergrundwissen um den oft komplizierten theologischen Texten und Gesprächen zu folgen.
Zum einen scheiterten sie häufig schon daran, dass sie gar nicht oder nur schlecht lesen und schreiben konnten, zum anderen war die Sprache der Gelehrten Latein, das von jemanden aus dem einfachen Volk nur sehr selten erlernt und verstanden wurde25.
Der Tod hingegen war allgegenwärtig. Aufgrund der mangelnden Versorgung mit Nahrung, Hygiene und Medizin war die Lebenserwartung der Menschen nicht besonders hoch und so war für die Menschen der Tod eine wesentlich realere Macht, als Gott und Teufel. Außerdem war der Tod leichter zu begreifen. Er war eindeutig, wenn ein Leben zu Ende war, dann holte er den Menschen, ohne wenn und aber. Bei Gott und Teufel war die Sache komplizierter. Die grundsätzliche Einteilung in Gott (als das Gute und der Gerechte, dessen Gebote befolgt werden müssen um in den Himmel zu kommen) und Teufel (der versucht die Menschen vom Pfad der Tugend abzubringen) war einfach zu verstehen. Aber immer wieder hörte man Geschichten über Reiche und Mächtige, die die Gebote Gottes übertraten und oft keinerlei Konsequenzen zu erwarten hatten; es wurde einfach darüber hinweggesehen. Außerdem hatte man zum Teil hohe Steuern an die Kirche abzugeben, die oft Hunger für die eigene Familie bedeuteten. Angesichts dieser Ungerechtigkeit und Belastungen der ärmeren Bevölkerung gegenüber war es manchmal sehr schwierig, Gott als gut und gerecht anzusehen.
2.1.2 Arzt und Tod
Zeitlich gesehen ist der Übergang vom ersten zum zweiten Abschnitt (Z 23-36) ein Sprung von einigen Jahren. Es wird die für die Handlung unwichtige Kindheit und Jugend des Helden übersprungen. Diese Technik ist ein für Märchen gattungstypisches Merkmal und wird auch als ,,aussparende Raffung26 " bezeichnet.
Zu Beginn des Erwachsenseins und wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt an dem der Junge seinen Beruf wählen muss, tritt der Pate Tod in das Leben des Jungen und führt ihn in den Wald, wo er ihm als Patengeschenk das Wissen über ein Kraut vermacht, das Todkranke heilen soll. Der Junge wird eindringlich davor gewarnt das Kraut gegen den Willen des Todes zu gebrauchen. Zunächst hält sich der zum Arzt gewordene, junge Mann an die Anweisungen seines Paten und wird reich und berühmt.
2.1.2.1 Das Patengeschenk
Bei dem angekündigten Geschenk handelt es sich um ein Kraut, dass starke Heilkräfte besitzt und mit dessen Hilfe der Protagonist ohne Studium und umfassendes Wissen über Medizin und Heilkünste sich als Arzt bezeichnen kann.
Entgegen dem Sprichwort gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen existiert eine solche Pflanze also doch, nur ist ihre Wirkung den meisten Menschen unbekannt. Der Tod verrät dem Arzt keine Zaubereien oder ähnliches.
Das Kraut gibt es schon, bevor der Tod seinem Patenkind dessen Wirkung erläutert. Es wächst im Wald (Z 23) und wahrscheinlich haben es schon viele Menschen bei der Jagd, beim Pilze- und Beerensammeln, beim Wandern oder wann immer sie im Wald waren, gesehen aber nicht beachtet und sogar zertreten, ohne zu ahnen, welche Kräfte in dieser Pflanze schlummern. Aber irgendwann muss es mindestens einen Menschen gegeben haben, der die Wirkung des Krautes kannte bzw. durch Zufall oder Ausprobieren davon erfahren hat, denn auch der Tod kann nur wissen, was dieses Kraut bewirkt wenn es schon mal eingesetzt wurde. Das Wissen war also schon einmal vorhanden, ist aber im Laufe der Jahrhunderte verlorengegangen.
Für diese Theorie spricht die Tatsache, dass das Wissen über die verschiedenen (Heil-) Wirkungen von Pflanzen in der Medizin vergangener Jahrhunderte eine sehr große Rolle gespielt hat. Gerade unter Frauen wurde das Wissen um Heilkräuter von den Müttern auf die Töchter weitergegeben. So besaßen beispielweise Hebammen oft ein umfangreiches Wissen welche Kräuter schmerzstillend, entzündungshemmend oder sogar abtreibend sind.
Leider sind große Teile dieses Wissens im Laufe der Jahrhunderte verlorengegangen, da die Naturheilkunde von der ,,modernen" Medizin mit ihren teilweise recht merkwürdigen Therapien (wie Aderlass oder Quecksilberbäder) verdrängt wurde. Zuviel Wissen um die Heilkraft der Natur brachte in Zeiten der Inquisition vielen Frauen die Anklage der Hexerei und oft den Tod auf dem Scheiterhaufen ein. In manchen Klöstern wurden die Erkenntnisse über die Kräfte der Natur zwar gesammelt, aber vieles muss heute erst wiederentdeckt werden und die Forscher müssen darauf hoffen, dass das Glück oder der Zufall ihnen wieder ein Kraut zeigt und seine Wirkung verrät.
Laut Hark war es allerdings nicht von Anfang an ein Kraut, das den Tod besiegen konnte. "In der Erstfassung des Märchens der Gebrüder Grimm heißt es, dass der junge Doktor die Kranken an einer Flasche riechen lassen solle"27 Es existieren also verschiedene Versionen über die Beschaffenheit des Heilmittels. Allen gemeinsam ist nur, dass sie vor dem Tod retten.
Schon immer waren die Menschen auf der Suche nach einer Möglichkeit den Tod hinauszuzögern. Eines der berühmtesten Mittel gegen den Tod ist wahrscheinlich der Stein der Weisen28, nach dem Generationen von Alchemisten29 gesucht haben. Wer im Besitz eines solchen Mittels ist, hat alle Chancen reich und berühmt zu werden, wenn er es einsetzt.
Die Aussicht ein reicher und berühmter Arzt werden zu können stellt für diesen jungen Mann eine Chance dar, an die er vorher sehr wahrscheinlich höchstens in Tagträumen gedacht hat. Der Berufsstand des Arztes genießt heute wie früher einen guten Ruf, und auch heute noch verbindet man in breiten Teilen der Bevölkerung Wohlstand mit einem für Mediziner beinah obligatorischen Doktortitel.
In der heutigen Zeit ist es ohne finanzielle Unterstützung der Familie schwierig Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Nicht anders war es in den vergangenen Jahrhunderten. Wer nicht aus einer Arztfamilie stammte musste Lehr- und Studiengeld aufbringen um jemanden zu finden, der ihn in die Kunst der Medizin einführt. Für einen Sohn eines armen Mannes mit mindestens zwölf Geschwistern (Z 2-3) war dieses Geld vermutlich nicht aufzubringen. Durch das Patengeschenk spart er sich also sowohl das Geld für eine Ausbildung als auch die Zeit, die er für diese Ausbildung benötigt hätte. Er braucht nur die Wirkung einer einzigen Medizin zu kennen.
Wie schon erwähnt vermittelt der Tod seinem Patenkind nur Wissen, dass schon lange existiert aber bei den Menschen in Vergessenheit geraten ist. Dieses Phänomen der Erkenntnis durch den Tod kann mit den Berichten von Menschen mit Nahtoderlebnissen verglichen werden. Menschen, die kurze Zeit klinisch tot waren berichten oft von einem hellen Licht, Wärme und plötzlichen Antworten auf alle Fragen die sie haben und dem Verstehen von Zusammenhängen dieser Welt.
Dass ein Mensch durch den Tod Wissen erlangt, scheint also gar nicht so unwahrscheinlich zu sein, nur müssen die meisten Menschen erst wirklich sterben um dieses Wissen zu erlangen.
Der junge Arzt hingegen hat das Glück, Wissen schon zu Lebzeiten zu erlangen, allerdings mit der Auflage es nur mit Genehmigung des Todes zu nutzen. Er hat also eigentlich keinen Vorteil gegenüber dem Rest der Menschheit, außer dem versprochenen Ruhm und Reichtum.
2.1.2.2 Verteilung der Kompetenzen zwischen Arzt und Tod
Die Entscheidung darüber, ob ein Mensch stirbt oder nicht behält sich der Tod vor.
Er erklärt, dass er ,,jedes Mal" erscheint (Z 25) und anzeigt ob er den Kranken für sich beansprucht oder nicht (Z 25-28). Der Arzt scheint absolut vom Willen seines Paten abhängig zu sein und keine Möglichkeit zu haben, eine eigene Entscheidung über Leben oder Sterben seines Patienten zu fällen.
Indem der Tod den Arzt davor warnt, gegen seinen Willen zu handeln (Z 28-29) räumt er aber indirekt ein, dass dieser doch die Regeln seines Gevatters brechen kann, wenn er die entsprechenden Konsequenzen trägt, die an dieser Stelle aber noch nicht näher beschrieben sondern nur als ,,schlimm"(Z 29) bezeichnet werden.
,,Es dauerte nicht lange"(Z 30) bis sich zeigt, dass der Tod das Versprechen dem Vater gegenüber eingehalten hat. Der junge Ma nn hält sich an die Anweisungen seines Paten, wird ,,der berühmteste Arzt auf der ganzen Welt"(Z 30) und verdient mit seiner Kunst ,,soviel Gold, dass er bald ein reicher Mann" ist (Z 33).
Aber dieser ständige Erfolg verleitet ihn schließlich zum Übermut und Ungehorsam.
2.1.3 Verstoß gegen die Regeln
Im dritten Abschnitt betrügt der Arzt den Tod trotz nochmaliger Warnung mehrfach um einen Todgeweihten. Bei diesen Kranken handelt es sich aber nicht um gewöhnliche Menschen.
2.1.3.1 Der erste Betrug
Zunächst ist es der König, zu dem der Arzt gerufen wird (Z 34).
Er erkennt zwar, dass er diesem Patienten nicht helfen darf, aber zum ersten Mal hält er sich nicht an die Regel das Kraut nur zu benutzen, wenn der Tod am Kopfende des Bettes steht und damit anzeigt, dass dieser Mensch weiterleben soll. Über die Motive kann man nur spekulieren, da sie im Text nicht erwähnt sind.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Arzt sich an die Anweisung seines Gevatters gehalten hätte, wenn der Patient ein einfacher Mann gewesen wäre. König und Arzt haben keine persönliche Beziehung zueinander. Es wäre zum Beispiel verständlich gewesen, wenn der junge Mann seinen Vater, Geschwister oder andere Verwandte gerettet hätte. Das einzige Merkmal, was diesen Patienten für den Arzt so besonders macht ist die Tatsache, dass es sich um einen Menschen handelt, der eines der höchsten Ämter begleitet und damit Macht und Reichtum besitzt. Man kann davon ausgehen, dass sich der Arzt von der Heilung des Königs etwas erhofft hat, zum Beispiel eine sehr großzügige Belohnung oder ein besonders ehrenvolles Amt, sonst hätte er sich nicht mit dem Tod angelegt.
Hier zeigt sich, dass der Vater mit seinen Bedenken dem Teufel und seinen Geschenken gegenüber doch nicht so falsch lag. Zwar hat er den Teufel abgelehnt, aber ,,Gold in Hülle und Fülle"(Z 12) hat sein Sohn trotzdem bekommen und lässt sich dadurch zu Übermut und Ungehorsam verführen.
Er wendet also eine List an und dreht den kranken König um. Dadurch steht der Tod am Kopf des Königs und der Arzt kann scheinbar rechtmäßig das Heilmittel verabreichen (Z 38-39).
2.1.3.2 Die Drohung
Wie der Arzt schon vorher vermutet hat (Z 37-38) ist der Tod zwar erzürnt über den Betrug, belässt es aber bei der Drohung, das nächste mal dem Arzt selbst das Leben zu nehmen (Z 42- 43). Diese drastische Drohung ist vom Standpunkt des Todes aus notwendig, denn wenn der Arzt einmal das Tabu gebrochen und gegen den Willen seines Gevatters gehandelt hat, ist die Gefahr sehr hoch, dass er dies noch einmal tut und sich Kompetenzen anmaßt, die er nicht hat.
2.1.3.3 Der zweite Betrug
Trotz der Drohung betrügt der Arzt den Tod bald darauf ein zweites Mal. Diesmal ist es die Tochter des Königs, die erkrankt (Z 44). Obwohl der König die Fähigkeiten des Arztes kennt, lässt er ihn nicht rufen, sondern reagiert mit der Bekanntmachung, dass derjenige, der ,,sie vom Tode errettet" ,,ihr Gemahl werden und die Krone erben soll"30. Es scheint also, als lege der König nicht allzu großen Wert darauf, dass es dieser Arzt ist, der seiner Tochter hilft. Verschiedene Motivationen können ihn zu diesem Schritt bewegt haben. Zum einen ist der Ständeunterschied zwischen der Königsfamilie und dem Arzt als Sohn eines sehr armen Mannes erheblich.
Es liegt also nahe, dass der König die Hoffnung hegt, ein anderer Arzt, der aus einer wohlhabenden, wenn nicht sogar adeligen Familie stammt und eine fundierte Ausbildung genossen hat, kann der Königstochter helfen und er schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: zum einen seine Tochter zu retten und zum anderen einen geeigneten Gemahl für sie zu finden.
Eine zweite Variante ist, dass der König von dem jungen Mann durchaus beeindruckt war und ihn sich als Schwiegersohn gewünscht hätte, eine Hochzeit aber aus politischen Gründen ausgeschlossen ist. Aufgrund der erwähnten Standesunterschiede wäre es für den Arzt schwer vom Adel als Thronfolger anerkannt zu werden.
Eine andere Möglichkeit ist, dass der König sich nicht bewusst darüber war, wie nah er dem Sterben war und einem Arzt aus dem einfachen Volk die Heilung seiner scheinbar noch schwerer erkrankten Tochter nicht zutraut.
Der Arzt wiederum reagiert auf den Aufruf des Königs, sieht aber am Fußende des Bettes der Königstochter den Tod stehen (Z 47). Er erkennt daran deutlich, dass ihr Leben zu Ende ist. Allerdings betört ihn ,,die große Schönheit der Königstochter und das Glück, ihr Gemahl zu werden"(Z 48) so sehr, dass er die Drohung des Todes vergisst und dessen Drohgebärden übersieht. Hier findet das Sprichwort Liebe macht blind31 seine Bestätigung. Aus Liebe bzw. Verliebtheit übersieht er die zornigen Blicke und die erhobene Faust des Todes, die ihm gewarnt hätten, dass der Tod ihm einen zweiten Betrug nicht mehr durchgehen lassen würde.
Bezeichnenderweise ist es eine Frau, die den Arzt zu Ungehorsam verführt. Wie in der Bibel Eva Adam dazu verführt gegen Gottes Verbot zu verstoßen, verführt die Königstochter hier den Arzt gegen das Verbot des Todes zu verstoßen, auch wenn sie das nur passiv durch ihre Schönheit tut. Damit liefert das Märchen ein Beispiel für die Auffassung der Kirche, dass eine Frau die Sünde in die Welt gebracht hat.
Hier findet sich also auch eine Warnung an Männer, sich nicht von Frauen verführen zu lassen, sondern den ihnen im damals herrschenden patriarchischen Gesellschaftssystem angestammten Platz als Oberhaupt der Familie auszuüben und über die Frau zu herrschen.
Zum ersten Mal in diesem Märchen wird in dieser Szene eine Gefühlsregung der Angehörigen eines Patienten beschrieben. Der König ,,weinte Tag und Nacht, dass ihm die Augen erblindeten"(Z 45). Dieses Verhalten deutet auf eine tiefe Bindung zwischen dem König und seiner Tochter hin32. Der König ist absolut nicht bereit, seine Tochter auf irgendeine Weise loszulassen. Sie soll ihm weder durch den Tod noch durch eine Hochzeit ganz genommen werden. So steht ausdrücklich da, dass der Retter ihr Gemahl wird, nicht sie zur Frau bekommt. Der König lässt nur eine Erweiterung seiner Familie zu, er übergibt die Prinzessin nicht ganz in die Hände eines anderen.
Oft berichten Märchen und andere phantastische Geschichten davon, dass der Tod durch die Liebe überwunden wird. Dies ist aber nur der Fall, wenn die Liebe des einem vom anderen erwidert wird. Die Königstochter kennt den Arzt aber vor ihrer Krankheit nicht und es wird nichts davon berichtet, dass sie sich während der Behandlung in ihn verliebt hätte. Man kann also davon ausgehen, dass seine Verliebtheit unerwidert bleibt und somit keinen Schutz gegen den Tod darstellt.
2.1.4 Im Reich des Todes
Daraufhin kündigt der Tod zu Beginn des vierten Abschnittes an, dass es mit dem Arzt ,,aus" ist (Z 54) und ,,führt(e) ihn in eine unterirdische Höhle"(Z 55-56).
In vielen Kulturen existiert das Motiv eines unterirdischen Reiches, in das die Toten gelangen. Eines der bekanntesten Beispiele stellt der Hades in der antiken Mythologie dar. Im Gegensatz zum Hades halten sich in dieser Höhle aber nicht die Seelen der Verstorbenen auf; sie ist der Aufenthaltsort der Lebenslichter.
Dem Arzt wird hier wieder eine bevorzugte Behandlung zuteil. Während die anderen
Menschen einfach sterben, wird ihm durch seinen Paten gezeigt und erklärt wann und warum Menschen sterben müssen.
2.1.4.1 Die Lebenslichter
Der Arzt entdeckt, dass hier ,,tausend Lichter in unübersehbaren Reihen" brennen (Z 56) und erfährt von seinem Gevatter, dass es sich um ,,die Lebenslichter der Menschen" handelt (Z 60). Die Größe des Lichtes gibt die Zeitspanne an, die ein Mensch noch zu leben hat, wobei sie kürzer ist, je kleiner das Licht ist (Z 60-61). Es ist also von Anfang an festgelegt, wie lange ein Mensch lebt.
Die ,,Flämmchen, [die] in beständigem Wechsel hin und her zu hüpfen" scheinen (Z 63-64), sind Symbole für den unsterblichen Teil, der Seele der Menschen oder auch der Funke des Lebens. Dieser geht nach dem Tod des Menschen nicht verloren, sondern springt auf ein neues Leben über und wird damit wiedergeboren. Das Prinzip der Wiedergeburt oder Reinkarnation33 existiert in vielen Religionen, wie beispielweise dem Buddhismus. In diesem Märchen geht das Motiv der Wiedergeburt wahrscheinlich auf Fragmente der keltischen34 Mythologie zurück. ,,Die Wiedergeburt wurde [von jedem Kelten] als selbstverständlich angenommen."35
2.1.4.2 Grenzen der Macht des Todes
Als der Arzt seinen Gevatter bittet, ihm sein eigenes Lebenslicht zu zeigen, muss er erschrocken (Z 64) feststellen, dass es ,,eben auszugehen droht(e)"(Z 63) und bittet seinen Paten ihm ein neues Licht anzuzünden, damit er sein ,,Leben genießen kann, König werde und Gemahl der schönen Königstochter"(Z 65). Auffällig ist hier die Reihenfolge der Aufzählung. Zuerst denkt er daran sein Leben zu genießen, was ein Hinweis auf seinen Egoismus ist. An zweiter Stelle kommt die Macht, das König-Sein und erst an dritter Stelle wird die Prinzessin erwähnt. Von Liebe ist allerdings nicht die Rede. Die Hochzeit ist für ihn nur Mittel zum gesellschaftlichen Aufstieg. Die Schönheit der Königstochter stellt eine willkommene Zugabe dar.
Der Tod erklärt dem Arzt, dass er dessen Leben nicht verlängern kann, denn ,,erst muss eins [der Lichter] verlöschen, eh ein neues anbrennt"(Z 66). Entgegen der bisherigen Annahme, dass der Tod bestimmen kann, wann ein Leben zu Ende ist, unterliegt er scheinbar selbst gewissen Regeln und kann die Lebensdauer eines Menschen nic ht beeinflussen.
Die Schlussfolgerung daraus wäre, dass der Arzt nicht mehr lange gelebt hätte, auch wenn er strikt nach Anweisung seines Paten gehandelt hätte. Dem widerspricht, dass der Tod dem Arzt damit droht, dass dieser stirbt, wenn er seinen Paten noch einmal um einen Toten betrügt (Z 42-43). Das bedeutet er holt ihn, bevor sein Licht unter normalen Umständen abgebrannt wäre. Außerdem bleibt unklar, wie es möglich war, dass der König weiterleben konnte, wenn sein Licht am verlöschen war. Der Arzt selbst erkennt die Möglichkeit des Todes, die Lichter zu beeinflussen. Er bittet seinen Paten in Z 66-67,,das alte [Licht] auf ein neues [zu setzen], das gleich fortbrennt, wenn jenes [alte Licht] zu Ende ist." Eine logische Erklärung wäre, dass der Tod einen Teil vom Licht des Arztes genommen und das des Königs damit verlängert hat. Dadurch wurde dem König Lebenszeit geschenkt, dem Arzt aber genommen. Die Warnung des Todes würde somit bedeuten, wenn er noch einmal einem Menschen widerrechtlich das Leben verlängert und den Tod zwingt noch mal ein Stück vom Lebenslicht des Arztes zu nehmen, würde für diesen nichts mehr übrig bleiben. Zu diesem Zeitpunkt war der Arzt noch nicht in die Geheimnisse der Lebenslichter eingeweiht, darum hat der Tod die Warnung allgemein formuliert.
Da der Arzt aber erneut gegen die Anweisung seines Paten verstoßen hat, opferte er unwissentlich sein eigenes Leben für das Leben der Königstochter. Von seinem eigenen Licht ist nun nichts mehr übrig, was es dem Tod möglich macht, sein Patenkind in sein Reich zu holen.
2.2 Verhältnis zwischen Mensch und übermenschlichen Kräften
Das vorliegenden Märchen zeigt das Verhältnis der Menschen zu den übermenschlichen Mächten Gott, Teufel und Tod auf.
Auffällig ist zunächst, dass es zwei entgegengesetzte gesellschaftliche Schichten sind, deren Umgang mit übermenschlichen Autoritäten in Der Gevatter Tod zu finden ist, nämlich die Ärmsten (verkörpert durch den armen Mann) und die Reichsten (verkörpert durch die Königsfamilie) der Bevölkerung.
Zunächst ist es der arme Mann, der sich mit Gott, Teufel und Tod auseinandersetzt. Die drei bieten sich ihm unter gleichen Umständen als Paten für sein Kind an, was verdeutlicht, dass sie keiner Hierarchie unterliegen sondern in den Augen des armen Mannes gleichgestellt sind.
Gott und Teufel bilden dabei eine Einheit. Der eine würde ohne den anderen nicht existieren, sie sind die beiden Extreme in der christlichen Religion. Für Menschen wie den armen Mann steht es außer Frage, dass man die Regeln der Kirche zu befolgen hat, sich vor dem Teufel hüten und ein gottgefälliges Leben führen muss. Zum einen begründet sich dies aus den Traditionen, die er befolgt, weil er sie von seinen Vorfahren übernommen hat. Daneben spielt auch der Aberglaube und die damit verbundene Angst vor Strafen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Von Pfarrern und anderen Predigern der Kirche werden die Menschen immer wieder davor gewarnt, dass man nach dem Tod ewig in der Hölle schmort, wenn man sein Leben nicht so gestaltet, wie es die Kirche vorschreibt.
Aber neben dieser Bedrohung nach dem Tod drohte schon der Ausschluss aus der Gesellschaft und im schlimmsten Fall die Inquisition, wenn man die Grundprinzipien der Kirche missachtete. So wurden beispielsweise schon im Mittelalter Juden verfolgt, denen man aus Misstrauen einer anderen Religion gegenüber die Schuld für alle Katastrophen (wie Überschwemmungen, Epidemien,...) anlastete. Viele Juden fielen der wütenden christlichen Bevölkerung zum Opfer, als man ihnen vorwarf, die Pest verschuldet zu haben. Man kann den Menschen vor allem vorwerfen, dass sie sich von den geistlichen Führern haben aufhetzten lassen.
Die Bibel ist auf verschiedene Arten interpretierbar und wurde sehr oft auf eine Weise ausgelegt, die aus der Distanz einiger Jahrhunderte als moralisch nicht mehr richtig erscheint. Andererseits konnten die Menschen oft nicht lesen, und selbst wenn sie es konnten, gab es nur wenige aus dem einfachen Volk, die der lateinischen Sprache, in der fast alle Texte geschrieben waren, kundig waren. Man kannte also nur das, was einem erzählt wurde und befolgte es, weil man auch nicht die Zeit und Muße hatte, sich näher mit theologischen Ideen auseinander zu setzen. Die Eltern und meist auch die Kinder mussten von früh bis spät arbeiten, um den Lebens unterhalt zu verdienen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Gott und Teufel für die einfachen Menschen als Identifikationsobjekte für gut und böse dienten. Sie waren Teil der christlichen Religion, die nicht hinterfragt wurde. Sie war eben da. Wären die alten, laut Christentum heidnischen Religionen nicht durch das Christentum verdrängt worden, würden an Stelle von Gott und Teufel andere Figuren stehen.
Der Tod hingegen hätte die gleiche Funktion. Nach eigener Aussage ist der Tod der, ,,der alle gleich macht"(Z 16), also alle Menschen bzw. Lebewesen auf die gleiche Stufe stellt, niemanden bevorzugt oder benachteiligt und somit den Anspruch erheben kann, gerecht zu sein. Andersherum betrachtet ist auch er immer gleich, egal an welche Götter die Menschen glauben, auf welchem Teil der Erde sie wohnen und in welchem Jahrhundert sie leben, am Ende sterben sie.
Der Tod ist also neutral in Bezug auf Stand und Herkunft; aber immer unumgänglich. So ist er auch in den Augen des armen Mannes der Gerechte und Neutrale zwischen den Extremen Gott und Teufel. Des weiteren steht der arme Mann dem Tod näher als Gott und Teufel (vgl. 1.1). Der Beleg dafür findet sich darin, dass der Tod die einzige der drei übermenschlichen Mächte ist, deren Aussehen näher beschrieben wird (Z 17 ,,der dürrbeinige Tod").
Die Menschen haben sich ein Bild von ihm gemacht. Meist wurde er als kleines, knochiges Männlein oder gleich als Skelett dargestellt (vgl. Deckblatt).
Anders ist das Verhältnis der Reichen zu den drei Mächten. In Der Gevatter Tod ist es der König, der die reiche Bevölkerungsschicht symbolisiert. Im Gegensatz zum armen Mann mit seinen mindestens 13 Kindern hat er nur eine einzige Tochter. Durch bessere Lebensbedingungen hat die wohlhabende Bevölkerung nicht so intensiven Kontakt mit dem Tod. (Die Sterblichkeitsrate war aber auch bei den oberen Bevölkerungsschichten verglichen mit den Verhältnissen in Europa heutzutage sehr hoch) Im Gegensatz zum König stellt jedes Kind für die kinderreiche Familie des armen Mannes auch eine große finanzielle Belastung dar. Aus diesen Gründen ist es verständlich, dass der König sehr betroffen reagiert, als die Königstochter vom Tod bedroht wird. Für ihn ist der Tod der böse, der ihm sein Kind rauben will. Aber auch er stellt die Macht Gottes nicht über die des Todes. Er weint um seine Tochter, und betet nicht zu Gott um ihre Genesung.
3 Schlussbemerkungen
3.1 Offene Fragen
Offen bleibt allerdings die Frage warum der Trick des Arztes, die Kranken umzudrehen und ihnen dann das Kraut zu geben, funktioniert.
Eine mögliche Erklärung findet sich in einem alten Volksglauben. Nach diesem nimmt der Schutzengel des Kindes nach der Taufe seinen Platz am Kopfende der Wiege ein.36 Unter der Vorraussetzung, dass der Schutzengel immer beim Kopf des Menschen steht bzw. über diesem schwebt und über seinen Menschen wacht, kann der Tod diesen Menschen nur mitnehmen, wenn er sich von der nichtbewachten Seite aus, also von den Füßen her, nähert. Damit ist noch immer nicht geklärt, was das Kraut bewirkt. Wahrscheinlich ist, dass es sich um eine Medizin handelt, die alle körperlichen Krankheiten heilen kann, aber nur, wenn der Mensch ohnehin überlebt hätte. Sie ist nur dazu da, um den Heilungsprozess zu beschleunigen, ähnlich wie man heute Medikamente einnimmt, um eine Erkältung nicht erst nach einer Woche sondern nach drei Tagen loszuwerden.
3.2 Reichtum und Charakter
Seit dem Mittelalter wurden gerade in der Medizin große Fortschritte gemacht. Das durchschnittliche Lebensalter ist heutzutage wesentlich höher. Der Tod ist vor allem in den westlichen Industriestaaten etwas, mit dem sich viele Menschen kaum auseinandersetzen, weil er nicht mehr so alltäglich und vertraut ist, wie er es vor einigen Jahrhunderten war.
Anders verhält es sich mit dem Reichtum und der Frage, ob dieser den Charakter verdirbt. Der Arzt erlangt großen Reichtum, was zur Folge hat, dass er nach immer mehr Besitz und Macht strebt. Durch diesen übermäßigen Ehrgeiz lässt er sich zum Ungehorsam verführen, was ihm schließlich zum Verhängnis wird. Der arme Vater hingegen hat für solche Gedanken keinerlei Motivation, er muss sehen, wie es seine Familie mit dem Nötigsten versorgen kann. Aber aufgrund dieser Armut werden Neid und Vorurteile (beispielweise gegen Gott) aufgebaut.
Zusammenfassend ist die wahrscheinlich einzig wahre Antwort auf die oben gestellte Frage das folgende Zitat:
Vielleicht verdirbt Geld den Charakter auf keinen Fall aber macht der Mangel an Geld ihn besser.
4 Anhang
4.1 Text - Der Gevatter Tod
Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder und musste Tag und Nacht arbeiten, damit er ihnen nur Brot geben konnte. Als nun das dreizehnte zur Welt kam, wusste er sich seiner Not nicht zu helfen, lief hinaus auf die große Landstraße und wollte den ersten, der ihm begegnete, zu Gevatter bitten. Der erste, der ihm begegnete, das war der liebe Gott, der wusste schon, was er auf dem Herzen hatte, und sprach zu ihm: ,,Armer Mann, du dauerst mich, ich will dein Kind aus der Taufe heben, will für es sorgen und es glücklich machen auf Erden." Der Mann sprach: ,,Wer bist du?" - ,,Ich bin der liebe Gott." - ,,So begehr ich dich nicht zu Gevatter", sagte der Mann, ,,du gibst dem Reichen und lässest den Armen hungern." Das sprach der Mann, weil er nicht wusste, wie weislich Gott Reichtum und Armut verteilt. Also wendete er sich von dem Herrn und ging weiter.
Da trat der Teufel zu ihm und sprach: ,,Was suchst du? willst du mich zum Paten deines Kindes nehmen, so will ich ihm Gold die Hülle und Fülle und alle Lust der Welt dazu geben."Der Mann fragte: ,,Wer bist du?" - ,,Ich bin der Teufel." - ,,So begehr ich dich nicht zum Gevatter", sprach der Mann, ,,du betrügst und verführst die Menschen." Er ging weiter, da kam der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten und sprach: ,,Nimm mich zu Gevatter." Der Mann fragte: ,,Wer bist du?" - ,,Ich bin der Tod, der alle gleichmacht." Da sprach der Mann: ,,Du bist der rechte, du holst den Reichen wie den Armen ohne Unterschied, du sollst mein Gevattersmann sein." Der Tod antwortete: ,,Ich will dein Kind reich und berühmt machen, denn wer mich zum Freunde hat, dem kann's nicht fehlen." Der Mann sprach: ,,Künftigen Sonntag ist die Taufe, da stelle dich zu rechter Zeit ein."
Der Tod erschien, wie er versprochen hatte, und stand ganz ordentlich Gevatter.
Als der Knabe zu Jahren gekommen war, trat zu einer Zeit der Pate ein und hießihn mitgehen. Er führte ihn hinaus in den Wald, zeigte ihm ein Kraut, das da wuchs, und sprach: ,,Jetzt sollst du dein Patengeschenk empfangen. Ich mache dich zu einem berühmten Arzt. Wenn du zu einem Kranken gerufen wirst, so will ich dir jedes Mal erscheinen; steh ich zu Häupten des Kranken, so kannst du keck sprechen, du wolltest ihn wieder gesund machen, und gibst du ihm dann von jenem Kraut ein, so wird er genesen; steh ich aber zu Füßen des Kranken, so ist er mein, und du musst sagen, alle Hilfe sei umsonst und kein Arzt in der Welt könne ihn retten. Aber hüte dich, dass du das Kraut nicht gegen meinen Willen gebrauchst, es könnte dir schlimm ergehen."
Es dauerte nicht lange, so war der Jüngling der berühmteste Arzt auf der ganzen Welt. ,,Er braucht nur den Kranken anzusehen, so weißer schon, wie es steht, ob er wieder gesund wird oder ob er sterben muss", so hießes von ihm, und weit und breit kamen die Leute herbei, holten ihn zu den Kranken und gaben ihm so viel Gold, dass er bald ein reicher Mann war. Nun trug es sich zu, dass der König erkrankte; der Arzt ward berufen und sollte sagen, ob Genesung möglich wäre. Wie er aber zu dem Bette trat, so stand der Tod zu den Füßen des Kranken, und da war für ihn kein Kraut mehr gewachsen.
,,Wenn ich doch einmal den Tod überlisten könnte", dachte der Arzt, ,,er wird's freilich übel nehmen, aber da ich sein Pate bin, so drückt er wohl ein Auge zu; ich will's wagen." Er fasste also den Kranken und legte ihn verkehrt, so dass der Tod zu Häupten desselben zu stehen kam. Dann gab er ihm von dem Kraute ein, und der König erholte sich und ward wieder gesund. Der Tod aber kam zu dem Arzte, machte ein böses und finsteres Gesicht, drohte mit dem Finger und sagte: ,,Du hast mich hinter das Licht geführt; diesmal will ich dir's nachsehen, weil du mein Pate bist, aber wa gst du das noch einmal, so geht dir's an den Kragen, und ich nehme dich selbst mit fort."
Bald hernach verfiel die Tochter des Königs in eine schwere Krankheit. Sie war sein einziges Kind, er weinte Tag und Nacht, dass ihm die Augen erblindeten, und ließbekannt machen, wer sie vom Tode errettete, der sollte ihr Gemahl werden und die Krone erben. Der Arzt, als er zu dem Bette der Kranken kam, erblickte den Tod zu ihren Füßen. Er hätte sich der Warnung seines Paten erinnern sollen, aber die große Schönheit der Königstochter und das Glück, ihr Gemahl zu werden, betörten ihn so, dass er alle Gedanken in den Wind schlug. Er sah nicht, dass der Tod ihm zornige Blicke zuwarf, die Hand in die Höhe hob und mit der dürren Faust drohte; er hob die Kranke auf, und legte ihr Haupt dahin, wo die Füße gelegen hatten. Dann gab er ihr das Kraut ein, und alsbald röteten sich ihre Wangen, und das Leben regte sich von neuem.
Der Tod, als er sich zum zweitenmal um sein Eigentum betrogen sah, ging mit langen Schritten auf den Arzt zu und sprach: ,,Es ist aus mit dir, und die Reihe kommt nun an dich", packte ihn mit seiner eiskalten Hand so hart, dass er nicht widerstehen konnte, und führte ihn in eine unterirdische Höhle. Da sah er, wie tausend und tausend Lichter in unübersehbaren Reihen brannten, einige groß, andere halbgroß, andere klein.
Jeden Augenblick verloschen einige, und andere brannten wieder auf, also dass die Flämmchen in beständigem Wechsel hin und her zu hüpfen schienen. ,,Siehst du", sprach der Tod, ,,das sind die Lebenslichter der Menschen. Die großen gehören Kindern, die halbgroßen Eheleuten in ihren besten Jahren, die kleinen gehören Greisen. Doch auch Kinder und junge Leute haben oft nur ein kleines Lichtchen." - ,,Zeige mir mein Lebenslicht", sagte der Arzt und meinte, es wäre noch recht groß. Der Tod deutete auf ein kleines Endchen, das eben auszugehen drohte, und sagte: ,,Siehst du, da ist es." - ,,Ach, lieber Pate", sagte der erschrockene Arzt, ,,zündet mir ein neues an, tut mir's zuliebe, damit ich meines Lebens genießen kann, König werde und Gemahl der schönen Königstochter." - ,,Ich kann nicht", antwortete der Tod, ,,erst muss eins verlöschen, eh ein neues anbrennt." - ,,So setzt das alte auf ein neues, das gleich fortbrennt, wenn jenes zu Ende ist", bat der Arzt. Der Tod stellte sich, als ob er seinen Wunsch erfüllen wollte, langte ein frisches großes Licht herbei; aber weil er sich rächen wollte, versah er's beim Umstecken absichtlich, und das Stückchen fiel um und verlosch. Alsbald sank der Arzt zu Boden und war nun selbst in die Hand des Todes geraten
4.2 Quellen; Internetseiten
Quelle : http://sungaya.de/schwarz/kelten/keltreligion.htm
Quelle : http://sungaya.de/schwarz/kelten/kelten.htm
5 Literaturverzeichnis
- Ahrndt, Susanne; Geburt und Taufe feiern, Planung und Festgestaltung; Falken; 1993
- Bastian, Ulrike; Die ,,Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm in der Literaturpädagogischen Diskussion des 19. und 20.Jahrhunderts; Studien zur Kinder- und Jugendmedienforschung, Band 8; Haag und Herchen; o.J.
- Hark, Helmut; Der Gevatter Tod, Ein Pate fürs Leben; Kreuz-Verlag; 1986
- Lebensalltag im Mittelalter; Verla g Das Beste GmbH, Stuttgart; 1995
- Horn, Katalin; Bilder des Todes in der Dichtung Märchen und in der Märchendichtung; aus Tod und Wandel im Märchen, Nachmittagsvorträge und Referate zum Internationalen Märchenkongreß der Europäischen Märchengesellschaft in Salzburg 14.-17.9.1989; Salzburger Landesinstitut für Volkskunde; 1990
- Van Rinsum, Annemarie und Wolfgang; Interpretation Kurzprosa; Bayrischer SchulbuchVerlag, München; 1982
- Das moderne Fremdwörterlexikon; Naumann und Göbel Verlagsgesellschaft GmbH;o.J.
- Kindlers neues Literaturlexikon; Bd.6; Kindler Verlag GmbH; München
- http://sungaya.de/schwarz/kelten/kelten.htm
Text Der Gevatter Tod entnommen aus : Kinder- und Hausmärchen; Gesammelt durch die Brüder Grimm; Aufbau-Verlag Berlin und Weimar; 1979
Titelbild entnommen aus: Tod und Wandel im Märchen, Nachmittagsvorträge und Referate zum Internationalen Märchenkongreß der Europäischen Märchengesellschaft in Salzburg 14.- 17.9.1989; Salzburger Landesinstitut für Volkskunde; 1990
Ich erkläre hiermit, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benützt habe.
Unterschleißheim, den 29.1.2002
[...]
1 vgl. Lebensalltag im Mittelalter; S.132
2 vgl. Lebensalltag im Mittelalter; S.132
3 K. Horn; S.45
4 im Folgenden KHM genannt
5 zitiert nach K. Horn; S.45
6 Nach Van Rimsen, A. u. W.; Interpretationen Kurzprosa; S.97 und U.Bastian; KHM in der lit.päd. Diskus. d. 19.u.20. Jhd, S.5
7 vgl. U.Bastian; KHM in der lit.päd. Diskus. d. 19.u.20. Jhd; S.15
8 vgl. Van Rimsen, A. u. W.; Interpretationen Kurzprosa; S.97
9 vgl. U.Bastian; KHM in der lit.päd. Diskus. d. 19.u.20. Jhd; S.7
10 vgl. U.Bastian; KHM in der lit.päd. Diskus. d. 19.u.20. Jhd; S.6
11 Vgl. U.Bastian; KHM in der lit.päd. Diskus. d. 19.u.20. Jhd; S.17
12 nach Kindlers Lit.lexikon; Bd.6; S.915
13 vgl. Van Rimsen, A. u. W.; Interpretationen Kurzprosa; S.97
14 die kursiven Zeilenangaben beziehen sich auf den im Anhang beigefügten Text
15 vgl. Van Rimsen, A. u. W.; Interpretationen Kurzprosa; S.97
16 nach Kindlers Lit.lexikon; Bd.6; S. 915
17 vgl. H. Hark; Der Gevatter Tod; S.79
18 vgl. Kindlers Lit.lexikon; Bd.6; S.914
19 vgl. Kindlers Lit.lexikon; Bd.6; S. 915
20 Vgl. Kindlers Lit.lexikon; Bd.6; S.915
21 Das Wort Pate leitet sich von dem lateinischen Ausdruck pater spiritualis ab und kann mit geistlicher Vater oder auch Mitvater übersetzt werden, was dem altdeutschen Wort Gevatter entspricht. ( nach S. Ahrndt; Geburt und Taufe feiern; S.67)
22 nach S. Ahrndt; Geburt und Taufe feiern; S.67
23 vgl. H. Hark; Der Gevatter Tod; S.33
24 vgl. ,,Kästchenmotiv" in Faust I: Gretchen wird durch den Schmuck erst zu Ungehorsam der Mutter gegenüber verführt (behält das zweite Kästchen, ohne der Mutter etwas davon zu erzählen) und wird durch den Charme und die vermeintliche Großzügigkeit Fausts zur Unkeuschheit verführt
25 vgl. Lebensalltag im Mittelalter; S.72
26 vgl. Van Rimsen, A. u. W.; Interpretationen Kurzprosa; S.97
27 vgl. H. Hark; Der Gevatter Tod, S.51
28 Der Stein der Weisen eine geheimnisvolle Substanz mit deren Hilfe man einerseits Metalle in Gold umwandeln kann und die andererseits eine verjüngende Wirkung hat, alle Krankheiten heilen kann und somit ewiges Leben spendet. Es ist nicht belegbar, dass es jemals gelungen ist ihn herzustellen.
29 Alchemie bezeichnet die vor allem im Mittelalter betriebene universalwissenschaftliche Beschäftigung mit chemischen Stoffen (nach Duden; Das neue Lexikon; Band 1; S.98)
30 vgl. H. Hark; Der Gevatter Tod; S.84
31 Vgl. H. Hark; Der Gevatter Tod; S.84
32 vgl. H. Hark; Der Gevatter Tod; S.85
33 Eintritt der Seele in einen anderen Körper nach dem Tode (vgl. Naumann & Göbel; Das moderne Fremdwörterlexikon; S.479)
34,,Die Kelten, eine indogermanische Völkergruppe, besiedelten in älterer Zeit Süd- und
Südwestdeutschland, ehe sie wegen den nachdrängenden Germanen weiter nach Westeuropa und den britischen Inseln zogen." (vgl. http://sungaya.de/schwarz/kelten/kelten.htm)
35 vgl. http://sungaya.de/schwarz/kelten/keltreligion.htm
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Der Gevatter Tod"?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Der Schwerpunkt liegt auf dem Märchen "Der Gevatter Tod" der Brüder Grimm.
Was sind die Hauptthemen des Märchens "Der Gevatter Tod"?
Zu den Hauptthemen gehören das Leben im Mittelalter, die allgegenwärtige Präsenz des Todes in Märchen, die Definition des Märchens als literarische Gattung, die Rollen von Figuren (Gott, Teufel, Tod, armer Mann, Arzt, König, Königstochter), Sprache und Struktur des Märchens, die Suche nach einem Taufpaten und die Beziehung zwischen Mensch und übermenschlichen Kräften.
Wer sind die Hauptfiguren in "Der Gevatter Tod"?
Die Hauptfiguren sind ein armer Mann, der einen Taufpaten für sein dreizehntes Kind sucht, Gott, der Teufel, der Tod (als Gevatter), der Arzt (Sohn des armen Mannes), der König und die Königstochter.
Was ist die Rolle des Todes in dem Märchen?
Der Tod wird als Pate des Sohnes des armen Mannes gewählt. Er vermittelt dem Sohn (Arzt) Wissen über ein Kraut, das Kranke heilen kann, jedoch nur, wenn der Tod es erlaubt. Der Tod symbolisiert Gerechtigkeit und Unvermeidlichkeit.
Warum lehnt der arme Mann Gott und den Teufel als Paten ab?
Der arme Mann lehnt Gott ab, weil er ihn für ungerecht in der Verteilung von Reichtum hält. Er lehnt den Teufel ab, weil er ihn als Betrüger und Verführer ansieht.
Wie wird der Arzt berühmt und reich?
Der Arzt wird berühmt und reich, indem er das Wissen über das Kraut, das er vom Tod erhalten hat, nutzt, um Kranke zu heilen. Er hält sich zunächst an die Regeln seines Gevatters, des Todes.
Wie verstößt der Arzt gegen die Regeln des Todes?
Der Arzt verstößt gegen die Regeln des Todes, indem er den König und die Königstochter heilt, obwohl der Tod am Fußende ihres Bettes steht, was bedeutet, dass sie sterben sollen. Er manipuliert die Situation, um es so aussehen zu lassen, als ob er sie rechtmäßig heilt.
Was sind die Konsequenzen des Betrugs des Arztes?
Nach dem zweiten Betrug (Heilung der Königstochter) holt der Tod den Arzt in sein Reich und zeigt ihm die Lebenslichter der Menschen. Der Arzt erkennt, dass sein eigenes Licht fast erloschen ist. Da er die Regeln des Todes missachtet hat, stirbt auch der Arzt.
Was symbolisieren die Lebenslichter im Reich des Todes?
Die Lebenslichter symbolisieren die Lebensdauer jedes Menschen. Die Größe des Lichtes gibt die Zeitspanne an, die ein Mensch noch zu leben hat.
Welche Bedeutung hat das Märchen im Bezug auf das Mittelalter?
Das Märchen reflektiert die Lebensbedingungen und die Vorstellungswelt der Menschen im Mittelalter, insbesondere ihren Umgang mit Krankheit, Tod, Armut, Reichtum und den Glauben an übernatürliche Kräfte.
Wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und übernatürlichen Kräften dargestellt?
Das Märchen zeigt die Auseinandersetzung des Menschen mit Gott, Teufel und Tod. Der Tod wird als neutral und unvermeidlich dargestellt, während Gott und Teufel eher als gegensätzliche Kräfte im christlichen Kontext wahrgenommen werden. Der arme Mann wählt den Tod als Pate, weil er ihn als gerecht und unparteiisch ansieht.
Was sind die offenen Fragen, die der Text aufwirft?
Offen bleibt die Frage, warum der Trick des Arztes, die Kranken umzudrehen, funktioniert. Außerdem wird die Rolle des Krauts in Frage gestellt, ob es nur bei Menschen wirkt die ohnehin überlebt hätten.
Welche Aussage trifft der Text über Reichtum und Charakter?
Der Text deutet an, dass Reichtum den Charakter verderben kann, da der Arzt durch seinen Reichtum übermütig wird und gegen die Regeln des Todes verstößt. Gleichzeitig wird betont, dass Armut auch negative Auswirkungen haben kann, wie Neid und Vorurteile.
- Quote paper
- Kes Weidner (Author), 2002, Grimm, Gebrüder - Der Gevatter Tod - Märchenanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105950