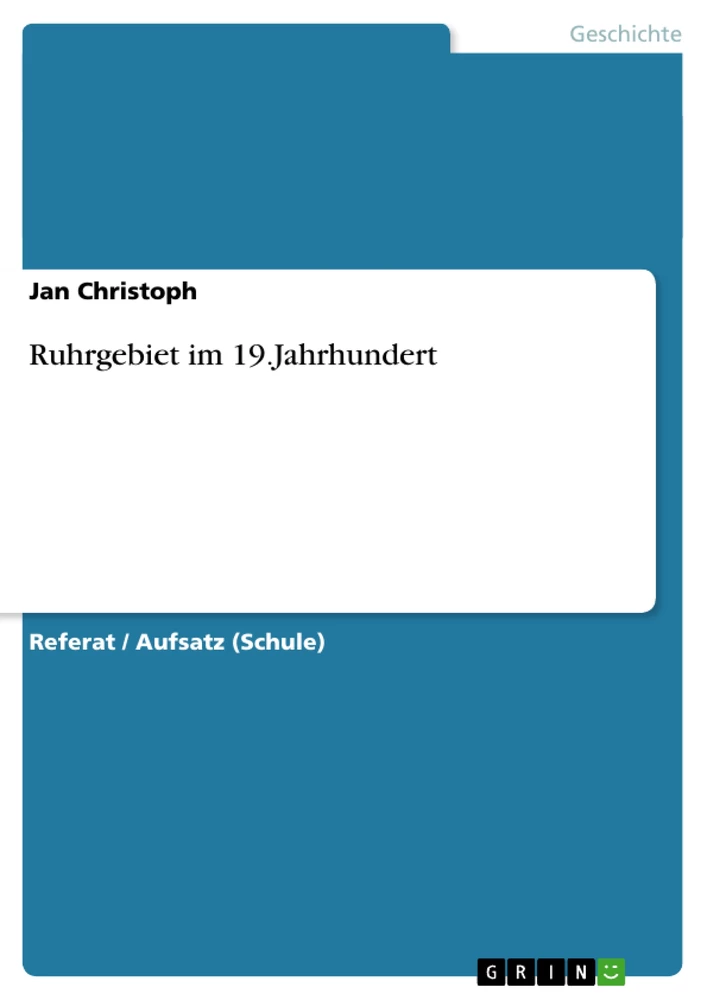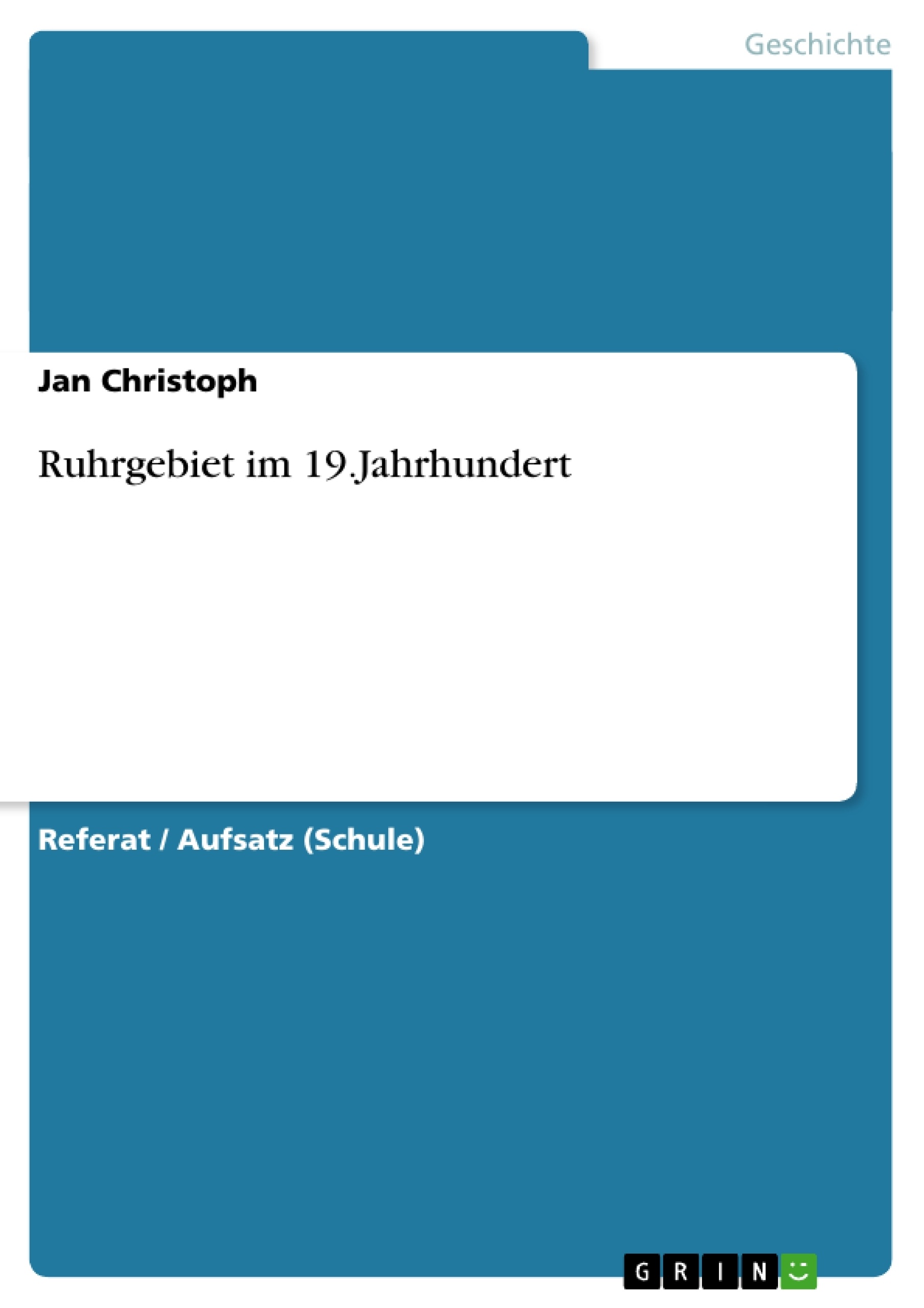Enthüllen Sie die faszinierende Geschichte des Ruhrgebiets im 19. Jahrhundert, einer Region, die sich von einer unscheinbaren Landschaft zu einem pulsierenden Zentrum der industriellen Revolution entwickelte. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der kleine Dörfer wie Essen und Duisburg zu blühenden Industriestädten heranwuchsen, während der Bergbau und die Eisenverarbeitung die Landschaft und das Leben der Menschen für immer veränderten. Erforschen Sie die komplexen sozialen Dynamiken zwischen Unternehmern, Arbeitern und dem Staat, von den Anfängen der preußischen Reformen bis zur Hochindustrialisierung um 1870-1914. Entdecken Sie die bahnbrechenden Erfindungen und technologischen Fortschritte, wie die Dampfmaschine und das Bessemer-Verfahren, die das Ruhrgebiet zu einem Vorreiter der industriellen Innovation machten. Verfolgen Sie, wie der Kohleabbau und die Stahlproduktion die Region prägten und gleichzeitig soziale Spannungen und Arbeiterbewegungen hervorriefen. Lernen Sie die einflussreichen Persönlichkeiten kennen, wie Krupp und Grillo, die mit Mut, Geschick und Risikobereitschaft ganze Industrie-Imperien aufbauten und gleichzeitig mit den sozialen Folgen des rapiden Wandels konfrontiert wurden. Erfahren Sie, wie der Bau der Eisenbahn und die Erschließung der Ruhr als Transportweg die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigten und das Ruhrgebiet mit dem Rest Deutschlands und der Welt verbanden. Diese fesselnde Darstellung beleuchtet nicht nur die wirtschaftliche Transformation, sondern auch die sozialen und politischen Umwälzungen, die das Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert erlebte, und bietet ein tiefes Verständnis für die Wurzeln der modernen Industriegesellschaft. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Zeit und erleben Sie, wie das Ruhrgebiet zu dem industriellen Kraftzentrum wurde, das es heute ist, und wie seine Geschichte bis heute nachwirkt. Das Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert ist eine Geschichte von Innovation, Wachstum, sozialem Wandel und dem unaufhaltsamen Aufstieg einer Industrieregion, die Europa und die Welt veränderte, von den Anfängen des Kohleabbaus bis hin zu den komplexen Montankonzernen. Die Industrialisierung, die soziale Frage, die Rolle des Staates und die Lebensbedingungen der Arbeiter werden ebenso beleuchtet wie die technischen Errungenschaften und die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die das Ruhrgebiet zu einem einzigartigen Fallbeispiel der industriellen Revolution machen.
Inhalt:
I: Lage und Bevölkerung des Ruhrgebiets (bis 1800)
II: Allgemeine Voraussetzungen für die Industrialisierung in Deutschland
III: Besondere Bedingungen im Ruhrgebiet
IV: Industrialisierung im Ruhrgebiet (1830-1914)
V: Das Verhältnis zwischen Unternehmer, Arbeiter und Staat (1848-1914)
VI: Hochindustrialisierung (1870-1914)
VII: Quellenangaben
Anmerkung: Das Thema „Ruhrgebiet im 19.Jahrhundert“ ist sehr vielfältig und beinhaltet zahlreiche andere, weshalb ich mich vor allem auf das Ruhrgebiet hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Bedeutung bzw. Entwicklung konzentriert habe.
Die kursiven Zeitangaben sollen eher der groben Orientierung als der absoluten Gliederung dienen, da z.B. die Industrialisierung aus mehreren nicht parallel oder nacheinander ablaufenden Entwicklungen besteht, deren Verlauf zeitlich nicht eindeutig bestimmen werden kann.
Der Begriff „Deutschland“ bezieht sich auf das Gebiet, welches innerhalb der Grenzen des Deutschen Bundes liegt.
I. Lage des Ruhrgebiets und Angaben zur Bevölkerung:
Am Anfang des 19.Jahrhunderts sah es nicht so aus, als ob die Niederungen von Ruhr, Emscher und Lippe die größte Montanregion Europas werden würden. In der Wende vom 18. zum 19.Jhd lebten weniger als 300.00 Menschen auf dem Gebiet des heutigen Ruhrgebiets. Die größte Stadt war Duisburg mit 5300 Einwohnern. Mülheim hatte etwa 5000 Einwohner und war damit größer als Essen mit 4500 Menschen. Bochum mit knapp 2100 Einwohnern war kleiner als Bottrop mit 2200. Gelsenkirchen mit 500 oder Herne mit 750 Einwohnern waren eher Dörfer als Städte und damit mit den Städten des Rheinlandes, wie z.B. Köln oder Krefeld, oder gar Frankfurt und Berlin nicht zu vergleichen.
Man konnte auch noch nicht den Begriff der „Region“, also einem Raum mit besonderen politischen, historischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Verflechtungen, auf das Ruhrgebiet anwenden, denn seine politische und verwaltungstechnische Struktur war bis zum Wiener Kongreß zu uneinheitlich. Es setzte sich aus der Grafschaft Mark, dem Herzogtum Berg, dem preußischen Westfalen und mehreren kleineren Besitzungen zusammen. Diese etwa 10 Herrschaftsbereiche hatten keine einheitliche Maße, Gewichte, Zölle, Rechtsnormen oder Gewerbeverordnungen.
Bergbau wurde zur Deckung des Eigenbedarfs in den Wäldern um Duisburg und Essen betrieben, in etwas größerem Maßstab auch in der Gegend um Witten.
II. Allgemeine Bedingungen bzw. Voraussetzungen für die Industrialisierung in Deutschland (1800 bis 1830):
Am Anfang des 19.Jhd. lebten ca. 4/5 der deutschen Bevölkerung von und in der Landwirtschaft und waren recht arm. Die Bauern lebten in Feudalherrschaft, waren also vom Adel abhängig und mußten meist Frondienste für ihre Gutsherren leisten. Preußische Reformen bewirkten eine Beseitigung der Leibeigenschaft für eine bestimmte einmalige Abgabe. Diese konnten jedoch nicht alle Bauern aufbringen, sodass zahlreiche ihre Höfe aufgaben, welche dann aufgekauft und zu Großbetrieben zusammengeschlossen wurden, und in die Städte abwanderten, in der Hoffnung dort Arbeit zu finden, was bedeutete, dass für die zukünftigen Fabriken genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen („Industrielle Reservearmee“). Noch am Ende des 18.Jhd gab es etwa 1800 Zollschranken, welche den Handel stark hemmten. Die unterschiedlichen Gewichts-, Münz- und Maßeinheiten (siehe oben) stellten eine weitere Einschränkung für den Warenverkehr dar. 1818 kam es zur Beseitigung der preußischen Binnenzölle. 1828 wurde der preußisch-hessische und gleichzeitig der süd- und mitteldeutsche Zollverein gebildet. Bis zum Jahre1854 waren alle dt. Staaten diesem Zollverein beigetreten (bis 1888 auch Hamburg und Bremen). Später wurden auch Zoll- und Handelsverträge mit dem Ausland geschlossen. Nachdem in Preußen Gilde und Zünfte aufgelöst wurden, trat die staatliche Gewerbeaufsicht an Stelle der Selbstverwaltung der Zünfte und ihrer mittelalterlichen Traditionen.
Zu Beginn der Industrialisierung behinderte ein Kapitalmangel die industrielle Entwicklung Deutschlands, da nur wenige Privatbanken existierten, welche Kapital für die Industrie zur Verfügung stellen konnten, sodass diese auf Eigenfinanzierung angewiesen war. Eine Änderung vollzog sich mit dem Bau der Eisenbahn, da alle privaten Eisenbahngesellschaften Aktiengesellschaften bildeten, wodurch das Börsengeschäft einen Aufschwung erlebte, was bedeutete, dass das Kapital eines Unternehmers für den Bau einer Fabrik nicht mehr durch sein eigenes Vermögen beschränkt war, sondern, dass er mit anderen Geldgebern eine Aktiengesellschaft gründen konnte, sodass auch größere Investitionen möglich wurden.
Das „Allgemeine Preußische Landrecht“ schaffte 1784 eine einheitliche Gewerbeordnung und regelte verbindlich Straf- und Zivilrecht sowie Fragen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts. Es schaffte Folter und Ämterkauf ab und setzte die Gewaltenteilung durch, was Rechtssicherheit, die für den Handel von größter Bedeutung ist, für den einzelnen Bürger schuf.
Arbeitskräfte, Kapital und Rechtssicherheit, -Grundvorraussetzungen für die Industrialisierung-, waren nun in einigen Teilen Deutschlands (vor allem in Preußen) vorhanden.
Warum diese aber im Ruhrgebiet früher (1830) als im restlichen Deutschland (1840 vgl. GB 9.Klasse,S 156) begann, zeigt III.
III. Besondere Bedingungen bzw. Voraussetzungen im Ruhrgebiet:
Kohle, eine Quelle des späteren wirtschaftlichen Wohlstandes, wurde bereits im 13. Jahrhundert genutzt. Mit der Erschließung der Ruhr als Schiffahrtsweg Ende des 18.Jhd wurde auch die Verkehrsinfrastruktur verbessert. Obwohl die Schiffahrt nur 7 Monate im Jahr möglich war, war sie dem Transport zu Lande mit Pferde- und Maultierkarawanen deutlich überlegen. 1748 lieferte das Ruhrgebiet schon Kohle in die Niederlanden und in die Schweiz. Wie wichtig die Ruhr für die Industrialisierung war, zeigt sich daran , dass selbst noch im Jahr 1850 fast 45% der Kohleförderung über die Ruhr verschifft wurden, womit diese einer der am dichtesten befahrenen Flüsse Deutschlands war.
Die Erfindung der Dampfmaschine war von großer Bedeutung, was man daran sehen kann, dass schon 1801 in der Zeche Vollmund in Bochum die erste Dampfmaschine im Ruhrgebiet installiert wurde, da sich nur so die unterirdischen Wasserzuflüssen bewältigen ließen. 1808 wurde ein Tiefe von 46m erreicht, 1837 schon 130m. Der nun mögliche Tiefbau bewirkte von 1815 bis 1830 eine Verdoppelung der Kohleförderung.
Die Entwicklung der Eisenindustrie gestaltete sich schwieriger als die des Bergbaus, da die einheimischen Erze sich nur bedingt zur Verhüttung eigneten und dazu teure Holzkohle verwendet werden mußte, weil die bis dahin zugängliche Magerkohle des Ruhrgebiets nur schwer verkokt werden konnte. In der Zeit zwischen 1811 und 1828 wurden die wichtigsten eisenschaffenden Betriebe des Ruhrgebiets gegründet, in England schon erprobte Verfahren der Stahlerzeugung nachgeahmt oder nacherfunden. Neben der Stahlerzeugung gewann auch der Maschinenbau immer mehr an Bedeutung.
Mit dem Wiener Kongreß von 1815 vereinigte sich die rheinische und die westfälische Geschichte zur der des Ruhrgebiets. Die preußische Herrschaft teilte das spätere Ruhrgebiet in seine noch heute bestehenden Verwaltungseinheiten ein. Die preußische Bergordnung stellte die Zechen unter staatliche Leitung, die Eigentumsverhältnisse blieben jedoch unangetastet, der Staat hatte die Oberaufsicht. Ein wichtiger Bestandteil der Bergordnung war die Erhebung des Bergmannes in einen bevorzugten Stand, in welchem er preußischer Beamter war und keinen Kriegsdienst leisten mußte. Damit versuchte sich der preußische Staat die Loyalität der Bergleute zu sichern.
Bis 1830 war die alte Kulturlandschaft an Emscher und Ruhr von der Industrialisierung noch weitgehend unberührt. Die Kleinzechen im Ruhrgebiet hatten noch wenig ökonomische Bedeutung, da die Industriearbeiter nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachten. Die meiste Arbeit war noch landwirtschaftlich geprägt und die Industrie konnte ihre Arbeiter aus der ansässigen Bevölkerung rekrutieren, die noch in ihren dörflichen Strukturen lebte.
IV. Industrialisierung im Ruhrgebiet : Beginn 1830-1848:
Um 1830 waren technologisch und infrastrukturell die Grundbedingungen zur Industrialisierung erfüllt: auf der Ruhr läßt sich der Transport von Gütern aller Art bewerkstelligen, das Puddelverfahren erlaubt erstmals die massenhafte Produktion von Stahl. Man konnte nicht nur ertragreichere Flöze ausbeuten, sondern auch die für die Verkokung besonders gut geeignete und daher bevorzugte Fettkohle fördern. Dies war von entscheidender Bedeutung, da dies die Verbindung von Kohle und Eisen bedeutete. 1839 überschritt die Kohleförderung erstmals die Millionentonnengrenze, 1858 waren es schon 2 Millionen Tonnen. Aus dem Nebenerwerb von Bauern und Handwerkern war eine Industrie geworden, was auch die Bevölkerung bis 1871 auf 1 Million ansteigen ließ.
Schon in der Frühphase der Industrialisierung zeigte sich das beherrschende Merkmal der Ruhrindustrie: der Montankonzern, der versucht seine Rohstoffbasis durch eigene Zechen zu sichern. Ein Beispiel ist der Gute-Hoffnung-Hütte Franz Haniels (GHH). Langsam begann das Revier seinen technischen Rückstand gegenüber England aufholen. 1839 wurde von der GHH die erste Dampflokomotive deutscher Produktion gebaut. 1843 wurde die „Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft“ konzipiert, die den Bau einer Eisenbahn durch das Emschertal plante. 1847 wird der Betrieb von Duisburg nach Dortmund aufgenommen. Die Erschließung des Ruhrgebiets erfolgte hauptsächlich Richtung Ost-West und war bis 1862 weitgehend abgeschlossen.
1848-1870:
Die Ruhrzechen wurden ausgebaut und erreichten immer größere Tiefen. Um die Versorgung des Bergmannes mit frischer Luft zu sichern, wurden die ersten Wetterschächte errichtet. Die Beförderung der Kohlen erfolgte mit Loren, die z.B. mit Grubenpferden gezogen wurden. Es entstanden die ersten Malakoff-Türme, deren bis zu zwei Meter dicken Mauern die Kräfte abfangen sollten, die durch den Transport schwerer Lasten bei Seilfahrt und Förderung entstanden und deren architektonisches Aussehen repräsentative Züge bekam, was von einem gestiegenem Selbstbewußtsein ihrer Besitzer zeugte. Die Erfindung des Bessemer-Verfahrens in England ermöglichte eine größere Stahlproduktion in kürzerer Zeit. Da sich allerdings die Erze des Ruhrgebiets aufgrund ihres hohen Phosphorgehalts nur schlecht für dieses Verfahren eigneten, wurde es notwendig, größere Mengen Erz zu importieren, was Krupp auch als erster tat.
Die Sicherheit unter Tage erfuhr ebenfalls eine Entwicklung, was z.B. an der Erfindung der ölbetriebenen Sicherheitslampe 1858 zu sehen ist, die den Bergmann vor „schlagenden Wettern“ (durch offenes Feuer ausgelöste Gasexplosionen) schützen sollte. Außerdem wurden für die Seilfahrt reißfeste Stahlseile verwendet.
V. Die Lebensbedingungen sowie die Verhältnisse zwischen Arbeiter, Unternehmer und Staat:
1848-1870:
Der preußische Staat zog sich aus der staatlichen Verwaltung der Kohlegruben zurück, was für den Bergmann bedeutete, dass er ab 1861 kein preußischer Beamter mehr war. Stattdessen mußte er seinen Arbeitsvertrag direkt mit dem Unternehmer aushandeln und sank seinem Verständnis nach auf das Niveau eines Industriearbeiters herab. Der Rückzug des Staates aus der Aufsicht über die Gruben führte zu Überproduktion und Konkurrenzdruck. Ab 1865 kam es zu Stillegungen älterer Zechen im Ruhrtal, wodurch es zu Lohnkürzungen, verlängerten Arbeitszeiten und Massenentlassungen kam.
Die soziale Lage der Arbeiter war zu dieser Zeit ohnehin recht schlecht, da der Lohn für die Arbeit oft nicht gerecht, die Arbeitsbedingungen sehr hart (Kinder ab 9 Jahren leisteten bis zu 10 Stunden Arbeit als Schlepper in Bergwerken) und die sozialen Absicherungen ungenügend waren. Nur wenige Unternehmer, -denen es, ausgestattet mit Mut und Geschick, handwerklicher Begabung und Risikobereitschaft, Verwaltungstalent und Flexibilität, wie Krupp oder Grillo gelang, in nur wenigen Jahren Imperien aufzubauen- , reagierten auf diese soziale Notlage ihrer Arbeiter und richten wie Krupp eine Betriebskrankenkasse oder wie GHH eine Werkssparkasse ein. Um seine Angestellten und Arbeiter mit Nahrungsmitteln zu versorgen, eröffnete Krupp 1853 die „Consum-Bäckerei“ ein, aus der später die „Kruppschen Konsum Anstalten“ hervorgingen. Um die Nachfrage nach Wohnungen zu befriedigen sowie um die Arbeiter enger an das Werk zu binden und Kontakte zu den bestehenden Gewerkschaften zu verhindern, wurden die ersten Kolonien in der Nähe der Fabriken von Unternehmerseite errichtet. Es entstanden die so genannten „D-Zug-Kolonien“, lang gestreckte Reihen niedriger Häuser, in denen die Menschen, welche auf engstem Raum lebten, gute Kontakte zueinander hatten, was den Fabrikbesitzern insofern nicht besonders gefiel, da sie „sozialen Widerstand“ befürchteten. Krupp entwickelte in dieser Zeit Pläne für eine Reihe durchdachter Siedlungen in der Nähe seiner Werke, welche auf der Weltausstellung 1855 vorgestellt wurden und ein Siedlungshaus im Kreuzgrundriss vorsahen, welches später für das Ruhrgebiet prägend wurde.
1870-1914:
Zwischen 1870 und 1914 kamen 700.00 Zuwanderer ins Ruhrgebiet, welche vor allem aus Polen und Schlesien aus überwiegend ländlichen Gebieten stammten und sich nur schwer in die ihnen fremde Industrielandschaft einfanden. Meist wohnten sie in ghettoähnlichen Arbeitersiedlungen. Der Wechsel von der Krise zur Hochkonjunktur ließ die Unruhen wachsen und intensivierte den sozialen Kampf. Die Arbeiterbewegung war nun besser organisiert, obwohl sie bis in die 1890er Jahre vom Staat bedrängt wurden und offene politische Aktivitäten aufgrund der Sozialistengesetze nicht möglich waren. Stattdessen fanden sich die Arbeiter in Gesangs- und Sportvereinen zusammen, wo sie in der gemeinsamen Freizeitgestaltung eine eigene Kultur schufen. Der Versuch des preußischen Staates einer sozialen Reparatur (vgl. GB 12 Klasse, S.87: 1883/84) änderte am Kern des Problems, - geringem Lohn, ungenügender Wohnraum, Einschränkung der Organisationsfreiheit und schlechten hygienischen Bedingungen-, nur wenig.
VI. Hochindustrialisierung 1870-1914:
Der Sieg über Frankreich gab Deutschland den Zugriff auf die Erzvorkommen Lothringens. Bestehende Industrie-Imperien wurden ausgebaut und neue gegründet. Die Zeit der Konzerne brach an. Grillo gründete die „Schalker Gruben- und Hüttenverein AG“ sowie die „Dortmunder Union“, beides gemischte Montanunternehmen mit Hütten- und Bergwerke. Durch Kreditvergabe gewannen die Banken mehr Einfluß, auch auf die Industrie. Sie kontrollierten über den Aufsichtsrat die Imperien mit. Im Oktober 1873 kam es zum ersten weltweiten Börsenkrach, viele Firmen gingen bankrott.
In dieser Zeit entstanden die von Grillo gegründete „Gelsenkirchener Bergwerks AG“. Großschachtanlagen wurden typisch, sie lösten die kleineren Bergwerke ab. In Tiefen von 500m wurden andere technische Voraussetzungen für die entstehenden Kräfte als Malakoff-Türme benötigt,. das stählerne Fördergerüst setzte sich durch, in der Form des „Deutschen Strebengerüstes“. Unter Tage kamen vermehrt Preßluftbohrer und - hammer zum Einsatz, Dynamit wurde vermehrt verwendet. Die ersten Schrämmaschinen wurden eingesetzt, der traditionelle Schlegel und das Eisen hatten nur noch symbolischen Charakter.
Eine wesentliche Neuerung für den Bergbau war der elektrische Strom, denn er brachte nicht nur Licht in die Bergwerke, sondern ermöglichte Transporte durch elektrischen Grubenbahnen. Bei der Wasserhaltung mußte die Dampfmaschine der elektrischen Pumpe weichen. Die Bergwerke wanderten in dieser Zeit weiter nach Norden und Westen. In den Kokereien wurde die Kohle zu Koks verarbeitet, anfallende Nebenprodukte, wie z.B. Teer und Gas - wurden nun in der entstehenden chemischen Industrie weiterverarbeitet. So entstand um die Jahrhundertwende das Netzwerk der Verbundwirtschaft aus Zeche, Kokerei, Hütte und Kohlenchemie. Die anfallenden Nebenprodukte wurden oft von kleineren Firmen weiterverarbeitet. Die wichtigsten Akteure dieser Zeit hießen Kirdorf, Thyssen und Mannesmann. Das Schienennetz wurde weiter ausgebaut, sodass keine Hütte und kein Bergwerk mehr ohne Bahnanschluß waren. Seit dem Krieg 1870/71 befanden sich über dem Rhein auch feste Brücken. In den Großstädten des Reviers lösten elektrische Straßenbahnen die Pferdebahnen früherer Zeiten ab.
Weitere Entwicklung:
Das Ruhrgebiet spielte auch noch in den Weltkriegen eine nicht unwesentliche Rolle. Heute ist die Kohleförderung jedoch zum Erliegen gekommen, da es billiger ist Kohle z.B. aus Afrika zu importieren.
VII. Quellenangaben/Bemerkungen:
In das Referat sind vor allem die zwei folgenden Quellen eingeflossen:
http://members.fortunecity.de/tempic/his_ruhrgebiet_de.html
Diese Quelle ist sehr ausführlich und gut strukturiert, die Jahreszahlen stimmten mit denen aus den anderen Quellen bzw. mit denen aus unserem Geschichtsbuch so weit wie nachprüfbar überein. Der Autor ist sachlich, verwendet aber gelegentlich besser nicht zu gebrauchende Ausdrücke (z.B. Zeile 10:“Hier findet die Geschichte nicht statt- hier geht sie vorbei“).
http://www.muenster.de/~gberg/ARuhrgebiet.html
Eine vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium erstellte Seite, in der das Ruhrgebiet als Herz der industriellen Revolution gesehen wird und welche die Geschichte des Ruhrgebiets nicht ganz so ausführlich und auch nur bis zum Jahre 1851 behandelt.
Die folgende Quelle behandelte nicht explizit die Geschichte des Ruhrgebiets, sondern war allgemeiner „Die industrielle Revolution in Deutschland“:
http://home.arcor-online.de/castro/ind.htm
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments "Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert"?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über die Geschichte und Entwicklung des Ruhrgebiets im 19. Jahrhundert, insbesondere im Hinblick auf seine Industrialisierung. Es behandelt die geografische Lage, Bevölkerungsentwicklung, allgemeine Voraussetzungen für die Industrialisierung in Deutschland, besondere Bedingungen im Ruhrgebiet, den Verlauf der Industrialisierung, das Verhältnis zwischen Unternehmern, Arbeitern und Staat sowie die Hochindustrialisierung.
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Die Hauptthemen umfassen die Lage und Bevölkerung des Ruhrgebiets bis 1800, die allgemeinen und besonderen Voraussetzungen für die Industrialisierung, den Prozess der Industrialisierung zwischen 1830 und 1914, das Verhältnis zwischen Unternehmern, Arbeitern und dem Staat im Zeitraum von 1848 bis 1914, sowie die Periode der Hochindustrialisierung von 1870 bis 1914.
Was waren die allgemeinen Voraussetzungen für die Industrialisierung in Deutschland?
Zu den allgemeinen Voraussetzungen gehörten die Beseitigung der Leibeigenschaft durch preußische Reformen, die Aufhebung von Zollschranken (insbesondere durch den Deutschen Zollverein), die Auflösung von Gilden und Zünften, die Einführung des Allgemeinen Preußischen Landrechts, sowie die Entwicklung des Bankwesens und der Aktiengesellschaften.
Welche besonderen Bedingungen begünstigten die Industrialisierung im Ruhrgebiet?
Besondere Bedingungen waren der Kohleabbau seit dem 13. Jahrhundert, die Erschließung der Ruhr als Schiffahrtsweg, die Installation der ersten Dampfmaschine zur Bewältigung von Wasserzuflüssen im Bergbau, sowie die Entwicklung der Eisenindustrie.
Wie verlief die Industrialisierung im Ruhrgebiet zwischen 1830 und 1914?
Die Industrialisierung begann um 1830 mit technologischen und infrastrukturellen Verbesserungen wie dem Puddelverfahren zur Stahlproduktion und dem Ausbau der Kohleförderung. Es entstanden Montankonzerne, und die Eisenbahn erschloss das Ruhrgebiet. Später wurden Ruhrzechen ausgebaut, Malakoff-Türme errichtet und neue Technologien wie das Bessemer-Verfahren eingeführt.
Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen Unternehmern, Arbeitern und Staat im Ruhrgebiet?
Der preußische Staat zog sich aus der Verwaltung der Kohlegruben zurück, was die Arbeitsbedingungen der Bergleute verschlechterte. Es kam zu Lohnkürzungen und Massenentlassungen. Einige Unternehmer reagierten mit sozialen Maßnahmen wie Betriebskrankenkassen und dem Bau von Kolonien, um Arbeiter an die Werke zu binden. Die Arbeiterbewegung organisierte sich zunehmend, und der Staat versuchte durch soziale Reparaturen die Situation zu verbessern.
Was geschah während der Hochindustrialisierung von 1870 bis 1914?
Nach dem Sieg über Frankreich erhielt Deutschland Zugriff auf Erzvorkommen in Lothringen. Bestehende Industrie-Imperien wurden ausgebaut, neue Konzerne gegründet, und Banken gewannen an Einfluss. Es kam zum ersten weltweiten Börsenkrach. Großschachtanlagen lösten kleinere Bergwerke ab, und neue Technologien wie Preßluftbohrer und Dynamit wurden eingesetzt. Der elektrische Strom revolutionierte den Bergbau, und es entstand ein Netzwerk der Verbundwirtschaft aus Zeche, Kokerei, Hütte und Kohlenchemie.
Welche Quellen wurden für dieses Dokument verwendet?
Hauptsächlich wurden zwei Online-Quellen verwendet: eine detaillierte Seite zur Geschichte des Ruhrgebiets und eine Seite, die vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium erstellt wurde. Außerdem wurden allgemeine Quellen zur industriellen Revolution in Deutschland und Geschichtsbücher herangezogen, um Aussagen und zeitliche Einordnungen zu überprüfen.
- Citar trabajo
- Jan Christoph (Autor), 2001, Ruhrgebiet im 19.Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105899