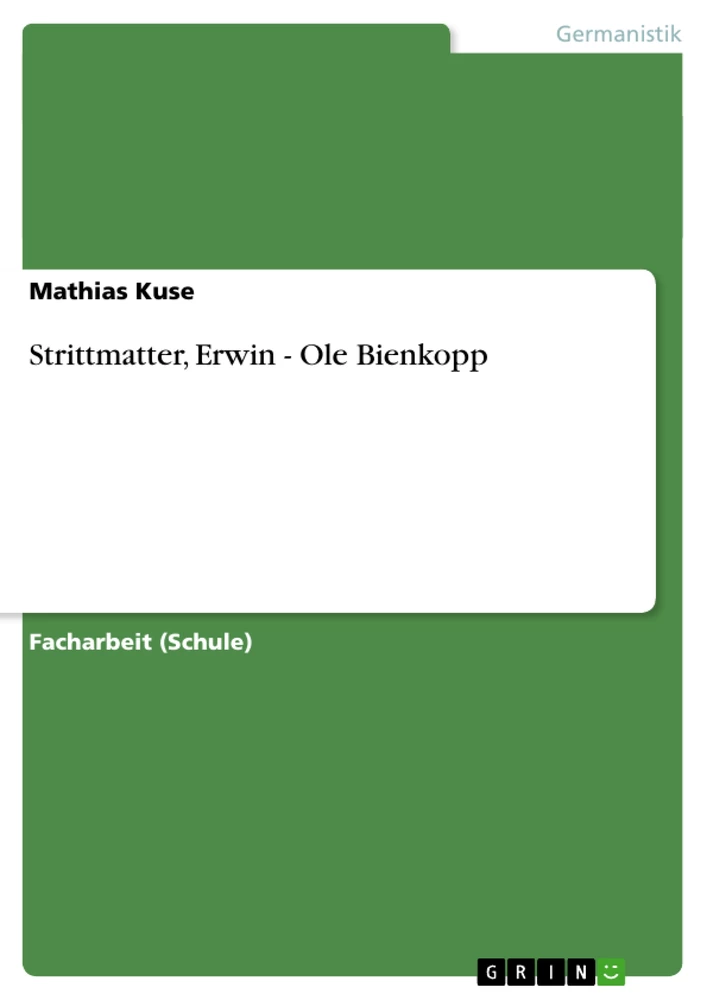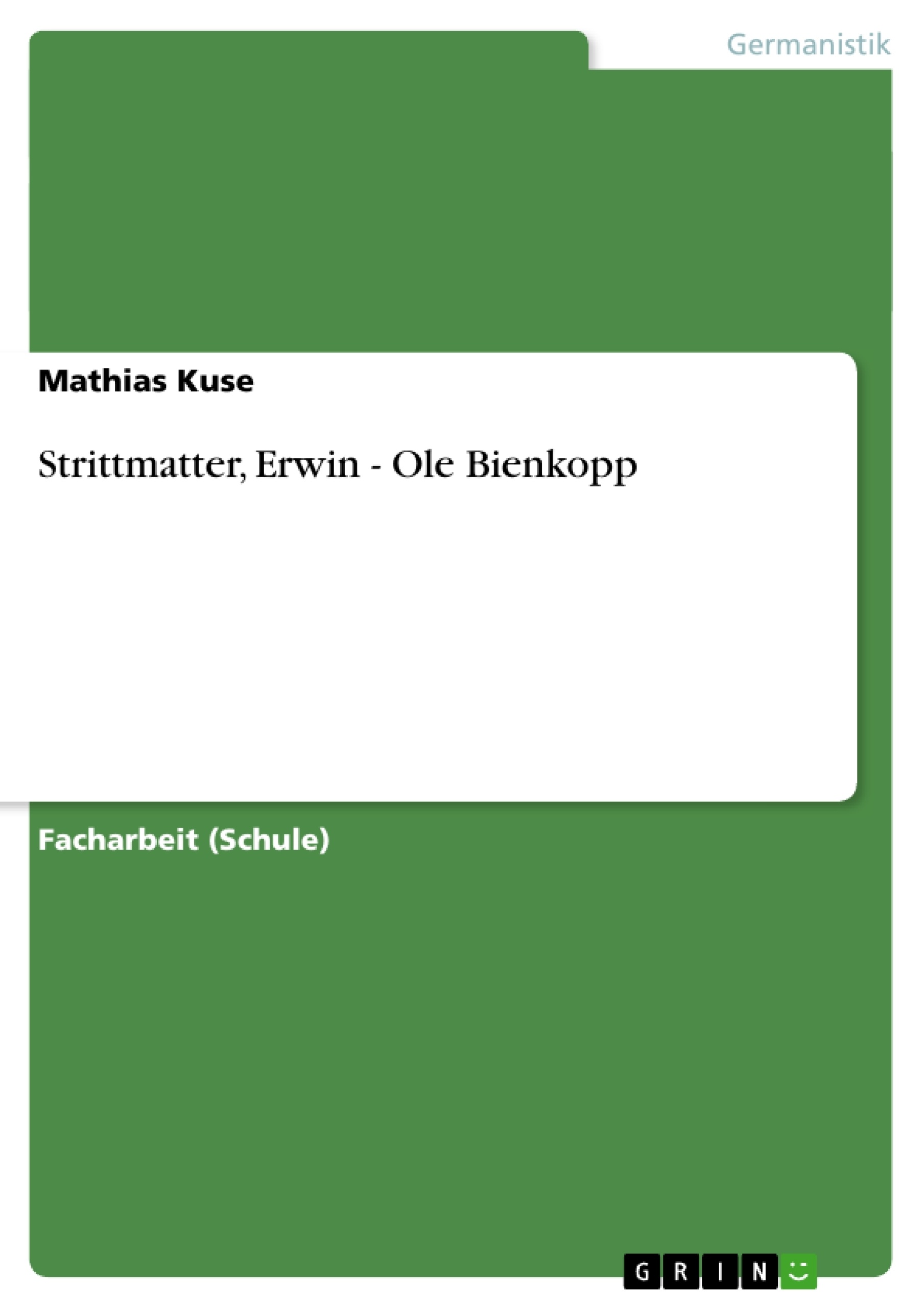Stell dir vor, ein starrköpfiger Eigenbrötler, der sich weigert, sich dem Kollektiv zu beugen, wird zum Symbol einer ganzen Epoche. Erwin Strittmatters Ole Bienkopp entführt dich in die Nachkriegszeit der DDR, wo der unkonventionelle Bauer Ole Hansen, genannt Bienkopp, mit Herzblut und Dickköpfigkeit versucht, seine Vision einer gerechten Landwirtschaft zu verwirklichen. Doch sein unermüdlicher Einsatz für das Gemeinwohl kollidiert mit den starren Strukturen des aufkeimenden Sozialismus, Korruption und der versteckten Agenda der Parteifunktionäre. Zwischen Idealismus und Realität, zwischen persönlichem Glück und gesellschaftlichem Druck, muss Ole seinen Weg finden – auch wenn dieser ihn in den Konflikt mit seiner Frau Anngret und dem mächtigen Julian Ramsch treibt. Kann Ole seine Träume verwirklichen, ohne sich selbst zu verlieren? Ole Bienkopp ist mehr als nur eine Geschichte über Landwirtschaft; es ist ein tiefgründiges Porträt einer Gesellschaft im Umbruch, ein Spiegelbild der menschlichen Natur und eine Ode an den unbezwingbaren Willen des Einzelnen. Tauche ein in eine Welt voller skurriler Charaktere, leidenschaftlicher Debatten und unvergesslicher Momente, die dich zum Lachen, Weinen und Nachdenken anregen werden. Entdecke die verborgenen Ecken der DDR-Geschichte und erlebe, wie ein einfacher Mann zum Helden wider Willen wird. Begleite Ole Bienkopp auf seiner Reise und stelle dir die Frage: Was ist wahre Freiheit wert? Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für deutsche Geschichte, gesellschaftliche Veränderungen und die Kraft des Einzelnen interessieren. Lass dich von Strittmatters meisterhafter Erzählkunst fesseln und entdecke ein Werk, das bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. "Ole Bienkopp" – ein Roman, der dich nicht mehr loslassen wird! Eine packende Saga über Widerstand, Anpassung und die Suche nach dem eigenen Platz in einer sich verändernden Welt. Ein unvergessliches Leseerlebnis, das noch lange nachwirkt. Idealismus, DDR-Geschichte, Landwirtschaft, Konflikt, Gerechtigkeit, Erwin Strittmatter, Kollektivierung, Widerstand, Nachkriegszeit, Gesellschaftskritik, Literatur, Roman, Deutsche Geschichte, Sozialismus, Parteifunktionäre, Bauer, Lebensgeschichte, Tragödie, Eigensinn, Generationenkonflikt.
Inhaltsverzeichnis
1. Literaturepoche und historischer Hintergrund
2. Autor
2.1 Zeittafel
2.2 Werke
2.3 Biographie
3. Werk
3.1 Entstehungs- und Druckgeschichte
3.2 Form
3.2.1 Äußere Form
3.2.2 Innere Form
3.3 Personenensemble
3.3.1 Wichtige Personen
3.3.2 Hauptperson
3.4 Inhaltsabgabe
4. Literaturverzeichnis
4.1 Primär-Literatur
4.2 Sekundär-Literatur
4.3 Zitate
1. Literaturepoche und historischer Hintergrund
Dieser Roman ist in die Literaturepoche „ Bitterfelder Weg“ einzuordnen. Dieser Begriff wurde durch die Bitterfelder Konferenzen(1959 und 1964) geprägt. Unter der Parole „Dichter in die Produktion“ sollten Autoren, die aus dem Arbeitermilieu stammten, in die Arbeitswelt geführt werden. Doch dies gelang nur in den wenigsten Fällen. Weiterhin versuchte man mit Aufrufen wie: "Greif zur Feder, Kumpel! Die sozialistische Nationalkultur braucht dich" Talente aus der Arbeiterschaft zu fördern und ihnen mit Hilfe künstlerischer Gestaltungen Erfahrungen zu vermitteln. Um dies durchzusetzen wurden so genannte „Brigadetagebücher“ geführt, und man bildete zusammen mit Künstlerverbänden Zirkel. Erfolge dieser Laienkünstler wurden prompt belohnt, indem sie für das Kunststudium vorgeschlagen wurden. Außerdem wurde ein Kunst- und Literaturpreis von der Gewerkschaft gestiftet. Dies war eine Chance für eine eigenständige Arbeiterliteratur, die aber durch Anleitungen und Korrekturen zensiert(eingeschränkt) wurde.
Bei der zweiten Bitterfelder Konferenz 1964 wurden wurde das Konzept, was hinter dem „Bitterfelder“ Weg stand, ein wenig überarbeitet. Die Schriftsteller wurden kritisiert nicht genügend Konflikte und Debatten in ihren Werken zu schildern. Auf dieser zweiten Konferenz musste man das Experiment als gescheitert betrachten, da sich die Erwartungen, die man in diese Epoche hatte, nicht erfüllt wurden.
In der Zeit „Bitterfelder Weg“ schrieben die Arbeiter, das „normale“ Volk selber. Für die „alten“ Schriftsteller war diese Epoche eher eine gute Erfahrung. Die sechziger Jahre neigten weniger dazu, alles so zu schreiben wie man es gerne hätte, sondern wirklich da anzusetzen, wo die Probleme liegen. Dies war auch bei Strittmatters „Ole Bienkopp“ der Fall. Strittmatter betrachtete die Ereignisse damals nicht durch eine „rosarote Brille“, sondern schilderte konsequent die Fehler der damaligen Zeit. Aber dieses Werk „lästert“ keines Falls über damals, es zeigt auch die guten Seiten des damaligen Sozialismus. Die Fehler, die Strittmatter anspricht sind zum Beispiel Verständnislosigkeit, Korruption oder einfach nur das „Organisationstalent“ der Partei. Bemängelt wird aber auch, dass damals nicht der Einzelne zählte, sondern nur die Partei. Die Idee des Einzelnen konnte noch so gut sein, die Partei würde sie erst gutheißen, wenn die Idee zu einer Idee der Partei werden würde. Somit wurden Querdenker weitestgehend ignoriert. Das musste auch die Hauptperson Ole spüren.
Strittmatter äußert sich einmal selbst in einem Brief an einen Freund über den „Bitterfelder Weg“:[Zitat6„Ich weißjetzt was der‚Bitterfelder Weg’ist: Man geht hinaus, sieht sich alles gründlich an, und in Berlin bekommt man mitgeteilt, was man gesehen hat.“].
In dieser Zeit wurde die Teilung Deutschlands auch physisch zur Realität, und die SED versuchte den Sozialismus in Deutschland aufzubauen
2. Autor
2.1 Zeittafel
1912 Wird am 14. August in Spremberg geboren
1919 Einschulung in Graustein Im Juni Übersiedlung nach Bohsdorf
1924 Kommt an Realgymnasium von Spremberg
1925 Schrieb erste Erzählung („Flock“)
1926 Veröffentlichung von „Flock“
1927 Einsegnung in Spremberg am 27. März
1929 Geht nach Auseinandersetzung mit Lehrer von der Schule ab
1930 Ab 1. April Bäckerlehre in Spremberg
1931 Ab 15. April Fortsetzung Bäckerlehre in Pretzsch an der Elbe
1932 Am 15. April Beendigung der Bäckerlehre mit bestandener Gesellenprüfung Arbeit als Bäckergeselle in Kahren(nähe Cottbus)
1933 Wird in Döbern aufgrund von sozialdemokratischen Aktivitäten verhaftet, Begründung: Liebesbeziehung zu einer „Nichtsesshaften“ Mitarbeit in väterlichem Krämerladen, danach Tierzüchterlehre und Arbeit in Landwirtschaftlichen Betrieben
1935 vom 1. Mai bis 31. Oktober Zuchtleiter der Angora-Zuchtfarm im Tierpark Diwa in Dinslaken 31. November bis 31. Januar 1936 Volontär in den Gräflich zu Ortenburgschen Zuchtbetrieben in Tambach(Oberfranken)
1936 1. September bis 1. Juni 1937 Haus- und Gartenarbeit (Kleintierzüchter) in privatem Haushalt von Hedwig Ruetz
1937 Pferdezüchter bei Heeresstandortsverwaltung Saalfeld Hilfsarbeiter in der „Thüringischen Zellwolle Schwarza“ Ab 1. November Kleintierzüchter im Mühlgut Reschwitz bei Saalfeld Erste Heirat
1938 Erster Sohn wird geboren
Verlässt Mühlgut Reschwitz und wird Hilfsarbeiter in Optischer Anstalt Saalfeld Montagehelfer in Zweigstelle der Maschinenbauanstalt Darmstadt Ab 17. Oktober wieder Zellwollarbeiter in Schwarza
1939 Zweiter Sohn wird geboren
1942 Von Wehrmacht eingezogen Stationiert in Jugoslawien, Karelien und Griechenland
1944 Abkommandierung nach Berlin(Heeresdienststelle) Inzwischen geschieden, lernt zweite Ehefrau kennen Selbstentlassung aus der Wehrmacht mit einigen Kameraden nach Oberplan in Böhmen
1945 Kehrt nach Saalfeld zurück. Wird dort Arbeiter auf Obstgut Gehlen Erste Veröffentlichungen in der „Thüringischen Landeszeitung“ Dritter Sohn wird geboren Kehrt nach Bohsdorf zurück und bekommt ein paar Morgen Land. Wird daraufhin Neubauer
1946 Heiratet zum zweiten Mal Intensive Arbeit an „Ochsenkutscher“ , seinem ersten Roman
1947 Nimmt an Lehrgang der Kreisparteischule der SED teil.(war Mitglied in
selbiger) Übernahme von Amt als Amtsvorsteher und Standesbeamter für 7 Gemeinden(Sitz in Bohsdorf)
Ab 1. Dezember Anstellung beim „Märkischen Druck- und Verlagshaus Potsdam“ in Lokalredaktion der „Märkischen Volksstimme“ in Senftenberg
1949 Vierter Sohn wird geboren Erhält am 27. Dezember durch Ministerium Förderungsbeitrag von 200,- DM und Anerkennung „Für gute Leistungen im 2. Preisausschreiben für Kurzgeschichten und Reportagen“
1950 „Ochsenkutscher“ erscheint in „Märkischer Volksstimme“ als Vorabdruck Kündigt bei selbiger Hält erste öffentliche Lesungen
1951 „Ochsenkutscher“ kommt als Buch auf den Markt Generalvertrag mit dem Aufbau-Verlag in Berlin über alle künftigen Werke. Veröffentlichungen von Gedichten und Erzählungen in zwei Anthologien Reicht bei FDJ-Bezirksleitung in Potsdam verschiedene literarisch- dramatische Arbeiten für die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin ein. Ein Sketch ist die Urfassung des „Katzengraben“ Stückes
1952 Lernt am 24. Februar spätere dritte Frau, Eva Braun kennen Wird mit Bertolt Brecht bekannt und arbeitet mit ihm gemeinsam an „Katzengraben“ Im Oktober mit Brecht und dem „Berliner Ensemble“ in Klein Körzig
1953 Lebt als Gast in Wohnung von Helene Weigel und Brecht Zieht im Mai in Berliner Neubau-Wohnung in Stalinallee Am 23. Mai Premiere von „Katzengraben“ am „Berliner Ensemble“ Verfasst kritischen Bericht über Geschehnisse auf Berliner Straßen, der nicht im „Neuen Deutschland“ veröffentlicht wird Unter dem Titel „Eine Mauer fällt“ eine Reihe von Erzählungen Bekommt auf Brechts Betreiben den Nationalpreis 3. Klasse
1954 Premiere von „Katzengraben“(Neufassung) am „Berliner Ensemble“ Fünfter Sohn(Erwin) wird geboren Zieht mit Eva Braun in Haus am Gransee Reist mit Brecht zu PEN-Tagung nach Amsterdam und dann weiter zu Gastspiel des „Berliner Ensemble“ nach Paris Reist außerdem mit Loest nach Ungarn und dann alleine zum Sowjetischen Schriftstellerkongress nach Moskau Der Roman „Tinko“ erscheint
1955 Im Oktober Nationalpreis 3. Klasse für „Tinko“
1956 Heiratet Eva Braun Wahl zum selbstvertretenden Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes der DDR. Später bis ´78 Vizepräsident
1957 Erster Band von „Der Wundertäter“ erscheint Reist mit Willi Bredel und Helmut Hauptmann nach Ungarn
1958 Sohn Matthes wird geboren
1959 Kinderbuch „Pony Pedro“ erscheint Wahl zum Sekretär des Schriftstellerverbandes der DDR, in diesem Amt bis 1960 Bekommt Vaterländischen Verdienstorden in Silber
1960 Reise in Sowjetunion Bekommt Urkunde „Hervorragender Genossenschenschafter“
1961 „Die Holländerbraut“ wird unter der Regie von Benno Besson in Berlin aufgeführt. Bekommt für dieses Drama den Lessingpreis
1963 Jakob, sein jüngster Sohn wird geboren „Ole Bienkopp“ erscheint und bringt heftige Reaktionen mit sich
1964 Nationalpreis 3. Klasse für „Ole Bienkopp“
1969 „Ein Dienstag im September. 16 Romane im Stenogramm“ erscheint
1970 erhält Johannes-R.-Becher- Medaille
1971 Wahl zum Mitglied der Akademie der Künste der DDR Wird Ehrenmitglied der LPG in Dollgow Premiere von dramatisiertem Roman „Tinko“
1973 zweiter Band von „Der Wundertäter“ erscheint
1974 Karl-Marx-Orden
1976 Nationalpreis 1. Klasse für Gesamtwerk
1978 Kunstpreis des FDGB(Freier Deutscher Gewerkschaftsbund)
1980 dritter Band des Romans „Der Wundertäter“ erscheint
1981 Notizenband „Selbstermunterungen“ erscheint
1982 Erhält Vaterländischen Verdienstorden in Gold und Ehrenmedaille des Schriftstellerverbandes der DDR
1983 Erster Teil von „Der Laden“ erscheint
1984 Nationalpreis 1. Klasse
1985 zweiter Teil des Romans „Der Laden“ erscheint
1986 Wird Ehrenbürger des Kreises Sprember-Land
1987 dritter Teil von „Der Laden“ erscheint(wurde zensiert)
1994 6. Januar: sein Sohn Matthes stirbt
31. Januar: verstirbt in Schulzenhof und wird am 5. Februar beigesetzt
2.2 Werke
- Ochsenkutscher 1950
- Eine Mauer fällt 1953
- Tinko 1954
- Katzengraben Szenen aus dem Bauernleben 1955
- Der Wundertäter (1) 1957
- Katzengraben Szenen aus dem Bauernleben mit einem Nachspiel 1958
- Pony Pedro 1959
-Ole Bienkopp1963
- Schulzenhofer Kramkalender 1966
- Die Holländerbraut Schauspiel in fünf Akten 1967
- 3/4 hundert Kleingeschichten 1971
- Die blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas 1972
- Der Wundertäter (2) 1973
- Sulamith Mingedö, der Doktor und die Laus Geschichten vom Schreiben 1977
- Meine Freundin Tina Babe Drei Nachtigall-Geschichten 1977
- Die alte Hofpumpe 1979
- Der Wundertäter (3) 1980
- Selbstermunterungen 1981
- Grüner Juni Eine Nachtigall Geschichte 1982
- Wahre Geschichten aller Ard(t) Aus Tagebüchern 1982
- Der Laden Erster Teil. 1983
- Ponyweihnacht 1984
- Der Laden Zweiter Teil. 1987
- Der Laden Dritter Teil 1993
- Vor der Verwandlung 1995 (Herausgeberin Eva Strittmatter)
-7-
2.3 Biographie
Am 14. August im Jahre 1912 bekam die Familie Strittmatter Zuwachs durch einen
kleinen Jungen, den sie Erwin nannten. Seine Eltern besaßen einen Krämerladen in
seinem Geburtsort Spremberg, sein Vater war außerdem ein Kleinbauer. Strittmatter, der 1919 in Graunstein eingeschult wurde, siedelte noch im gleichen Jahr nach Bohsdorf über und ging dort in die dreiklassige Volksschule. Fünf Jahre später, 1924 wurde er dann an das Realgymnasium in Spremberg überwiesen. Schon früh begeisterte sich Strittmatter für das Schreiben, und so schrieb er in seinem dreizehnten Lebensjahr bereits seine erste Erzählung, die den Namen "Flock" trug. Ein Jahr später wurde diese sogar veröffentlicht. Dass er etwas Besonderes war, merkte man spätestens, als er im Jahre 1929 nach einer Streitigkeit mit einem seiner Lehrer. Diese Streitigkeit hatte für ihn enorme Folgen, er wurde von der Schule verwiesen. Im Abgangszeugnis der Schule findet sich eine Bemerkung hierzu: „Auf Grund einer Schulkonferenz vom 31.März mit Wirkung vom 1.April1930von der Schule gegangen. Begründung: Er will ’Bäckermeister’ werden.“ Dies wird er dann auch. Am 1. April 1930 beginnt er seine Bäckerlehre bei Hermann Jurk in seinem Geburtsort Spremberg. Doch dort sollte er nicht lange bleiben. Am 15. April 1931 setzte er seine Lehre in Pretzsch an der Elbe unter den Händen von Karl Knötzsch. Genau ein Jahr später besteht Strittmatter seine Gesellenprüfung und war von nun an ein richtiger Bäckergeselle und arbeitete auch als solcher. Seine erste Anstellung bekam er in Kahren bei Cottbus.
Zu Anfangszeiten des Nationalsozialismus' wurde Strittmatter 1934 in Döbern Verhaftet. Der Grund hierfür lag darin, dass er eine Liebesbeziehung zu einer Nichtssesshaften hatte, was damals vom Gesetz nicht gestattet wurde.
Strittmatter probierte in seinem Leben viel mit Berufen herum. Er arbeitete zuerst als Bäcker, doch dann fragte er sich,[Zitat 1:„Teig kneten, Brot backen, es den Leuten verkaufen - war's das, was ich mir wirklich wünschte? War's das für ein Leben lang?“].
Nach kurzer Zeit verließ er dann seinen Arbeitsplatz in Kahren und half in der väterlichen Bäckerei. Doch noch im gleichen Jahr wechselte er den Beruf, er begann mit einer Tierzüchterlehre und arbeitete in Betrieben der Landwirtschaft. Vom 31. Mai bis 31. Oktober des darauf folgenden Jahres wurde er sogar Zuchtleiter der Angorazuchtfarm im Tierpark Diwa in Dinslaken. Danach arbeitete er als Volontär in den Gräflich zu Ortenburgschen Zuchtbetrieben, einer Pelztierfarm in Tambach in Oberfranken. Doch auch dieser Beruf schien nicht der richtige für ihn zu sein, denn im September 1936 arbeitete er in dem Privathaushalt von Hedwig Ruetz und erledigte dort Haus- und Gartenarbeiten(Kleintierzucht). Im Sommer `37 war Strittmatter dann Pferdepfleger bei der Heeresstandortverwaltung Saalfeld. In demselben Jahr arbeitete er auch noch als Hilfsarbeiter in der „Thüringischen Zellwolle Schwarza“ und als Kleintierzüchter in Reschwitz bei Saalfeld. Außerdem war 1937 auch noch das Jahr, in dem Strittmatter die erste von letztendlich 3 Ehen einging. Seine erste Frau wird in der Biographie „Des Lebens Spiel“ von Günter Drommer immer nur als „Heckenbraunelle“ bezeichnet. Schon im Vorfeld stand kein guter Stern über der Ehe von Strittmatter und seiner „Heckenbraunelle“, da sie ihn schon vor ihrer Hochzeit für kurze Zeit verlassen hat und mit einem Verkäufer für Herrenmode und einem Fliegeroffizier zusammen war. Doch Strittmatter konnte einfach nicht von ihr lassen, verzieh ihr und heiratete sie.[Zitat2 „Plötzlich ist die„Heckenbraunelle“wieder da, und es zeigt sich, dass Strittmatter nicht von ihr losgekommen ist und noch lange nicht von ihr loskommen wird.“]
Im März 1938 kam Strittmatters erster Sohn von acht(sieben eigene und einen bringt Eva mit in die Familie) zur Welt. Kurze Zeit später erblickt dann sein zweiter Sohn das Licht der Welt. Kurz nach dessen Geburt lebt das Ehepaar getrennt, welches sich „lange vor Kriegsende“ wieder scheiden lässt.
Dies war der schlimmste Abschnitt seines Lebens, denn auch er wurde von Naziherrschaft eingeholt. Er konnte nicht mehr einfach den Arbeitsplatz wechseln wie seine Schuhe, sondern musste dort bleiben, wo er war, da er kriegswichtige Arbeit in einer für den Krieg notwendigen Fabrik leistete, der Zellwollfabrik Schwarze in Thüringen. Er verdiente auch nicht gerade viel Geld bei dieser Art von Arbeit, so dass nach dem Notwendigsten nicht mehr gerade viel für etwas anderes übrig blieb. Zu alledem machte ihm auch seine Gesundheit zu schaffen, da er es gewöhnt war an frischer Luft zu arbeiten. Erst die Einberufung in den Krieg 1942 konnte hier Abhilfe schaffen, so merkwürdig es klingt. Eines gab er jedoch während dieser schrecklichen Zeit nicht auf, das Schreiben und das sich weiterbilden. In diesem Punkt erinnert er ein wenig an den Faust von Goethe, der einen unstillbaren Wissensdurst hatte, genau wie Strittmatter, doch nur nicht ganz so extrem.
Strittmatter war zuerst in den Karelien stationiert, wo die Wehrmacht den Überfall auf Schweden vorbereitete, der jedoch nie stattfand. Danach war ein im Partisanenkrieg in Jugoslawien. Dann wurde Strittmatter, welcher der Kavallerie angehörte, [Zitat3„[..]’auf die glückseligen Inseln des Odysseus’[..]“]versetzt.
Strittmatter war ein Schriftsteller, welcher seine enorme Lebenserfahrung, die er durch unzählige verschiedene Arbeiten, drei Ehen und den Krieg gemacht in seinen Romanen und Erzählungen einbindet und den Leser somit davon profitieren lässt. Seine Erfahrungen und Erlebnisse zum Beispiel hat er im ersten Band des „Wundertäter“ dem Leser vermittelt.
Nach zwei Jahren, 1944, wurde er dann nach Berlin in eine Heeresdienststelle abkommandiert. Im selben Jahr entließ er sich mit einigen Kameraden nach dem Oberplan in Böhmen selber aus der Wehrmacht. 1944 war auch das Jahr, in dem er seine zweite Ehefrau Maria treffen sollte. Sie war acht Jahre jünger, kam aus dem Emsland, hatte ein sehr großes Herz und hatte lange Zöpfe und blaue Augen. Doch auch diese Ehe ist kein Musterbeispiel. Sie dauerte zwar acht Jahre, doch die Eheleute verfremden sich immer mehr. Auch der gemeinsame Sohn, der 1949 geboren wurde bringt die Eheleute nicht wieder näher zusammen.
Er heiratete Maria 1946. In diesem Jahr begann er auch intensiv an seinem ersten Roman „Ochsenkutscher“ zu arbeiten. In dieser Zeit war er Neubauer, durch die Bodenreform, die ihm einige Morgen Land bescherte. Außerdem hatte er einige Veröffentlichungen in der „Thüringischen Landeszeitung“. Ein Jahr später trat er der SED bei und wurde Amtsvorsteher und Standesbeamter. Gleichzeitig neben diesen Ämtern war er in der Lokalredaktion der „Märkischen Volksstimme“ beschäftigt.
Seine erste „literarische“ Anerkennung bekommt Strittmatter 1949 für Kurzgeschichten und Reportagen die das Thema eines Preisausschreibens waren, an dem er sich beteiligt hatte. Diese Anerkennung war mit einem Förderungsbetrag von 200,- DM verbunden. 1950 war es dann so weit, das erste „richtige“ Werk von Strittmatter war vollendet und wurde in der „Märkischen Volksstimme“ abgedruckt. Im Handel erschien es Anfang März des darauf folgenden Jahres.
Strittmatter war von nun an kein kleiner Hilfsarbeiter mehr, der in anderer Leute Haushalt die Arbeit machen musste, sondern er war das, was er sein ganzes Leben lang immer werden wollte, er war Schriftsteller. Es war seine große Leidenschaft, das Schreiben, er tat es sein Leben lang, und nun war es zu seinem Beruf geworden. Es interessierte sich sogar schon ein Verlag für ihn, der Aufbau-Verlag in Berlin. Dieser Verlag wollte nicht die Rechte an seinem „Ochsenkutscher“, sondern sie wollten alles, den kompletten Strittmatter. Dieses Jahr war ein sehr bedeutendes für ihn, da er in demselbigen auch literarisch-dramatische Arbeiten für die Weltfestspiele der Jugend und Studenten bei der FDJ-Bezirksleitung in Berlin einreichte. Ein Sketch hiervon ist die Urfassung des bekannten Stückes „Katzengraben“.
Ein Jahr später lernt er dann nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen(zwei gescheiterte Ehen zuvor) seine dritte und auch letzte Ehefrau Eva Braun kennen. In diesem Jahr hat er keinen wirklich festen Wohnsitz. Er verlässt Spremberg und nimmt sich ein Zimmer in einer Försterei. Dieses Jahr ist auch das Jahr, in dem er seinen Schriftstellerkollegen Bertolt Brecht kennen lernt und mit ihm zusammen beginnt das Stück „Katzengraben“ zu schreiben. Auch im Anfang des darauf folgenden Jahres hat Strittmatter immer noch keinen festen Wohnsitz. Er wohnt eine Zeitlang sogar als Gast bei Brecht und Helene Weigel. Erst Mitte des Jahres bezieht er eine Neubau-Wohnung an der Berliner Stalinallee. Im selben Monat findet die Premiere des von Strittmatter und Brecht gemeinsam geschriebenen Stückes „Katzengraben“ am „Berliner Ensemble“ statt. Brecht ist inzwischen ein Freund für Strittmatter geworden, der ihm sogar den Nationalpreis dritter Klasse für „Katzengraben“ durch sein Betreiben dazu verhilft. Langsam wurde Strittmatter älter und suchte somit auch einen Platz, wo er sesshaft werden wollen würde. Er kaufte ein Haus in Schulzenhof/Dollgow bei Gransee und bezog dieses mit seiner Lebensgefährtin Eva Braun. Im selben Jahr wurde die Neufassung des „Katzengraben“ am „Berliner Ensemble“ präsentiert. 1954 war außerdem ein Jahr, in dem Strittmatter viel unterwegs war. Er reiste fast ausschließlich mit Begleitung, doch es war nicht Eva, sondern seine Schriftstellerkollegen Brecht und Erich Loest. Am Ende das Jahres veröffentlichte Strittmatter seinen zweiten Roman „Tinko“, für den er im darauf folgenden Jahr ebenfalls den Nationalpreis dritter Klasse erhielt.
1956 war es dann soweit, Strittmatter und Eva Braun gehörten jetzt nicht nur in guten sondern auch in schlechten Zeiten zueinander, sie heirateten. In demselben Jahr wurde Strittmatter, der von allen anerkannt wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes der DDR gewählt. Später wird er bis 1978 Vizepräsident des Verbandes sein.
Der erste Band zu seinem mehrteiligen Roman „Der Wundertäter“ erscheint 1957, ein Jahr bevor sein Sohn Matthes geboren wird. Seine Schriftstellerische Vielfalt bewies Strittmatter spätestens als er das Kinderbuch „Pony Pedro“ veröffentlichte. Er zeigte das er nicht nur von Bauern oder anderen „normalen“ Mitmenschen und ihren Problemen schreiben konnte, sondern das er auch Sinn für Familie und ein Herz für Kinder hat. Noch im selben Jahr verleiht man ihm den Vaterländischen Verdienstorden in Silber. Zwei Jahre Später bekommt Strittmatter dann die nächste Auszeichnung für eines seiner Werke, diesmal war dieses Werk ein Schauspiel und kein Roman, wie es die meisten seiner Werke waren. Es hieß „Die Holländerbraut“ und wurde im selben Jahr am Deutschen Theater Berlin unter der Regie von Benno Besson uraufgeführt. Für dieses Werk bekam er den Lessingpreis.
Das nächste Jahr war ein turbulentes Jahr, erstens wird sein Sohn Jakob geboren und zweitens erscheint sein Roman „Ole Bienkopp“ und mit ihm heftige Diskussionen über dieses Werk. Doch eben dieser kritischen Funktion des Buches wegen bekommt Strittmatter wiederum den Nationalpreis dritter Klasse dafür. Dies wird wie folgt begründet:[Zitat4 "[..]'für den Roman 'Ole Bienkopp', indem er mit poetischer Kraft Probleme und Widersprüche bei der Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft in unserer Republik gestaltet'[..]"].
1966 erscheint der „Schulzenhofer Kramkalender“, wofür Strittmatter wiederum ausgezeichnet, diesmal bekommt der den Fontane-Preis des Bezirkes Potsdam.
In den nächsten Jahren(1966-1972) veröffentlicht Strittmatter dann eine Reihe von Kurzgeschichten oder Romane in Stenographie. 1973 jedoch erscheint dann der zweite Band des Romans „Der Wundertäter“. [Zitat5„[..]’In Annerkennung hervorragender Leistungen und Ergebnisse im Sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung undÜberfüllung des Volkswirtschaftsplanes’[..]“]erhält Strittmatter den Karl-Marx-Orden. Seine nächste Auszeichnung bekommt er 1978. Es ist der Kunstpreis des FDGB(Freier Deutscher Gewerkschaftsbund). Zwei Jahre später erscheint dann der dritte Band des Romans „Der Wundertäter“. „Der Wundertäter“ zählt mit „Ole Bienkopp“ und „Der Laden“, dessen erster Teil 1983 erscheint, zu den bekanntesten Werken Strittmatters. Im Jahre 1984 bekommt Strittmatter erstmals den Nationalpreis erster Klasse für sein Gesamtwerk. 1987 wurde Strittmatter gleich zwei mal geehrt, einmal mit einer Ehrenurkunde des Rates der Stadt Spremberg und zum zweiten mit dem Ehrendoktorat der Hochschule für Landwirtschaft in Meißen. Ein Jahr später wird er sogar zum Ehrenbürger des Kreises Spremberg-Land. 1990 folgt dann der dritte und Letzte Teil des Romans „Der Wundertäter“. Dieser Teil wurde allerdings zensiert. Diese Zensur rekonstruiert er aber mit Hilfe von Tagebucheinträgen in „Die Lage in den Lüften“. 1992 wird „Der Laden“ dann veröffentlicht und schließt somit die Trilogie von Strittmatter ab. 1994 verstirbt dann sein Sohn Matthes im Alter von 36 Jahren. 25 Tage später, am 31. Januar verstirbt auch Strittmatter.
Mit Strittmatter ist nicht nur ein Familienvater und Ehemann gestorben, sondern auch einer der besten Schriftsteller der DDR.
3. Werk
3.1 Entstehungs- und Druckgeschichte
Strittmatters Roman „Ole Bienkopp“ hat möglicherweise in einer Postkarte eines Bauern an Strittmatter selbst seinen Ursprung. Dieser Bauer war Züchter von „Hochbrut- Flugenten“ und lebte in Friesack an der Mark. Eigentlich bot der Züchter Strittmatter nur an, dass er sich einmal seine Zucht anschauen könne, doch zugleich machte er ihn auch auf etwas aufmerksam. Und zwar wies er auf einen Artikel in der „Deutschen Geflügelzeitung“ drittes Juli-Heft 1961 hin. Der Artikel handelte von besagter Entenart. Strittmatter war ein Befürworter der Gründung von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften(LPG). Dann wird er direkt in seinem Dorfe(Dollgow) auf die Praxis dieser Veränderung aufmerksam und bemerkt zahlreiche Widersprüche, die sich dabei auftun. Die SED(Sozialistische Einheitspartei Deutschland) sah Strittmatter sozusagen als Quelle dieser Widersprüche.
Diese Widersprüche kritisierte er in seinem Roman „Ole Bienkopp“. Dies stieß allerdings auf heftige Kritiken.
In einem Brief an Strittmatter schildert einmal ein Freund seine Gedanken zu diesem Buch.[Zitat7„’Du krummer Hund hast das schönste, tiefste, ehrlichste(hol mich der grasgrüne Teufel, aber es ist so) Buchüber die DDR geschrieben, das je geschrieben wurde, und es wird wohl lange Zeitübers Land gehen, eh auch nur ein gleiches an seiner Seite stehen steht. [..] Laßdir die Hand drücken. Ich hörte, dass einige Trottel oder Bösartige diesem Buch zu Leibe wollen. Ich bin schreib- und maulfaul, dass weißt Du, aber für dieses Buch bin ich zu jedem Kampf bereit.’“].Dieser Brief schilderte nicht nur die Meinung eines einzelnen Bürgers, sondern die Meinung, die der Großteil der Bevölkerung hatte, die das Werk gelesen haben. Es waren nur die Parteivorsitzenden und Abgeordneten, denen der Roman nicht in den Kram passte.
3.2 Form
3.2.1Äußere Form
Das Werk ist in zwei Teile aufgespalten. Jeder dieser Teile enthält in etwa 200 Seiten. Diese Teile sind jeweils auch noch in Kapitel unterteilt. Jedoch besitzt der erste Teil 78 Kapitel während der zweite Teil nur 57 Kapitel aufweist. Die Kapitel haben keine exakte Bezeichnung, sondern sind durchnummeriert.
In diesem Buch wird eine Hervorhebung der Schrift nur bei Wörtern verwendet, die eine erklärende Funktion haben oder Eigennamen sind.
3.2.2 Innere Form
Strittmatter schreibt in diesem Roman aus der Erzählperspektive, die sich mit Ole Bienkopp als lyrisches Ich abwechselt.
Das Werk ist unterschiedlich in Zeitraffung und Zeitdeckung geschrieben, da er besondere Momente besonders lange schildert.
Der Leser nimmt sehr viele „Sprünge“ in der Zeit vor, da manchmal ein Zeitunterschied von mehreren Jahren zwischen den Kapiteln herrscht.
Ein anderer Punkt, der beim Lesen des Buches zum Vorschein kommt, ist, dass
Strittmatter heftige Kritik an der Art und Weise der damaligen Politik übt. Dieses Werk ist in Prosa geschrieben, was das Lesen und Verstehen für den Leser wesentlich vereinfacht.
3.3 Personenensemble
3.3.1 Wichtige Personen
Ole Hansen(Ole Bienkopp), Anton Dürr, Anngret Anken(Bienkopps Frau), Frieda Simson, Julian Ramsch, Emma Dürr
3.3.2 Hauptperson
Ole Bienkopp(Ole Hansen)ist ein Bauer, der nach dem Krieg, durch die Bodenreform, die in Deutschland stattfindet, ein paar Morgen Land bekommt und Kleinbauer wird. Schnell entwickelt er die Idee von einer Bauerngemeinschaft, die den Kleinbauern hilft, mit den Großbauern konkurrieren zu können.
Bienkopp ist ein sehr gutgläubiger, fast schon naiver Mensch, der immer nur das beste für jeden will. Er ist sehr sozial und gibt jedem eine Chance. Für das Wohl anderer Leute würde er alles tun.
In seiner Ehe mit Anngret ist sie „der Mann im Haus“. Bienkopp ordnet sich ihrem dominanten Wesen unter.
3.4 Inhaltsabgabe
Das Werk „Ole Bienkopp“ dreht sich um Ole Hansen, der von allen aber nur Bienkopp genannt wird, da er als Jugendlicher Bienen fing und sie auch züchtete. Bienkopp ist der Sohn des Waldarbeiters Paule Hansen, der seine Jugend in Blumenau als Hütejunge und Waldarbeiter bei dem Gutsherrn Baron von Wedelstedt. Ole, der schon in frühen Jahren seiner Eigenwilligkeit und seiner enormen Entschlusskraft Ausdruck verleiht, träumt von einem freien Leben.
So gibt er auch, gegen den Willen seines Vaters seine Arbeit auf um mit seinem selbstgebauten Bienenwagen durch die Welt zu ziehen.
Bienkopp war im Großen und Ganzen ein Sonderling, der immer seinen eigenen Weg ging. Doch Anton Dürr, der beste Freund und auch fast einziger, von Ole versuchte ihn immer wieder auf den „Weg der Vernunft“ zu führen. Er wollte ihm verdeutlichen das er sich nicht von der „normalen“ arbeitenden Bevölkerung zurückwenden muss, sondern dass er bei ihr sein Glück suchen soll. Doch Ole konnte in der kommunistischen Lebensart Antons nichts für sich entdecken.
Dann gab es da noch die schöne Tochter des Fischers aus Blumenau, Anngret Anken mit Namen. Sie war viel umworben, doch ihr Herz hatte sie an Julian Ramsch, den Sohn des Sägemüllers, verloren. Dieser ging jedoch nach Amerika um dort Medizin zu studieren. Anngret wollte warten, doch irgendwann hatte ihre Geduld ein Ende. Sie fand Gefallen an dem sturköpfigen Ole, der sich in sie verliebte. Sie hingegen liebte nur Julian Ramsch. Ole aber ließ sich davon nicht zurückschrecken und heiratete Anngret, obwohl in Anton stark davon abgeraten hatte.
Die Nazis waren an der Macht und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen bekümmerten Ole nicht im geringsten. Dies hielt sogar an, als Anton von den Nazis gesucht wird und Blumenau verlassen muss. Doch als Ole selber an dem Zweiten Weltkrieg teilnehmen musste, entwickelte sich in ihm ein Denken, welches gegen den Nationalsozialismus und seine Anhänger gerichtet war. Diesen Krieg erlebt er aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, einmal als Soldat und einmal als Gefangener. Er kam ins Gefangenenlager, weil er seinen Vorgesetzten, den Leutnant, mit seinem Feldspaten niedergeschlagen hatte. Dies geschah aber mehr oder weniger unfreiwillig, da er aus dem Schreck heraus gehandelt hatte und außerdem nichts in der Dunkelheit erkennen konnte. Allerdings wäre es ohne die Konserven, die er als eine Art Alarmanlage ausgelegt hatte, gar nicht so weit gekommen, da der Leutnant auf seinem Rundgang direkt in diese Falle tappte.
Er kam in ein Zuchthaus in Niederschlesien. Doch dort mussten sie Bald vor der Russischen Armee fliehen. Sie (Ole und seine Mitgefangenen) machten sich auf den Weg in die Niederlausitz, wo sie, als sie dort angekommen sind, an der Neiße kampierten. Die Häftlinge brüteten gerade Fluchtpläne aus, als sie ein lautes Rattern von der Russischen Armee vernahmen, die mit ihren Panzern anrückten. Es kam zu einem Gefecht bei dem auch einige Gefangenen ihr Leben ließen. Doch nicht Ole. Er war nach diesem Gefecht frei. Befreit von der Roten Armee.
Da er jetzt wieder frei war, machte er sich auf den Weg in seine Heimatstadt Blumenau. Als er dort ankam, war es total zerstört. Er durchkämmte den Ort nach überlebenden und stieß dabei auf 6 sowjetische Soldaten. Für einen Abend waren sie wie eine Familie. Am nächsten Morgen machte Ole sich auf zu der alten Kate seiner Eltern. Sie war fast vollkommen zerstört. Als er hineinging traf er auf seinen Vater, der mit einem Gewehr lauernd in der Ecke stand. Er war tot.
Bienkopp begann das Haus wieder aufzubauen. Eines Tages, als er gerade dabei war die Grundmauern zu erneuern, kamen einige Frauen Vorbei, die im Wald Holz sammelten. Eine von ihnen war seine Frau Anngret, die er aber erst auf den zweiten Blick erkannte. Die Bienkopps bauten sich die alte Kate von Oles Eltern wieder auf und der Krieg ging zu Ende.
Erst durch die Bodenreform, die jedem Bauern Land vom Staate zukommen ließ, sorgte wieder für Aufschwung in Oles Leben.
Um Kleinbauern, die nicht die Mittel(Bullen, Werkzeuge, Arbeiter usw.) haben um ihre Felder zu bestellen setzt sich Bienkopp als Vorsitzender Bauernhilfe für sie ein. Sein Ziel ist es mit vereinten Kräften die Grenzen der Kleinbauern zu durchbrechen und die Großen(Serno) schwächen.
Anton Dürr, der nicht mehr fliehen muss, ist Parteisekretär von Blumenau und Ole zudem noch ein sehr guter Berater der für die Demokratie im Dorfe kämpft. Anton wird von vielen im Dorf als Gerechtigkeitsfanatiker bezeichnet. Diese Leute sind die großen „Tiere“ im Dorf und haben das sagen. Doch Anton kämpft gegen diese Personen, von denen eine der ehemalige Geliebte Anngrets, Julian Ramsch ist. Er kehrte nach vielen Jahren wieder aus Amerika zurück und übernahm die Sägemühle seines Vaters. Er war ein reicher und angesehener Mann im Dorf, der nicht wollte das Anton daran etwas ändert.
Anton und Ramsch hatten eine gemeinsame Meinungsverschiedenheit, die Ramsch aus dem Weg räumen wollte. Doch dazu sollte es nicht kommen. Bienkopp hatte Anton bei der Arbeit im Wald besucht, und ein Streit war ausgebrochen. Sturköpfig wie beide waren, wollte keiner von beiden sich entschuldigen. Anton ging zu seinen Kollegen zurück um zu frühstücken. Ramsch war in der Zeit, in der Anton mit Ole stritt, dabei mit den anderen Waldarbeitern zu frühstücken. Dabei schob er Antons Frühstückszeug beiseite. Als Anton kam fingen seine Kollegen wieder an zu arbeiten. Dann griff der Zufall ein, denn der Baum den die Waldarbeiter gerade zu Fall brachten, Stürzte genau auf Anton. Er überlebte diesen Unfall nicht.
Ole, der mit ihm zuvor gestritten hatte war außer sich vor Wut und Trauer. Wut auf sich weil er sich nicht bei Anton entschuldigt hatte, und Trauer um seinen besten Freund. Anton hinterließ eine Frau, Emma Dürr, und zwei Kinder, die wie ihre Eltern Emma und Anton hießen.
Nach der Beerdigung von Anton ging Ole mit anderen Dorfbewohnern in eine Kneipe um von Anton Abschied zu nehmen. Ole betrank sich.
Nach einer Weile brach ein Streit zwischen Ole und Ramsch aus. Sie prügelten sich und Ramsch richtete Ole übel zu.
Antons Vermächtnis an Ole war, seinen Sinn für Gerechtigkeit umzusetzen. Dies wollte Ole mit der Bauerngemeinschaft erreichen. Gerechtigkeit auf dem Acker und im Stall, das war das Ziel, welches Ole von nun an verfolgte.
Ole wurde von kaum jemandem verstanden, nicht einmal Anngret hatte Verständnis für das, was er tat. Sie wollte nur den großen Bauern ebenbürtig sein. In ihren Augen zählte nicht die Menschlichkeit oder Gerechtigkeit, sondern nur das Geld und der sachliche Reichtum.
So waren auch die Streitigkeiten zwischen Anngret und Ole vorprogrammiert. Sie stritten sich Tage lang. Irgendwann begann Anngret dann ihr altes Verhältnis mit Julian Ramsch, der jetzt der Besitzer der Sägemühle seines Vaters war, wieder aufzunehmen. Er konnte ihr all das bieten, was Ole ihr vielleicht hätte bieten können, aber nicht wollte. Er investierte lieber all seine Zeit, sein Geld und seine Ausdauer in die Bauerngemeinschaft. Dies machte sich nach einer Weile dann aber auch bemerkbar. Anngret und Ole „trennten“ sich, sie ließen sich aber weder scheiden noch zogen sie von einander weg. Sie lebten in ihrer alten Kate, die Ole nach dem Krieg wieder aufbaute. Sie teilten die Kate in zwei gleich große hälften, da war Streit vorausbestimmt.
Ole steigerte sich nun immer mehr in seine Bauerngemeinschaft, doch er konnte kaum Bauern auf seine Seite ziehen. Nur wenige waren bereit ihr Geld und ihr Land in einen großen Topf zu werfen, da nicht sicher war, ob man auf diese Weise Gewinn erzielen würde.
Die „Junge Bauerngemeinschaft“ hat immer wieder mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen, so fehlten in einem Jahr beispielsweise die Saatkartoffeln um die Felder zu bestellen. Zu diesen Problemen kam noch, dass die Arbeitsmoral von einigen Mitarbeitern sehr zu wünschen übrig ließ. Diese wollten nur etwas vom „großen Kuchen“ abbekommen ohne dafür zu arbeiten. Doch Ole bleibt hart und die Bauerngemeinschaft bekommt langsam Wind in die Segel, was Serno und Ramsch, die beiden höchstangesehensten Männer in dem Dorf, gar nicht in den Kram passt. Sie sehen sich durch die aufstrebendenden Bauern in ihrer wichtigen Position(wirtschaftlich) im Dorf gefährdet.
Zu alledem bekommt Ole auch noch Ärger mit der Parteivorsitzenden, die Oles Drang nach einer unabhängigen Gemeinschaft für Bauern nicht teilen kann. Ole war auch in dieser Partei, doch als auf einer Versammlung gesagt wurde, dass das Vorhaben Oles der Partei schaden zufügen würde, trat er aus dieser aus. Ramsch und Serno fühlten sich schon Triumphatoren, doch dann wurde Oles Arbeit doch noch gewürdigt. Die SED gründete die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft(LPG). Da die Partei nun ihre Vorurteile niederlegen musste, trat Bienkopp ihr wieder bei. Die Jahre vergingen und aus der „Neuen Bauerngemeinschaft“ wurde die Produktionsgenossenschaft „Blühendes Feld“.
Ole gelang es mit seiner LPG dem Grossbauern Serno immer mehr an Einfluss abzuringen und ihn schließlich von seinem Thron zu stoßen, da die Arbeiter, die für ihn arbeiteten, plötzlich von ihren Rechten Gebrauch machten. Sie ließen sich nicht mehr einfach nur ausnutzen, sondern sie bestanden auf Gehälter nach Tarif und Arbeitszeiten, wie es das Gesetz vorgesehen hatte. Einige, die gar nicht mehr für Serno arbeiten wollen, gehen einfach zu Ole und treten seiner Genossenschaft bei. Ramsch, der aus Angst wegen eines Verfahrens, das ihm drohen würde, wenn jemand den Tod Anton Dürrs näher untersuchen, und herausfinden würde, dass er an allem schuld gewesen ist, nach Westberlin flieht, lässt Anngret vorerst schon wieder allein. Doch Anngret folgt ihm wenige Tage Später, kehrt aber bald wieder in ihre wahre Heimat Blumenau zurück. Sie versucht Bienkopp wieder für sich zu gewinnen, doch dieser hat in Märkte Mattusch seine passende Frau gefunden. Märkte kam zur Verstärkung nach Blumenau, sie sollte die Geflügelzucht übernehmen. Dies tat sie auch. Doch es blieb nicht nur bei dem Geflügel, sie verliebte sich in Ole genau wie er sich auch in sie.
Doch Anngret war verzweifelt, sie sah nur noch einen Ausweg, den Selbstmord. Ole zeigte, dass er von dieser Tat nicht sehr betroffen war.
Märkte war Bienkopp sehr ähnlich, sie war beispielsweise genauso selbstlos und ehrgeizig wie er. Die Probleme blieben aber trotzdem nicht aus, doch der ununterdrückbare Ehrgeiz Bienkopps ließ ihn immer wieder nach Lösungen der Probleme suchen.
Bienkopp wollte aber auch mehr, als er bekommen konnte. So ließ er im Winter am Kuhsee das Schilf schneiden und Matten daraus flechten, um diese zu verkaufen. Im Sommer wollte er den Kuhsee dann zur Entenaufzucht nutzen. Doch die Enten flogen weg, Bienkopp hatte ihnen die Nahrung(das Schilf) weggenommen und es verkauft. Ole nutzte alles, was man nur nutzen konnte. Er wusste, das unter dem Land der Genossenschaft Kalkmergel lagert, den man als billigen Dünger für die Felder nutzen könnte. Diese Aktion erforderte aber einen Bagger den die Genossenschaft nicht besaß. Sie mussten sich einen leihen. Doch durch Nachlässigkeit und vor allem Verständnislosigkeit musste sich Bienkopp selber um einen Bagger bemühen. Hinter seinem Rücken stallten die Bürgermeisterin und der Kreissekretär wertvolle Importkühe ein, die den Winter aber nicht überstehen. Dies ist ein heftiger Rückschlag für die Genossenschaft. Simson und Kraushaar versuchen nun Ole diesen Verlust in die Schuhe zu schieben. Ole muss vor den beiden Bürokraten kapitulieren und wird von seinem Posten als Vorsitzender der Genossenschaft beurlaubt, obwohl die Genossenschaftsbauern dagegen protestieren. Bienkopp sieht ein, dass es zwecklos wäre wenn er versuchen würde sich zu wehren.
Er verschwindet daraufhin und wird erst nach drei Tagen von der schon völlig verzweifelten Märkte halb tot vor Erschöpfung gefunden. Er war verzweifelt dabei den Mergel unter den Wiesen mit einem Spaten zu fördern. Während dessen hat Wunschgetreu den Bagger besorgt, doch Ole nützt dieser nichts mehr, da er an den Folgen der Erschöpfung stirbt. Ole hinterließ seine geliebte Märkte, die ein Kind von ihm erwartet. Außerdem hinterließ er noch sein Lebenswerk, die Genossenschaft, die von Märkte und ihren Angestellten weiter geleitet wird.
4. Literaturverzeichnis
4.1 Primär-Literatur
Erwin Strittmatter: Ole Bienkopp; 1. Auflage 1999 der Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin
4.2 Sekundär-Literatur
Günther Drommer: Erwin Strittmatter Des Lebens Spiel; 1. Auflage 2000 der Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin Epochen der Deutschen Literatur: 1. Auflage 1993 der Ernst Klett Verlage GmbH u. Co. KG, Stuttgart 1989
http://www.hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-strittmattererwin.shtml
http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/del_23.html
http://www.berlin-ehrungen.de/Lesezei/Blz00_08/text34.htm
4.3 Zitate
Zitat1: http://www.berlin-ehrungen.de/Lesezei/Blz00_08/text34.htm Zitat2: "Des Lebens Spiel" Seite 56
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Inhaltsverzeichnis" in Bezug auf diese Sprachevorschau?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel und Abschnitte der Analyse auf, einschließlich Literaturepoche und historischer Hintergrund, Informationen zum Autor (Zeittafel, Werke, Biographie), Werkdetails (Entstehungsgeschichte, Form, Personenensemble, Inhaltsangabe) und Literaturverzeichnis (Primär-, Sekundärliteratur, Zitate).
Welche Literaturepoche wird in Bezug auf den Roman diskutiert?
Der Roman wird der Literaturepoche "Bitterfelder Weg" zugeordnet, die durch die Bitterfelder Konferenzen (1959 und 1964) geprägt wurde. Es wird auf die Parole "Dichter in die Produktion" und die Förderung von Talenten aus der Arbeiterschaft eingegangen.
Was beinhaltet die "Zeittafel" des Autors?
Die Zeittafel listet wichtige Lebensereignisse des Autors auf, von der Geburt bis zum Tod, einschließlich Schulbildung, Berufsausbildungen, Arbeitsstellen, Veröffentlichungen, Eheschließungen, Auszeichnungen und Mitgliedschaften in Organisationen.
Welche Informationen sind unter "Werk" zu finden?
Der Abschnitt "Werk" behandelt die Entstehungs- und Druckgeschichte des Romans, seine äußere und innere Form, das Personenensemble (wichtige Personen und Hauptperson) sowie eine Inhaltsangabe.
Was beinhaltet die "Entstehungs- und Druckgeschichte" des Romans?
Dieser Teil beschreibt die möglichen Ursprünge des Romans (z.B. eine Postkarte eines Bauern) und die Kritik, die er hervorrief.
Was wird unter "Form" des Werkes analysiert?
Unter "Form" werden sowohl die äußere Form (Aufteilung in Teile und Kapitel, Verwendung von Hervorhebungen) als auch die innere Form (Erzählperspektive, Zeitraffung und Zeitdeckung, Kritik an der Politik) betrachtet.
Wer sind die wichtigen Personen, die unter "Personenensemble" aufgeführt werden?
Die wichtigsten Personen, die im Roman vorgestellt werden, sind Ole Hansen (Ole Bienkopp), Anton Dürr, Anngret Anken (Bienkopps Frau), Frieda Simson, Julian Ramsch und Emma Dürr.
Was ist das Besondere an Ole Bienkopp, der als "Hauptperson" beschrieben wird?
Ole Bienkopp (Ole Hansen) wird als Bauer beschrieben, der nach dem Krieg durch die Bodenreform Land erhält und eine Bauerngemeinschaft gründet. Er wird als gutgläubiger und naiver Mensch dargestellt, der immer das Beste für jeden will.
Was beinhaltet die "Inhaltsabgabe"?
Die Inhaltsabgabe bietet eine Zusammenfassung der Handlung des Romans, von Ole Bienkopps Jugend und Entwicklung bis zu seinem Engagement für die Bauerngemeinschaft, seinen Konflikten mit anderen Charakteren und seinem tragischen Tod.
Welche Quellen werden im "Literaturverzeichnis" aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis listet Primärliteratur (den Roman selbst) und Sekundärliteratur (biographische und literaturwissenschaftliche Werke über den Autor und seine Werke) sowie Webseiten und Zitate auf.
- Quote paper
- Mathias Kuse (Author), 2001, Strittmatter, Erwin - Ole Bienkopp, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105854