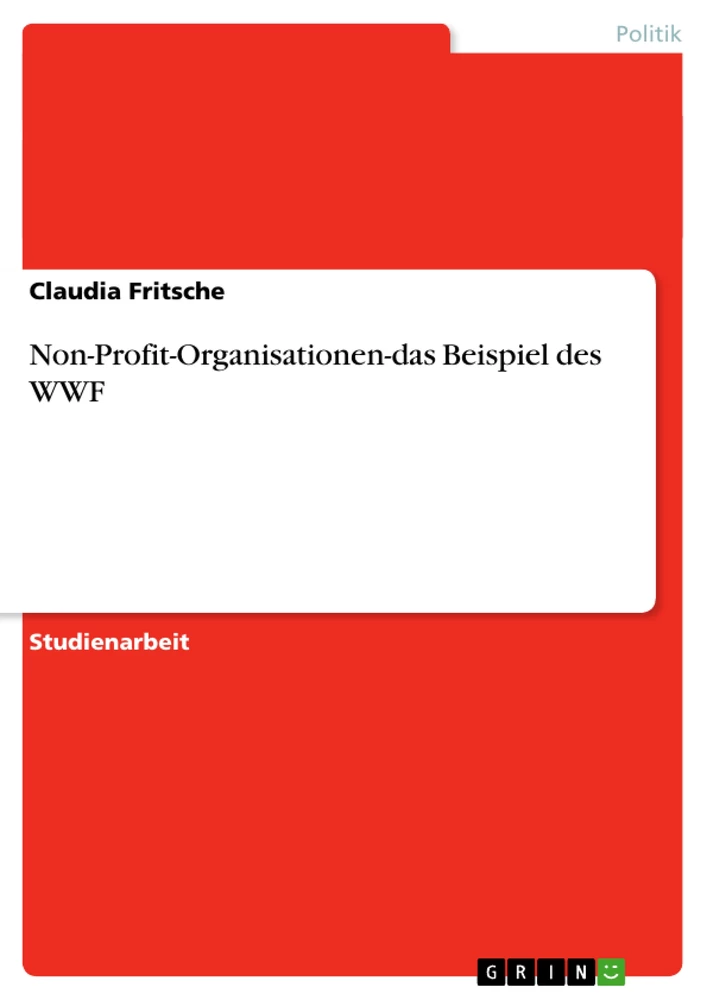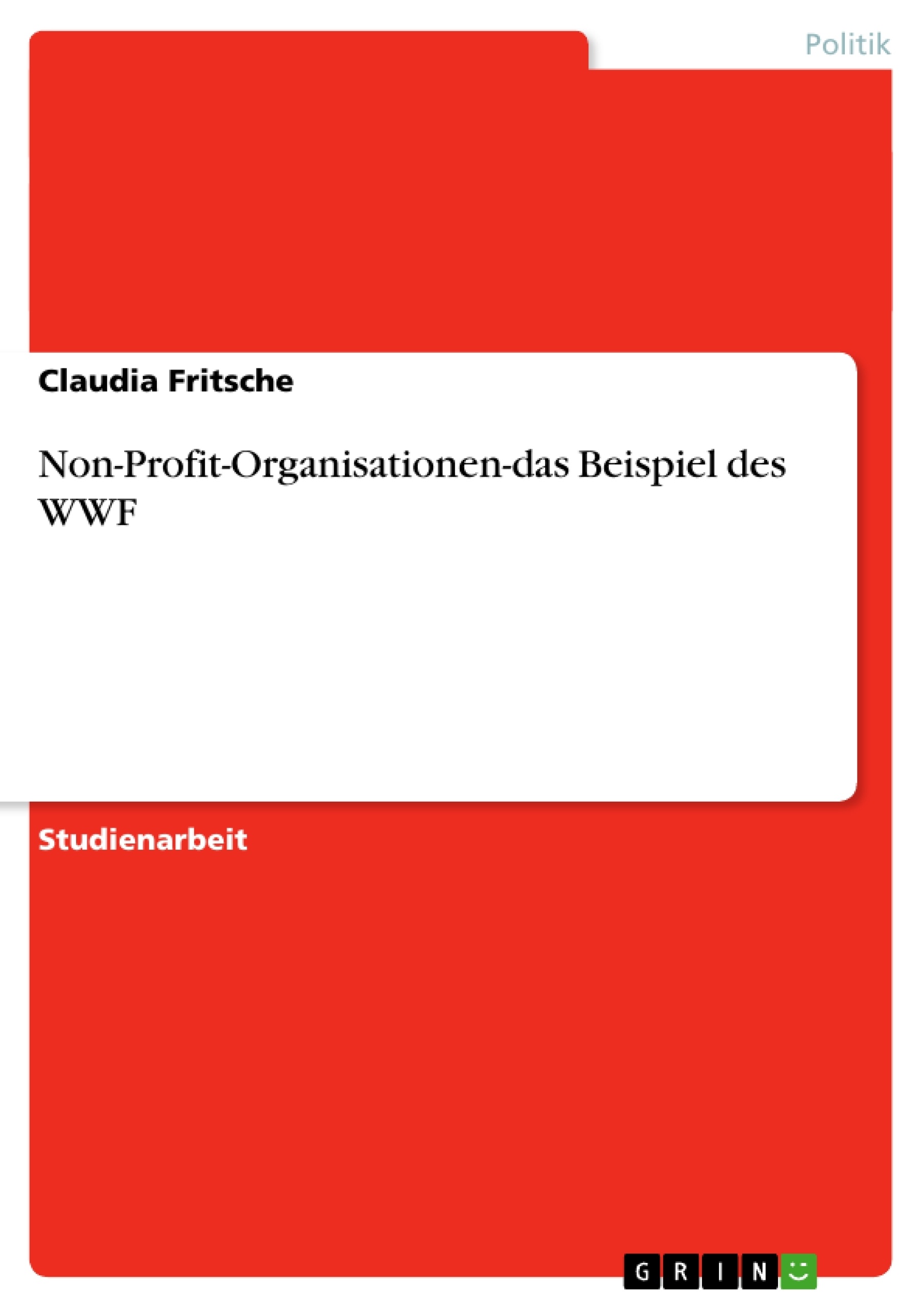In einer Welt, die sich rasant verändert und in der die Grenzen zwischen Markt, Staat und Zivilgesellschaft verschwimmen, rückt die Rolle von Non-Profit-Organisationen (NPO) immer stärker in den Fokus. Diese Arbeit beleuchtet am Beispiel des World Wide Fund for Nature (WWF) die facettenreiche Welt der NPOs, ihre Definition, Tätigkeitsbereiche und ihre Bedeutung für das Gemeinwohl. Es wird untersucht, wie sich der WWF als eine der bekanntesten Umweltschutzorganisationen in Deutschland positioniert und welche Ziele er verfolgt, um die biologische Vielfalt unseres Planeten zu bewahren. Dabei werden die Struktur und Arbeitsweise des WWF Deutschland analysiert, von der anfänglichen Pionierphase bis hin zu den Herausforderungen der Professionalisierung und Integration. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Finanzierung von NPOs und den spezifischen Problemen, mit denen sie konfrontiert sind. Das Buch bietet Einblicke in die strategische Entwicklung des WWF, von seinen Ursprüngen als World Wildlife Fund bis zur heutigen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und globale Partnerschaften. Es werden die zentralen Arbeitsbereiche des WWF wie der Schutz von Meeren, Küsten, Feuchtgebieten und Wäldern detailliert betrachtet, wobei der Fokus auf dem Aufbau von Naturschutzgebieten und dem Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten liegt. Diese tiefgehende Analyse zeigt, wie NPOs wie der WWF eine entscheidende Brücke zwischen gesellschaftlichem Engagement und effektivem Umweltschutz bauen, um eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern. Eine kritische Auseinandersetzung mit den internen Prozessen und externen Herausforderungen des WWF Deutschland rundet das Bild ab und bietet wertvolle Erkenntnisse für alle, die sich für die Arbeit von Non-Profit-Organisationen und den Schutz unserer Umwelt interessieren. Dieses Buch ist somit ein unverzichtbarer Leitfaden für Studierende, Fachleute und engagierte Bürger, die einen Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Welt leisten wollen, indem es die Mechanismen zivilgesellschaftlichen Engagements im Kontext globaler Herausforderungen verständlich macht und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Anpassung und Professionalisierung in der Arbeit von NPOs hervorhebt, um ihre Wirksamkeit und ihren Einfluss langfristig zu sichern.
Non-Profit-Organisationen - das Beispiel des WWF
1. Einleitung
Im Zuge der Legitimitätskrise der Regulierungsmöglichkeiten von Markt und Staat kommt der Begriff der Zivilgesellschaft mehr und mehr in die Diskussion. Die Zivilgesellschaft steht dabei sowohl gegen einen bindungslosen Individualismus als auch gegen eine umfassende Politisierung aller Lebensbereiche. Dabei soll der politisch-öffentliche Sektor um deinem weiteren gesellschaftlich-privaten Sektor ergänzt werden, der in vielfältigen Formen der Selbstorganisation und der Selbstverwaltung gestaltet wird. (Vgl.: Klein; Schubert, 1997: 323)
Ausdruck dieser Selbstverwaltung und Selbstorganisation ist das breite Spektrum der Non-Profit-Organisationen (NPO), die in vielen Tätigkeitsbereichen Zivilgesellschaft aktiv mitbeleben.
Ein wichtiger Tätigkeitsbereich von Non-Profit-Organisationen ist sicherlich die Umwelt. Vier Millionen Bundesbürger sind Mitglied oder Förderer eines Naturschutz- oder Umweltvereins. Die Zeit der großen Umweltbewegung ist jedoch vorbei. Heute sind professionell geführte Umweltverbände das Sprachrohr der Bürger. Sie informieren die Öffentlichkeit über Umweltfragen, sensibilisieren diese dafür, gestalten Kampagnen und Projekte und treten schließlich gegenüber staatlichen Stellen als Anwälte der Umwelt auf. (Vgl.: Fritzler; 1997: 71)
Eine dieser Organisationen ist der WWF, anhand dessen Arbeit Non-Profit-Organisationen hier näher betrachtet werden sollen. Nach einer Definition von Non- Profit-Organisationen sollen zunächst eine Typologie anhand von Tätigkeitsbereichen und eine Bestandsaufnahme der Ziele des WWF gemacht werden. Danach werden Aufbau und Struktur, Projekte und Arbeitsweisen und die Finanzierung von NPOs, immer natürlich mit dem Schwerpunkt auf die Umweltstiftung WWF Deutschland, diskutiert. Abschließend sollen spezifische Problemstellungen von NPOs und die Problematik des WWF Deutschlands betrachtet werden.
2. Definition von Non-Profit-Organisationen
Für eine Definition von Non-Profit-Organisationen ist es zunächst einmal nötig, sich von den geläufigen Negativdefinitionen zu lösen. Neben dem hier benutzen Begriff der Non-Profit-Organisation (NPO) ist nämlich mehr und mehr auch der Begriff der nichtstaatlichen, bzw. der Nicht-Regierungs-Organisation (NRO) international gebräuchlich. Der erste Begriff legt die Betonung auf die Abgrenzung von gewinnorientierten Unternehmen, auf die Abgrenzung vom Markt. Dabei kann es jedoch zu dem Mißverständnis kommen, Non-Profit-Organisationen dürften keine Gewinne erwirtschaften. Das ist jedoch nicht der Fall, Gewinne sind durchaus zu begrüßen, werden sie für den Organisationszweck, gewissermaßen die „Mission“ der NPOs verwendet. Der Begriff der Nicht-Regierungs-Organisation legt im Gegensatz dazu den Schwerpunkt auf die Abgrenzung, die Unabhängigkeit vom Staat, wobei dann aber Mischformen zu Problemen und Mißverständnissen führen können. (Vgl.: Badelt, 1997: 6)
Diese Art von Negativdefinitionen haben nur einen geringen Wert, der Begriff der Non-Profit-Organisation soll in dieser Arbeit aber aufgrund seiner Geläufigkeit trotzdem weiter benutzt werden.
Um dem weiten Spektrum der Non-Profit-Organisationen gerecht werden zu können, werden nun verschiedene Definitionmerkmale, ja Charakteristika besprochen, die zusammengenommen eine Non-Profit-Organisation ausmachen. Nicht bei allen Non-Profit-Organisationen sind immer alle Aspekte im gleichen Maße ausgeprägt, in einem Mindestmaß sollten die einzelnen Merkmale jedoch vorhanden sein.
Zunächst muß zumindest eine geringe formale Organisation, zu der formalisierte Entscheidungsstrukturen und Verantwortlichkeiten aber auch eine Satzung gehö- ren, vorhanden sein. Des weiteren ist eine Non-Profit-Organisation privat, also nicht staatlich, wobei öffentliche Unterstützung vor allem in Form finanzieller Zuschüsse nicht ausgeschlossen wird. Ihre Einkommensquellen sollten aber zu einem Großteil aus Spenden und Beiträgen bestehen. Non-Profit-Organisationen dürfen zwar Gewinne erwirtschaften, aber, wie schon erwähnt, keine Gewinne an Mitglieder ausschütten, die Gewinne müssen satzungsgemäß für den Organisationszweck verwendet werden. So kann der steuerliche Status der Gemeinnützigkeit erfüllt werden. Hinzu kommt ein Minimum an Selbstverwaltung, also Unabhängigkeit und auch Freiwilligkeit, daß nicht nur durch ehrenamtliche Tätigkeiten, sondern auch schon durch die freiwillige Mitgliedschaft und Spenden erfüllt sein kann. (Vgl.: Ebd.: 7ff)
Insgesamt verfolgen Non-Profit-Organisationen in einem hohen Maße bedarfsorientierte Sachziele und dienen so dem gesellschaftlichen Gemeinwohl.
3. Tätigkeitsbereiche
3.1 Typologie nach Tätigkeitsbereichen
Non-Profit-Organisationen decken ein weites Spektrum ab, so daß vor allem in der Dienstleistungsbranche einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellen. (Vgl.: Badelt, 1997: 5) Dabei werden Eigenleistungsund Fremdleistungs-NPO unterschieden, je nach dem, ob die Organisation nur für eigene Mitglieder, wie zum Beispiel Sportvereine, oder gerade für Nichtmitglieder tätig ist, wie vor allem Organisationen der Entwicklungshilfe in Industrieländern. Non-Profit-Organisationen können im Kulturund Erholungsbereich tätig sein, wie das auf private Museen, Orchester und auch Sportvereine zutrifft. Des weiteren sind sie im Bildungsund Erziehungswesen tätig, wie zum Beispiel private Schulen und Kindergärten. Dabei spielen oft kirchliche Organisationen eine große Rolle. Das trifft auch für das Sozialwesen zu, eines der wichtigsten Bereiche für Non-Profit-Organisationen, in denen kirchliche Organisationen wie die Caritas viel Arbeit leisten. Hier handelt es sich um Dienste für Alte, Behinderte und Randgruppen in Form von Beratungsstellen und Pflegeund Betreuungsdiensten. Hinzu kommen noch Gruppen, die auch politisch Einfluß nehmen, wie berufsständische Interessenvertretungen (z.B. Gewerkschaften) und eben auch Organisationen für Entwicklungshilfe und/oder Umweltschutz. (Vgl.: Ebd.: 4)
Neben NABU, BUND und Greenpeace ist der WWF, der in dieser Arbeit näher betrachtet werden soll, sicherlich eine der bekanntesten Umweltschutzorganisationen in Deutschland
3.2 Die Ziele des WWF
„Die Zeit wird knapp, um die größten Bedrohungen des Lebens auf unserem Planeten noch abzuwenden. Wer seinen Kindern eine lebenswerte Umgebung hinterlassen will, weiß, daß er jetzt handeln muß.“ (WWF, 1999: 1)
Mit diesen Worten begründet der World Wide Fund for Nature (WWF) seine Arbeit, dessen oberstes Ziel es ist, die genetische biologische Vielfalt der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensräume für und mit dem Menschen zu bewahren. Die lebenswerte Umwelt soll für die nächste Generation erhalten werden. Es geht aber auch um die Erhaltung der natürlichen erneuerbaren Ressourcen wie Holz, vor allem auch durch Nachhaltigkeit. Zur Durchsetzung dieser Ziele sollen Wirtschaftsprozess und Maßnahmen gefördert werden, die zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung, Ressourcenund Energieverschwendung beitragen. (Vgl.: WWF, 1999: 2)
Die Arbeitsschwerpunkte des WWF sind drei Großlebensräume: Meere und Kü- sten, binnenländische Feuchtgebiete und Wälder. Die bedrohten Tierund Pflanzenarten dieser Lebensräume sollen dabei besonders durch den Aufbau von Naturschutzgebieten geschützt werden. (Vgl.: WWF, 1999: 1)
Natürlich sind diese Ziele Ergebnis einer langen Entwicklung seit der Gründung des WWF International 1961 mit dem Hauptsitz in der neutralen Schweiz, der damals noch World Wildlife Fund hieß. Die Namensänderung von 1986 zeugt von der Ausweitung der Arbeitsbereiche. In den achtziger Jahren fanden aber noch weitere Umorientierungen statt. So wurde zum einen Entwicklungszusammenarbeit mit dem Naturschutz kombiniert, und zwar aus dem Bewußtsein heraus, daß nur eine Förderung der weltweiten Entwicklung dem Umweltschutz auch global weiterhelfen wird. Im gleichen Zusammenhang stehen auch die neuen Prinzipien Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit, die der internationalen Interdependenz Rechnung tragen. (Vgl. Url: www.wwf.ch, Stand: 10. Mai 2001)
Die Umweltstiftung WWF Deutschland ist nun Teil des World Wide Fund for Nature. Da es nicht möglich war, die nötigen Informationen zu bekommen, soll sich diese Arbeit nun im Folgenden mit dem WWF Deutschland beschäftigen, der im Jahre 1963 gegründet wurde.
4. Aufbau und Struktur
Im Hinblick auf Entwicklung und Wachstum von Organisationen allgemein sind drei Phasen beobachtbar. Die Pionierphase, in der die Idee des Gründers oder des Gründerteams stark im Vordergrund stehen, herrschen familienartige Strukturen vor, die viel improvisieren. Die Kommunikation ist direkt und personenbezogen. Dabei sind jedoch Probleme wie Überlastung und sinkende Motivation möglich.
Diese Probleme werden in der Differenzierungsphase überwunden, in der die Organisation nach den Maßstäben, Systematik, Logik und Steuerbarkeit umstrukturiert wird. Dabei kommt es zu einer Standardisierung der Aufgabenbearbeitung und zu funktionaler Säulenbildung. Allerdings bestehen es in solch formalisierten Organisationen oft Überorganisation und die Entscheidungsprozesse sind eher langwierig. (Vgl.: Badelt, 1997: 191)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Non-Profit-Organisationen (NPO)?
Dieser Text behandelt das Thema Non-Profit-Organisationen (NPO) am Beispiel des WWF. Er bietet eine Einführung in das Thema, definiert den Begriff NPO, untersucht Tätigkeitsbereiche und Ziele des WWF, analysiert Aufbau und Struktur von NPOs, beleuchtet Projekte, Arbeitsweisen und Finanzierung, und diskutiert spezifische Problemstellungen.
Was ist das Ziel der Einleitung?
Die Einleitung dient dazu, den Begriff der Zivilgesellschaft im Kontext von Markt und Staat einzuführen und die Rolle von Non-Profit-Organisationen (NPO) als Ausdruck von Selbstverwaltung und Selbstorganisation zu erläutern. Sie betont die Bedeutung von Umweltverbänden wie dem WWF.
Wie definiert der Text den Begriff "Non-Profit-Organisation"?
Der Text distanziert sich von reinen Negativdefinitionen (z.B. Abgrenzung von gewinnorientierten Unternehmen oder dem Staat). Stattdessen werden verschiedene Charakteristika genannt: formale Organisation, private Trägerschaft, Einkommensquellen aus Spenden, Gewinnerwirtschaftung für den Organisationszweck, Selbstverwaltung, Unabhängigkeit und Freiwilligkeit.
Welche Tätigkeitsbereiche werden für NPOs genannt?
NPOs sind in verschiedenen Bereichen aktiv, darunter Kultur und Erholung (Museen, Sportvereine), Bildung und Erziehung (private Schulen, Kindergärten), Sozialwesen (Dienste für Alte, Behinderte, Randgruppen) sowie Interessensvertretung (Gewerkschaften, Umweltschutzorganisationen).
Welche Ziele verfolgt der WWF laut diesem Text?
Das oberste Ziel des WWF ist die Bewahrung der genetischen und biologischen Vielfalt von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen. Dazu gehört auch die Erhaltung natürlicher Ressourcen durch Nachhaltigkeit und die Förderung von Maßnahmen zur Verhinderung von Umweltverschmutzung.
Welche Arbeitsbereiche des WWF werden besonders hervorgehoben?
Die Arbeitsschwerpunkte des WWF liegen auf den Großlebensräumen Meere und Küsten, binnenländische Feuchtgebiete und Wälder. Der Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten durch den Aufbau von Naturschutzgebieten ist dabei zentral.
Welche Phasen der Organisationsentwicklung werden im Text erwähnt?
Der Text beschreibt drei Phasen: die Pionierphase (familienartige Strukturen, Improvisation), die Differenzierungsphase (Standardisierung, formale Strukturen) und die Integrationsphase (dezentralisierte Teamstrukturen).
Was ist die Umweltstiftung WWF Deutschland?
Die Umweltstiftung WWF Deutschland ist Teil des World Wide Fund for Nature. Der Text konzentriert sich auf den WWF Deutschland, der 1963 gegründet wurde.
- Quote paper
- Claudia Fritsche (Author), 2000, Non-Profit-Organisationen-das Beispiel des WWF, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105702