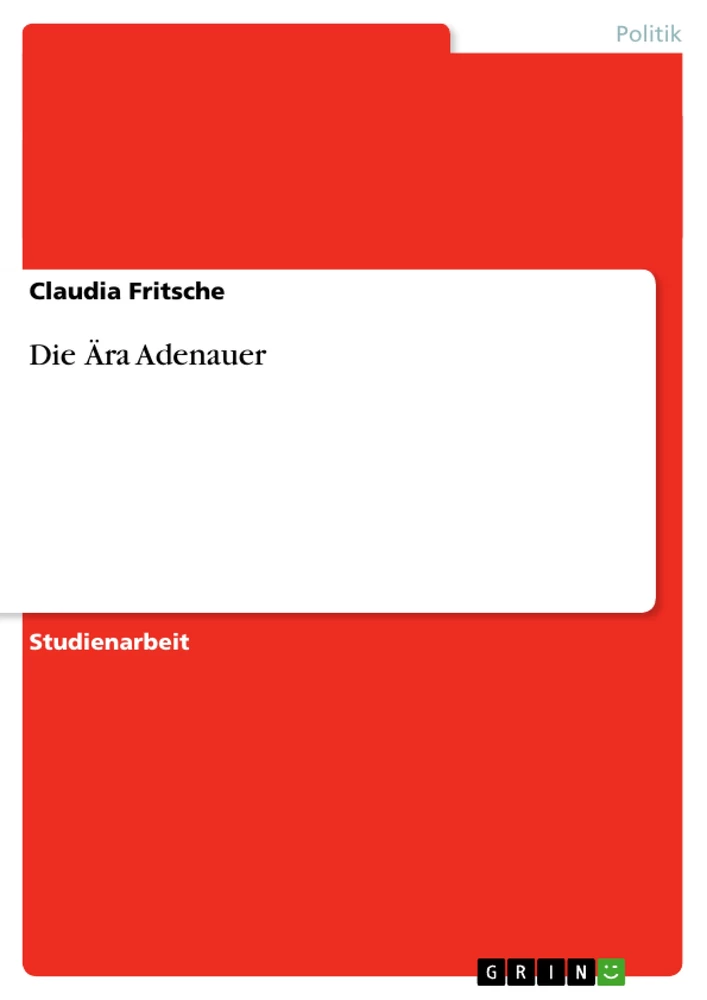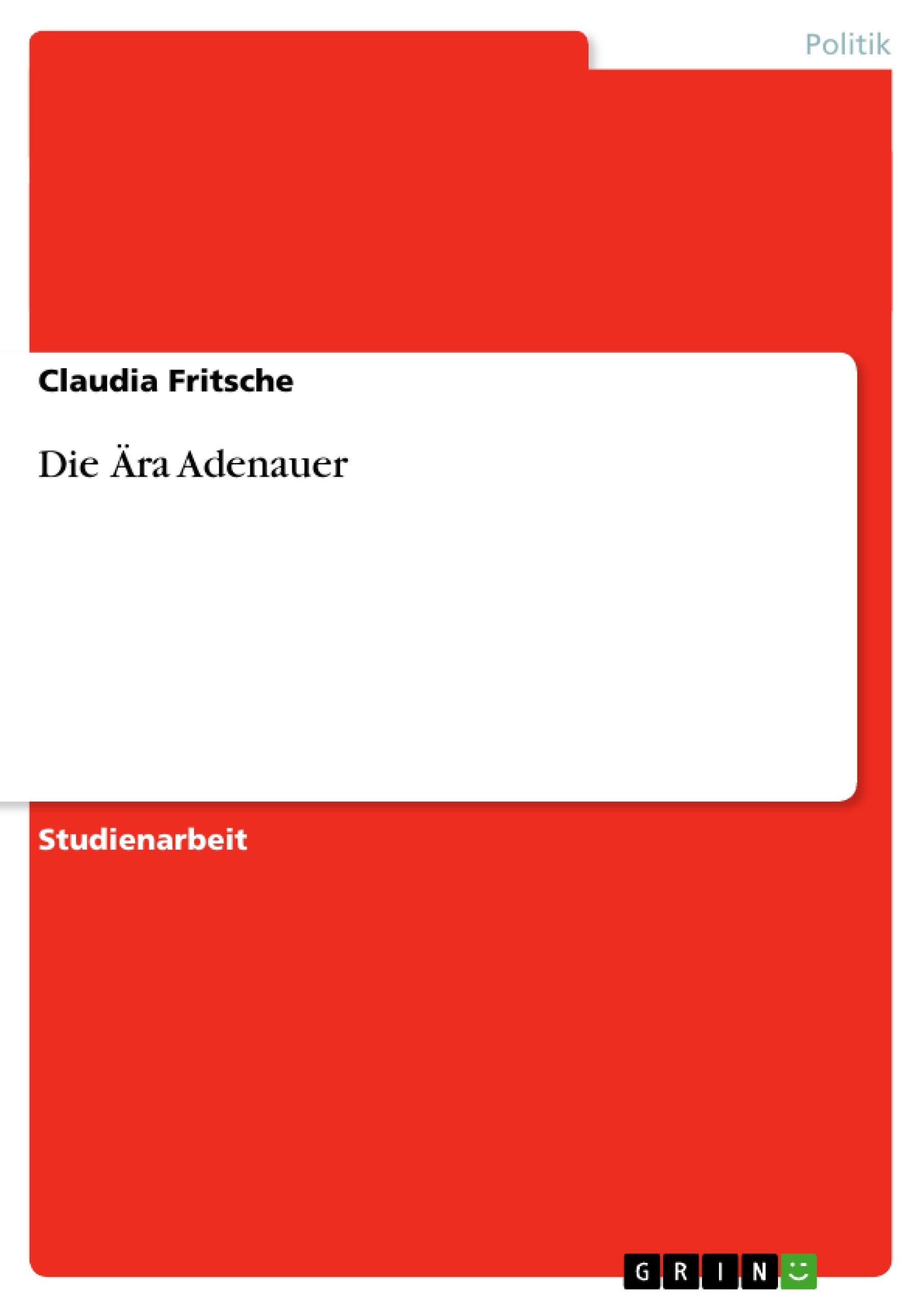Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Die innere Konsolidierung der Bundesrepublik
2.1 Das Wirtschaftswunder
2.2 Der Sozialstaat
2.3 Das Parteiensystem
3. Westintegration und Wiedererlangung staatlicher Souveränität
3.1 Die deutsch-französischen Beziehungen
3.2 Die europäische Integration
3.3 Die Wiederbewaffnung
4. Das Problem der deutschen Einheit
4.1 Die Westintegration als übergeordnetes Ziel
4.2 Der Alleinvertretungsanspruch und die Hallstein-Doktrin
4.3 Die Berlinkrise und der Bau der Berliner Mauer
5. Das Ende der Adenauer Ära
6. Fazit
7. Literatur
1. Einleitung
Konrad Adenauer wurde am 5. Januar 1876 in Köln geboren. Nach seinem Jura- studium fand er schon bald Interesse an der Politik und wurde 1917 als Mitglied des Zentrums Oberbürgermeister von Köln. Dieses Amt übte er, ebenso wie das Amt des Präsidenten des preußischen Stadtrates ab 1921, bis 1933 aus. Von den Nationalsozialisten wurde er jedoch zwangspensioniert. Während der Herrschaft der NSDAP wurde er zweimal von der Gestapo verhaftet, man sprach von De- pressionen, die ihn an den Rand des Selbstmordes brachten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahm er das Amt des Kölner Oberbürgermeisters kurzzeitig wieder ein, übernahm aber dann die Leitung der neugegründeten CDU, die als er- ste Partei zu einer sogenannten Volkspartei wird. Er wurde Präsident des Parla- mentarischen Rates und nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 15. September 1949 mit einer Stimme Mehrheit, nämlich seiner eigenen, zum er- sten bundesdeutschen Kanzler gewählt. Dieses Amt behielt er 14 Jahre, wobei der Höhepunkt seiner Macht sicherlich die Jahre 1957 bis 1961 darstellten, in denen er mit absoluter Mehrheit regieren konnte. (Vgl.: Pleticha, 1990: 291-297) Jedoch führten ab 1961vor allem auch Adenauers Reaktion auf den Bau der Berli- ner Mauer und die Spiegelaffäre zu einen Prestigeverlust des Bundeskanzlers. Diese manifestierten sich auch in einer immer ablehnenderen Haltung des Koaliti- onspartners, der FDP. Schließlich drängten auch CDU/CSU-Mitglieder auf einen Wechsel im Kanzleramt. Konrad Adenauer wurde am 11. Oktober 1963 dieser Stimmung mit seinem Rücktritt gerecht. Er starb am 19. April 1967 in Bad Hon- nef. Sein Nachfolger wurde Ludwig Erhard, bekannt als Vater des Wirtsschafts- wunders. (Vgl.: Ebd.)
Die Zeit Konrad Adenauers im Bundeskanzleramt wird noch heute die Ära Ade- nauer genannt. Da er der erste Kanzler nach dem Zweiten Weltkrieg war, der erste Kanzler in der neugegründeten Republik, diesem auf den Trümmern des Dritten Reiches errichteten neuen westdeutschen Staates, galten für ihn sicherlich beson- dere Bedingungen. Gerade deshalb bedeuteten seine Entscheidungen aber auch wichtige Weichenstellungen für die deutsche Politik - und das bis zum Ende des Ost-West-Konflikts.
Genau aus diesem Grund ist eine Betrachtung dieser Zeit auch für ausländische Wissenschaftler besonders interessant. Germany seen from abroad; Anthony Glees und Peter Pulzer stellen sich in ihren Texten nämlich nun die Frage, wie Konrad Adenauer mit der besonderen Situation, mit der deutschen Stellung in der Nachkriegszeit umging, wie er die Fragen nach deutscher Souveränität und deut- scher Einheit, aber natürlich auch nach der Sicherung des inneren Friedens löste. In dieser Arbeit sollen die Antworten und vor allem auch die Schwerpunktsetzun- gen der beiden Autoren betrachtet werden. Dabei werden drei Hauptaspekte be- rücksichtigt; zum Ersten, die Frage nach der inneren Konsolidierung der Bundes- republik, zum Zweiten die Westintegration und die Wiedererlangung staatlicher Souveränität und zum Dritten das Problem der deutschen Einheit. Nach einer kur- zen Einschätzung des Endes der Ära Adenauer soll dann im Fazit die Arbeit der Autoren kritisch beleuchtet werden.
2. Die innere Konsolidierung der Bundesrepublik
Nach der fast vollständigen Zerstörung Deutschlands durch den Zweiten Weltkrieg, die sich natürlich auch auf Moral und Psyche der Bevölkerung auswirken mußte, stellt die innere Konsolidierung der Bundesrepublik sicherlich einen wichtigen Faktor in der Politik der Nachkriegszeit dar.
Peter Pulzer weist darauf hin, daß nach der totalitären Erfahrung des Dritten Reiches dabei vor allem der Rückzug ins Private, in die Familie, der Rückkehr zur Moral von der Bevölkerung gewünscht wurde. Eine gewisse soziale Stabilität aufgrund des Scheiterns der Denazifikation und der Sozialisierung förderte so den Konservatismus, so daß die CDU als christliche Partei beider Kirchen punkten konnte (Vgl.: Pulzer, 1995: 52-54)
Insgesamt benennen Peter Pulzer, aber auch Anthony Glees drei Gesichtspunkte, die bei der inneren Konsolidierung, ja der Herstellung einer westdeutschen Gesellschaft eine Rolle spielten. Neben dem Grundgesetz waren das nämlich vor allem das Wirtschaftswunder, die Durchsetzung des Sozialstaats und das sich stabilisierende Parteiensystem. (Vgl.: Pulzer, 1995 und Glees, 1996)
2.1 Das Wirtschaftswunder
Der Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft auf der Basis von Kleinunterneh- mertum ermöglichte mit Hilfe des Marshallplans1und der Währungsreform2, aber dann vor allem aufgrund der Erhard’schen Wirtschaftspolitik die Erreichung von Wohlstand3zumindest für Viele. Das war nach der Not der Kriegs- und Nach- kriegszeit natürlich ein bedeutender Faktor für den sozialen Frieden (Vgl.: Pulzer, 1995: 54). Die Gründe des sogenannten Wirtschaftswunders lagen aber auch am Überschuss an Arbeitskräften und der dauerhaften Unterbewertung der deutschen Währung DM, die deutsche Produkte im In- und Ausland billig machten (Vgl.: Ebd.: 63). Die Koalition mit der FDP gewann durch ihren Einfluß auf die Preis- und Lohnliberalisierung im Besonderen auch für die weiteren Wahlerfolge Ade- nauers an Bedeutung (Vgl.: Ebd.: 55/62). Glees betont in diesem Zusammenhang auch die sich durch das Wirtschaftswunder verändernde Mentalität der Deutschen. Der Stolz auf die stabile DM4, das erneuerte Selbstbewußtsein gepaart mit dem Ideal der Tüchtigkeit, machten es nun fast beneidenswert, ein Westdeutscher zu sein. (Vgl.: Glees, 1996: 115) In Bezug auf die innere Konsolidierung schließt Pulzer: „The economic miracle helped to maintain social peace,“ (Pulzer, 1995: 63) er schränkt jedoch gleichzeitig ein: „it also needed social peace as a pre-con- dition“(Ebd.). Dieser soziale Frieden wurde nun durch die Durchsetzung des im Grundgesetz festgelegten Sozialstaatsprinzip5weiter befestigt, was der nächste Abschnitt behandeln soll.
2.2 Der Sozialstaat
Die Festlegung des Sozialstaatsprinzips im Grundgesetz wird sicherlich der deutschen Sozialstaatstradition seit Bismarck6gerecht (Vgl.: Pulzer, 1995: 64). Die stringente Durchsetzung dieses Prinzips durch die Adenauersche Politik steht aber sicherlich noch in einem anderen Zusammenhang.
In den ersten Nachkriegswahlen zeigte sich in vielen Staaten Europas ein deutli- cher Linksschwung, der sicherlich auch mit der sowjetischen Beteiligung am Sieg über Deutschland zu begründen ist. (Vgl.: Ebd.: 51) So hatte die SPD vor allem in Deutschland große Hoffnungen auf einen Wahlerfolg, hatte sie doch als einzige Partei 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz Hitlers gestimmt. (Vgl.: Ebd.: 52) Dennoch konnte sich in den ersten Nachkriegswahlen Adenauer knapp durchset- zen. Die starke Rolle der Gewerkschaften, die Mitbestimmung der Arbeiter in Betriebsräten und die Tarifautonomie wurden dann wohl aus wahltaktischen Gründen nie angetastet, um der SPD nicht noch mehr Wähler unter den Arbeitern zu bescheren. (Vgl.: Pulzer, 1995: 64 und Glees, 1996: 123) Die soziale Kompo- nente der Adenauerschen Politik funktionierte aber nicht nur als Gegenmodell zur SPD, die für viele Wähler aufgrund ihrer Ablehnung der sozialen Marktwirtschaft, die ja den neuen Wohlstand gebracht hatte, kaum als Alternative in Frage kam, sondern vor allem auch als Gegenmodell zum Sozialismus der DDR. (Vgl.: Pulzer, 1995: 65) Wie Glees betont, war die deutsche Nation ja zwischen Kapitalismus und Kommunismus zerrissen. (Vgl.: Glees, 1996: 116) Ein Kapitalismus mit sozialem Antlitz, der die Nachteile der Marktwirtschaft durch die Unterstützung von Benachteiligten, Familien und Rentner ausgleichen sollte, spielte daher für die Legitimation der Bundesrepublik gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik eine entscheidende Rolle. (Vgl.: Pulzer, 1995: 65)
2.3 Das Parteiensystem
Zwar konnte die SPD in den ersten Jahren der jungen Republik nie die Parlamentsmehrheit erlangen, denoch war sie die zweitstärkste Partei7, deren Stimmenanteil stetig zunahm und mit der die CDU/CSU durchausrechnen mußte. Es bestanden reale Chancen auf einen Machtwechsel, in diesem sich nun stabilisierendem Parteiensystem, was dieser Abschnitt behandeln soll.
Das Scheitern der Weimarer Republik ist sicherlich auch auf die Instabilität des Parteiensystems zurückzuführen. (Vgl.: Alter, Hufnagel u.a., 1989: 255) Die Be- trachtung des Parteiensystems der jungen Republik ist daher besonders im Hin- blick auf ihre innere Konsolidierung interessant. Daher ist es schwer verständlich, warum sich Anthony Glees kaum systematisch mit diesem Thema befasst. Anders Peter Pulzer; er stellt die Bedeutung des sich stabilisierenden Parteiensystems für die Entwicklung der Bundesrepublik deutlich heraus. Zum einen beobachtet er „a dual political system, with parties bearing the same label operating with different priorities and coalition strategies at the federal and sub-federal levels.“ (Pulzer, 1995: 56) Besonders die Regierungen auf Länderebene zeichnen sich dabei durch Pragmatismus und Unabhängigkeit von den Bundesparteien aus. Diese Unabhän- gigkeit läßt dabei auf eine gewisse Stärke bzw. eine funktionierende horizontale Gewaltenteilung schließen. (Vgl.: Ebd.: 55) In Bezug auf das Parteienspektrum macht Pulzer aber noch weitere Feststellungen. So stellt er nämlich das Verbot von radikalen Parteien, wie das der SRP (Sozialistische Reichspartei) 1952 und das der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) 1956 durch das Bundesver- fassungsgericht heraus. Die Anzahl der Parteien wird durch die neue Fünf-Pro- zent-Klausel weiter eingeschränkt, so daß neben den Volksparteien CDU/CSU und SPD, die FDP und der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) als einzige Klientel- bzw. Minderheitenparteien bestehen bleiben. (Vgl.: Ebd.: 61) Jedoch verliert der BHE durch die fortschreitende Integration bald auf Bundes- ebene und in den sechziger Jahren dann auch auf Länderebene vollständig an Be- deutung. (Vgl.: Ebd.: 60)
Insgesamt kann man also schließen, daß sich während der Ära Adenauer ein sta- biles Parteiensystem etablierte. Sicherlich war dies ein Faktor des sozialen Frie- dens.
Doch nicht nur Innenpolitik, sondern auch Adenauers Erfolge in der Außenpolitik trugen zum inneren Frieden der BRD bei. So ist besonders die gelungene Westin- tegration zu nennen, die dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gerecht wurde. Dieses stellte nämlich die Sicherheit vor dem Sowjetsozialismus über das dennoch bestehende Ziel der deutschen Einheit. (Vgl.: Ebd.: 62) Das folgende Kapitel wird diesen Aspekt im Hinblick auf die Wiedererlangung staatlicher Souveränität anhand dreier Gesichtspunkte näher erläutern.
3. Westintegration und Wiedererlangung staatlicher Souveränität
Die Westintegration gehörte neben der Wiedererlangung staatlicher Souveränität zu Adenauers wichtigsten Zielen. (Vgl.: Pulzer, 1995: 56) So sind auch besonders die Beziehungen zu den USA für die BRD sehr bedeutsam. (Vgl.: Glees, 1996: 117) In diesem Zusammenhang sind noch drei andere Aspekte zu betrachten.
3.1 Die deutsch-französischen Beziehungen
Pulzer stellt die Bedeutung der Aussöhnung der ehemaligen Erbfeinde deutlich heraus (Vgl.: Pulzer, 1995: 56), und Glees bezeichnet sowohl Frankreich als wichtigsten Partner Deutschlands als auch umgekehrt (Vgl.: Glees, 1996: 116). Und schließlich waren auch nach der Regelung des Saarstatuts81957 die wichtig- sten Divergenzen überwunden. (Vgl.: Pulzer, 1995: 59) Dabei mußten aber die französischen Sicherheitsinteressen beachtet werden, so daß ein nur geringer Sou- veränitätsgewinn zu erwarten war. (Vgl.: Ebd.: 56). Glees betont dabei die Person Charles de Gaulles, der 1958 zum französischen Präsidenten gewählt worden war.
Vor ihm hatte Adenauer wohl viel Respekt. (Vgl.: Glees, 1996: 124) Er erwähnt aber auch die Zerrissenheit Deutschlands zwischen seinen beiden wichtigsten Partnern, den USA und Frankreich.Diese wurde natürlich stark gefördert durch die Ambivalenz der französisch-amerikanischen Beziehungen, besonders unter de Gaulle. So führt er das erneute Gewicht der deutsch-französischen Beziehungen nach 1960, als deren bedeutenstes Zeichen der deutsch-französische Elysee- Vertrag9von 1963 gilt, vor allem auf Adenauers Probleme mit dem neu gewählten Präsidenten J. F. Kennedy zurück. (Vgl.: Ebd.: 132) Am wichtigsten war die neue Partnerschaft der alten Feinde aber für die europäische Integration, bei der Deutschland und Frankreich eine Motorrolle spielten10. (Vgl.: Ebd.)
3.2 Die europäische Integration
Tatsächlich steht die rasche europäische Integration nach Ende des Zweiten Welt- kriegs ganz eindeutig im Zusammenhang der Aussöhnung Deutschlands und Frankreichs. So bot die durch den Schuman-Plan 1950 initiierte Montanunion11(EGKS) nicht nur Frankreich die Möglichkeit der Kontrolle über die deutsche Kohl- und Stahlindustrie. Sie war auch für Deutschland die Chance, auf der Basis von Gleichheit mit anderen europäischen Staaten zu kooperieren. Da die nationale Idee in der BRD moralisch diskreditiert war, stellte die europäische Ebene ein besseres Feld, um nationale Interessen durchzusetzen. (Vgl.: Pulzer, 1995: 57) Opposition gegen diese Integration kam zum einen von Seiten der SPD, die be- fürchtete, daß die Einheit so in die Ferne rückte (Vgl.: Ebd.), zum anderen aber auch von Ludwig Erhard, der sich gegen die Beschränkung wirtschaftlicher Inte- gration auf das Gebiet Europas äußerte (Vgl.: Glees, 1996: 123).
Die europäische Integration, die Adenauer aus Angst vor dem Kommunismus auch gern auf die Politik ausgedehnt hätte (Vgl.: Ebd.: 124), stand jedoch auch mit den römischen Verträgen121957 gänzlich in der Logik der Westintegration (Vgl.: Pulzer, 1995: 58). Diese setzen bis 1969 den gemeinsamen Markt durch, und die Entscheidung für den deutschen Politiker Hallstein als ersten Kommissionspräsidenten bedeutete eine erhebliche Erhöhung westdeutschen Prestiges auf internationaler Ebene. (Vgl.: Glees, 1996: 123/124)
3.3 Die Wiederbewaffnung
Die Frage nach einer Wiederbewaffnung Deutschlands sollte zunächst auch im europäischen Rahmen gelöst werden. Angesichts des Koreakrieges 195013kommt es zur Kontroverse über die Einbindung der BRD in eine gemeinsame Verteidi- gung. Und tatsächlich schlug Adenauer auch einen westdeutschen Verteidigungs- beitrag vor. Doch scheiterte die europäische Lösung einer EVG14(Europäische Verteidigungsgemeinschaft) 1954 an der französischen Nationalversammlung. (Vgl.: Pulzer, 1995: 58/59) Dennoch soll die BRD nun einen Beitrag leisten, die BRD wird 1955 Mitglied der NATO15, erklärt sich jedoch bereit, keine ABC- Waffen zu produzieren und die bestehenden Grenzen zu respektieren. Durch die- sen Beitritt kam es auch zur Revision des Besatzungsstatuts, Deutschland erhielt seine Souveränität bis auf allierte Vorbehaltsrechte in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes zurück. Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik stößt jedoch auf lebhaften Protest, den Peter Pulzer, als „the first significant political mass mobilization in post-1945 Germany“ (Ebd.: 59) bezeichnet. Gemeint ist die Paulskirchenbewegung, deren berühmtester Vertreter sicherlich Gustav Heine- mann ist. Gustav Heinemann, der sogar unter Adenauer Innenminister gewesen war, trat aus Protest aus der CDU aus und der SPD bei. Pulzer weist auf weitere Proteste hin, als Adenauer 1957 amerikanische Atomwaffen in Deutschland sta- tionieren lassen will.(Vgl.: Ebd.: 60)
Diese Kontroverse betrachtet Anthony Glees näher, der sich weniger mit der ei- gentlichen Wiederbewaffnung befasst. Hier beschäftigt er sich vor allem mit der Rolle von Verteidigungsminister Franz Josef Strauss, der Atomwaffen, in Form von Sprengköpfen amerikanischer Raketen, auf deutschem Boden forderte. (Vgl.: Glees, 1996: 121-123) Die entsprechende Bundestagsdebatte zeichnete sich durch die Opposition der SPD aus. (Vgl.: Ebd.: 125) Die Kosten für diese Stationierung sollte vor allem von der BRD selber getragen werden, da sie ja für ihre eigene Si- cherheit erfolgte. (Vgl.: Ebd.: 128)
Insgesamt kann die Westintegration jedoch als konsequent und äußerst erfolgreich bezeichnet werden. Die innerdeutsche Trennung wurde aber durch sie vertieft. Die deutsche Einheit rückte so in die Ferne. (Vgl.: Pulzer, 1995: 59)
4. Das Problem der deutschen Einheit
4.1 Die Westintegration als übergeordnetes Ziel
Neben den Zielen der Wiedererlangung staatlicher Souveränität und der Westinte- gration, die Adenauer ja so konsequent verfolgte, bestand immer auch das Ziel der deutschen Einheit. (Vgl.: Pulzer, 1995: 56) Jedoch hatte die Westintegration vor allem aus Angst und Hass gegenüber dem Sowjetsozialismus, auch in der Bevöl- kerung, für Adenauer immer übergeordnete Priorität. (Vgl.: Ebd.: 52) Glees be- richtet, daß Adenauer dem Kalten Krieg sogar Positives abgewinnen konnte, da er die Westintegration der BRD befestigte und schützte. (Vgl.: Glees, 1996: 130) Da die Westintegration aber auch die militärische Dimension der NATO beinhaltete, wurde die deutsche Einheit zu einem langfristigen Ziel. (Vgl.: Pulzer, 1995: 56) In diesem Zusammenhang ist auch die Adenauersche Ablehnung der Stalinnoten16 1952 (Vgl.: Ebd.: 58) zu verstehen. Da die Einheit jedoch nur unter sowjetischen Bedingungen zu haben war, bot sie für den deutschen Bundeskanzler keine Alter- native. „He was at no stage interested in a special deal with the Soviet Union.“ (Ebd.: 56) So auf die Westintegration bestehend, konnte die Wahl Kennedys zum amerikanischen Präsidenten, der ja gerade auch für seine neuen Ideen im Hinblick auf die Beziehung der USA zum Kommunismus bekannt war, für Adenauer nur problematisch erscheinen. (Vgl.: Glees, 1996: 130) Genauso hatte ihn ja schon die Genfer Konferenzen der Alliierten über die deutsche Frage im Jahre 1955 beunruhigt. Befürchtete er doch, daß sich die Alliierten über seinen Kopf hinweg in der deutschen Frage einigen würden. Chruschtschov hatte ja, wie schon Stalin die Einheit Deutschlands gegen Neutralität in Aussicht gestellt. (Vgl.: Ebd.: 119) Die Berlin- und die Kubakrise17gaben Adenauers Einschätzung über die Gefährlichkeit des Sowjetsozialismus jedoch recht. (Vgl.: Ebd.: 130)
4.2 Der Alleinvertretungsanspruch und die Hallstein-Doktrin
Aus seiner Ablehnung des Sozialismus auch in der DDR und der Überzeugung, diese sei illegitim, erklärt sich auch der Alleinvertretungsanspruch, den Konrad Adenauer mit der Regierung der BRD für das gesamte deutsche Volk in Anspruch nahm. Ein deutliches Zeichen seiner Nichtanerkennung der DDR setze Adenauer bei seinem Besuch 1955 in Moskau. Er wies darauf hin, daß zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein deutscher Repräsentant zu Verhandlungen nach Mos- kau komme. (Vgl.: Glees, 1996: 119) Aus diesem Alleinvertretungsanspruch, „the Federal Republic’s claim to the right of sole representation, which the Soviets, having dealt with the GDR for six years could only regard as provocative,“ (Ebd.) resultierte aber eine Politik, die die westdeutschen Beziehungen zu sämtlichen Ostblockstaaten in Frage stellte. Diese Politik wurde Hallstein-Doktrin genannt, nach der die Bundesrepublik die diplomatischen Beziehungen zu jedem Staat mit Ausnahme der UdSSR abbrach oder gar nicht erst aufnahm, die die DDR aner- kannten. (Vgl.: Pulzer, 1995: 68) Diese Politik hatte Erfolg, „apart from Yugosla- via only Cuba chose to exchange relations with the GDR for those with Bonn.“ (Glees, 1996: 125) Jedoch wurde es für die Bundesrepublik im Grunde unmög- lich, Beziehungen zu osteuropäischen Staaten aufzunehmen. (Vgl.: Ebd.)
4.3 Die Berlinkrise und der Bau der Berliner Mauer
Zu dieser Frage äußert sich Pulzer nur kurz (Vgl.: Pulzer, 1995: 69), Glees beob- achtet diese Periode aber genauer. Die deutsche Einheit ließ sich nach sowjeti- schen Bedingungen nämlich nicht realisieren. Die westlichen Alliierten erklärten sich ebenfalls nicht zu einer Anerkennung der deutschen Teilung bereit, die sich in Friedensverträgen mit beiden deutschen Staaten hätte ausdrücken müssen. (Vgl.: Glees, 1996: 130) So drängte Chruschtschov ab 1958 zumindest auf eine Lösung der Berlinfrage. Am 27. November forderte er ultimativ, „that West Ber- lin should be made a free city within six months and that the Western allies should leave.“ (Ebd.: 126) Dies hätte letztlich die völlige Einverleibung Berlins in die DDR bedeutet, mit der die Sowjetunion einen separaten Friedensvertrag abschlie- ßen wollte, falls die Westmächte zu einer Normalisierung in Berlin nicht bereit seien. Die Westmächte lehnten dieses Ultimatum im Dezember jedoch ab. (Vgl.: Ebd.)
Trotz der Wahrung des Status Quo konnten die Westalliierten aber nicht verhin- dern, daß die DDR-Führung am 13. August 1961 eine Mauer quer durch Berlin errichten ließ. So glaubte sie, die massenhafte Flucht18der Menschen in den We- sten und den damit verbundenen ökonomischen Verlust unterbinden zu können. (Vgl.: Ebd.: 131)
5. Das Ende der Adenauer Ära
Nach Glees zeigte schon Adenauers Reaktion auf den Mauerbau, sein fehlendes Verständnis für die Bevölkerung, daß er der aktuellen Politik nicht mehr. gewach- sen war. (Vgl.: Glees, 1996: 132) Daß seine Zeit vorbei war, zeigte auch die Spiegelaffäre 1962. Der Spiegel veröffentlichte einen Artikel über die Bundes- wehr, der auf geheimen Material beruhte. Unter dem Vorwurf des Landesverrats wurden der Herausgeber R. Augstein und mehrere Redakteure verhaftet und die Redaktion längere Zeit polizeilich besetzt. Dieses Vorgehen löste heftige öffentli- che Reaktionen aus, unter deren Druck der Verteidigungsminister Franz-Josef Strauss zurücktreten musste. Juristisch blieb die Aktion aber ohne Ergebnis. Doch auch auf Bundeskanzler Adenauer warf die Spiegelaffäre kein gutes Licht. War er zu weit gegangen, um sein Deutschland zu schützen? (Vgl.: Ebd.: 135) „Adenauer still believed his model Germany was still just a construct, that needed to be pro- tected at all costs, but also […] he wanted to control affairs of state.“ (Ebd.) Der Eindruck, Adenauer sei nicht mehr der Mann der Stunde, der sich in innerparteilichen Divergenzen, aber auch im Drängen des Koalitionspartners FDP, den Bundeskanzler zu ersetzen, äußerte, war aber nicht das ursprüngliche Ende der Ära Adenauer. (Vgl.: Pulzer, 1995: 60)
Dieses Ende wurde schon durch den Lernprozess innerhalb der SPD eingeleitet, die mit dem Godesberger Programm 1959 erst zu einer Volkspartei und so zu ei- ner ernsthaften Konkurrenz der CDU/CSU werden konnte. Vorher hatte die SPD „the reputation of a party that always said no.“ (Ebd.: 69) Mit dem Godesberger Programm akzeptierten sie jedoch die Marktwirtschaft, mit soviel Wettbewerb wie möglich und soviel Planung wie nötig. (Vgl.: Ebd.: 70) Nach seinem Rücktritt am 11. Oktober 1963 wurde Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders bis 1966 Bundeskanzler. Was läßt sich nun insgesamt über die Konsequenzen der Ära Adenauer sagen? Sicher ist, daß Adenauers Politik immer im Schatten der Supermächte agieren musste. (Vgl.: Glees, 1996: 116) Doch nach dem Dritten Reich ist es erstaunlich, wie auch eine Versöhnung mit den Juden und dem jungen Staat Israel erreicht worden ist. (Vgl.: Pulzer, 1995: 67) Eine weitere Leistung in Bezug auf die deutsche Vergangenheit war bestimmt die Depolitisierung des Pa- triotismus, der sich nun nur noch auf „poets and their mountains, the recieved economy and ther sporting heroes“ (Ebd.: 68) konzentrierte. Dennoch führte aber die innere Verdrängung der NS-Zeit, die fehlende Verarbeitung dieser Vergan- genheit, sicherlich zu den Umwälzungsprozessen aber auch Unruhen Ende der sechziger Jahre, deren radikale Ausläufer die BRD durch den RAF-Terrorismus in Atem hielt. (Vgl.: Ebd.: 67)
6. Fazit
Was läßt sich nun insgesamt zu den Arbeiten von Anthony Glees und Peter Pulzer sagen? Das Gewicht, daß die außenpolitischen Entscheidungen und Einstellungen einnehmen, ist sicherlich durch die besondere Geschichte Deutschlands erklärlich. Für ausländische Wissenschaftler sind diese Fragen natürlich besonders interes- sant. Jedoch muß man sich abschließend die Frage stellen, ob in einer jungen De- mokratie mit einer solch totalitären Vergangenheti nicht eher die Demokratisie- rungserfolge bewertet werden sollten, als die außenpolitischen Erfolge eines auto- ritären Bundeskanzlers. Zwar erwähnt Peter Pulzer den Begriff der Kanzlerdemo- kratie und den autoriären Regierungsstil Konrad Adenauers (Vgl.: Pulzer, 1995: 66). Er läßt auch das Scheitern der Denazifikation nicht außer acht (Vgl.: Ebd.: 53). Daß diese Beobachtungen jedoch keinerlei Anlaß zu kritischer Reflexion über die Qualität der westdeutschen Demokratie zu sein scheinen, ist kaum ver- ständlich. Dies, und das wird bei Anthony Glees Arbeit noch deutlicher, ist Aus- druck eines besonderen Demokratieverständnis‘, in dem außenpolitische Erfolge einzelner Personen mehr gelten als eine demokratischer Regierungsstil. Außerdem scheint der Verlauf der Geschichte Adenauer ja recht zu geben. Letztendlich ging der Kommunismus unter, eine deutsche Einheit konnte mit Westintegration erfol- gen. Und ironischerweise mußte nicht Adenauer die Konsequenzen der fehlenden Verarbeitung des Dritten Reiches tragen, sondern seine späteren Nachfolger Kie- singer, Brandt und Schmidt, von denen nur Kiesinger kein Sozialdemokrat war, aber von einer Koalition mit sozialdemokratischer Beteiligung getragen wurde.
7. Literatur
- Alter, Peter; Hufnagel, Gerhard u.a. (1989): Grundriss der Geschichte, Band 2, Stuttgart: Klett, S. 232-404.
- Andersen, Uwe; Woyke, Wichard (Hrsg.) (2000): Handwörterbuch des politi- schen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 4. Auflage, Opladen: Leske und Budrich.
- Glees, Anthony (1996): Reinventing Germany. German Political Development Since 1945, Oxford/Washington: Berg, S. 115-140.
- Große, Ernst Ulrich; Lüger, Heinz-Helmut (1996): Frankreich verstehen, 4. Auflage, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 349-379.
- Lehmann, Hans Georg (1996): Deutschland-Chronik 1945 bis 1995, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Pleticha, Heinrich (Hrsg.) (1990): Weltgeschichte, Band 13, Gütersloh: Ber- telsmann Lexikon Verlag, S. 291-297.
- Pulzer, Peter (1995): German Politics 1945-1995, Oxford: Oxford University Press, S. 51-90.
- Weidenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang (Hrsg.) (2000): Europa von A bis Z, Bonn: Europa Union Verlag, S. 439-448.
[...]
1Am 5. Juni 1947 verkündet US-Außenminister George Marshall ein europäisches Hilfs- und Wiederaufbauprogramm, an dem Deutschland teilhaben soll. (Vgl.: Lehmann, 1996: 24)
2Die am 21. Juli 1948 durchgeführte Währungsreform brachte mit der Einführung der Deutschen Mark (DM) eine weitestgehende Enteignung des Geldvermögens. Die starke Begünstigung des Sachvermögens wurde nur in Grenzen korrigiert. (Vgl.: Andersen; Woyke, 2000: 638)
3 Dieser Wohlstand drückte sich dann unter anderem in den Konsumwellen, der Fress-, Urlaubsund der Autowelle aus. (Vgl.: Glees, 1996:115)
4Pulzer betont die Rolle der Bundesbank für diese Währungsstabilität (Vgl.: Pulzer, 1995:63)
5Grundgesetz, Artikel 20 (1): „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“
6 Otto von Bismarck setzte 1882-1884 Kranken-, Invaliden und Altersversicherung ein, um die Arbeiter für den monarchischen Obrigkeitsstaat zu gewinnen. (Vgl.: Pleticha, 1990: 258)
7 Die Stimmanteile der SPD während der Adenauer Ära stiegen von 28,2% im Jahre 1949 auf 36,2% im Jahre 1961. (Vgl.:Andersen; Woyke, 2000: 688)
8 Im Jahre 1955 wurde ein Referendum über die Europäisierung des Saarlandes abgehalten, das je- doch abgelehnt wurde, so daß das Saarland der Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1957 nach dem ehemaligen Artikel 23 des GG beitreten konnte. (Vgl.: Andersen; Woyke, 2000: 335- 338)
9Im bundesdeutschen Parlament war die Ratifizierung des Vertrages jedoch nur nach Zusatz einer Präambel möglich, die die NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik und die Partnerschaft zwischen Westeuropa und der USA betonte. (Vgl.: Große; Lüger, 1996: 356)
10Diese Motorrolle kam im Laufe der Geschichte öfter zum Tragen, so z.B. auch durch Valery Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt, oder durch Helmut Kohl und François Mitterrand. (Vgl.: Große; Lüger, 1996: 349-378)
11 Der Vertrag über die EGKS wurde am 18. April 1951 zwischen Frankreich, Italien, der BRD und den Benelux-Staaten (die „Sechs“) unterzeichnet. (Vgl.: Weidenfels; Wessels, 2000: 439)
12Die römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) wurden am 25. März 1957 von den „Sechs“ unterzeichnet. (Vgl.: Weidenfels; Wessels, 2000: 439)
13Am 25. Juni 1950 griffen - vermutlich mit Billigung der Kreml-Führung - nordkoreanische Truppen Südkorea mit dem Ziel an, das dortige Regime zu verjagen und das Land wiederzuvereinigen. Die Angst vor einem ähnlichen Vorgehen der neugegründeten NVA brachte einen deutschen Verteidigungsbeitrag ins Spiel. (Vgl.: Alter; Hufnagel u.a., 1989: 345)
14Am 27. Mai 1952 unterzeichneten die „Sechs“ den Vertrag zur Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG), am 10. März 1953 wird ein Vertragsentwurf für eine Europäi- sche Politische Gemeinschaft (EPG) vorgelegt. EVG und die damit verknüpfte EPG scheitern je- doch am 30. August 1954 an der französischen Nationalversammlung. (Vgl.: Weidenfels; Wessels, 2000: 439)
15 Durch die Pariser Verträge vom 5. Mai 1955 legten nicht nur den Beitritt der BRD zur NATO sondern auch den Beitritt Italiens und der BRD zum Brüsseler Pakt fest, der seit diesem Datum WEU (Westeuropäische Union) heißt. (Vgl.: Alter; Hufnagel u.a., 1989: 346)
16Die Stalinnoten stellten den Höhepunkt einer diplomatischen Offensive gegen die deutsche Wiederbewaffnung dar. Nach den zwei Noten Stalins an die Westmächte sollte im Rahmen eines Friedensvertrages und aufgrund freier Wahlen ein gesamtdeutscher aber neutraler Staat westlich der Oder-Neiße-Linie entstehen. (Vgl.: Alter; Hufnagel u.a.; 1989: 347)
17 Die Kubakrise stellte zugleich Höhe- und Wendepunkt des kalten Krieges dar, als sowjetische Mittelstreckenraketen 1962 auf Kuba stationiert werden sollten. Präsident J. F. Kennedy forderte den Abbau der schon montierten Abschußbasen und verhängte eine Seeblockade. Chruschtschov lenkte schließlich ein. (Vgl.: Alter; Hufnagel u.a., 1989: 351)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text analysiert die Ära Adenauer in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er betrachtet insbesondere die innere Konsolidierung, die Westintegration und die Frage der deutschen Einheit.
Welche Aspekte der inneren Konsolidierung werden behandelt?
Die innere Konsolidierung wird anhand des Wirtschaftswunders, der Durchsetzung des Sozialstaats und der Stabilisierung des Parteiensystems betrachtet.
Was wird unter dem "Wirtschaftswunder" verstanden?
Das "Wirtschaftswunder" bezieht sich auf den schnellen Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft nach dem Krieg, ermöglicht durch den Marshallplan, die Währungsreform und die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards.
Welche Rolle spielte der Sozialstaat in der Ära Adenauer?
Der Sozialstaat trug zur sozialen Stabilität bei und diente als Gegenmodell zum Sozialismus der DDR. Er sollte die Nachteile der Marktwirtschaft ausgleichen und die Legitimität der Bundesrepublik stärken.
Wie stabilisierte sich das Parteiensystem in der jungen Republik?
Das Parteiensystem stabilisierte sich durch das Verbot radikaler Parteien und die Einführung der Fünf-Prozent-Klausel. Es etablierte sich ein duales System mit Parteien auf Bundes- und Länderebene.
Was bedeutet "Westintegration"?
Westintegration bezieht sich auf die Einbindung der Bundesrepublik in westliche Bündnisse und Organisationen, insbesondere die Beziehungen zu den USA und Frankreich, die europäische Integration und die Wiederbewaffnung.
Wie wurden die deutsch-französischen Beziehungen verbessert?
Die deutsch-französischen Beziehungen wurden durch die Aussöhnung der ehemaligen "Erbfeinde" und den deutsch-französischen Élysée-Vertrag von 1963 verbessert.
Welche Rolle spielte die europäische Integration?
Die europäische Integration, initiiert durch den Schuman-Plan und die Montanunion, bot Deutschland die Chance zur Kooperation auf der Basis von Gleichheit und ermöglichte die Durchsetzung nationaler Interessen auf europäischer Ebene.
Wie verlief die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik?
Die Wiederbewaffnung erfolgte im Rahmen der NATO-Mitgliedschaft 1955, wobei die Bundesrepublik auf die Produktion von ABC-Waffen verzichtete und die bestehenden Grenzen respektierte.
Welche Rolle spielte das Problem der deutschen Einheit in der Politik Adenauers?
Obwohl die deutsche Einheit ein Ziel blieb, hatte die Westintegration für Adenauer oberste Priorität, vor allem aufgrund der Angst vor dem Sowjetsozialismus.
Was war der Alleinvertretungsanspruch?
Der Alleinvertretungsanspruch war die Haltung der Bundesrepublik Deutschland, als einzige legitime Vertretung des gesamten deutschen Volkes zu gelten, was die Beziehungen zu Ostblockstaaten erschwerte.
Was war die Hallstein-Doktrin?
Die Hallstein-Doktrin besagte, dass die Bundesrepublik Deutschland die diplomatischen Beziehungen zu jedem Staat abbrach oder nicht aufnahm, der die DDR anerkannte, mit Ausnahme der UdSSR.
Was waren die Ursachen für das Ende der Ära Adenauer?
Adenauers Reaktion auf den Mauerbau, die Spiegel-Affäre und ein generelles Gefühl, dass er der aktuellen politischen Lage nicht mehr gewachsen war, trugen zu seinem Rücktritt bei. Hinzu kam der Lernprozess der SPD, die mit dem Godesberger Programm zu einer echten Konkurrenz wurde.
Welches Fazit ziehen die Autoren über die Ära Adenauer?
Die Autoren loben Adenauers außenpolitische Erfolge, kritisieren aber auch seinen autoritären Regierungsstil und das mangelnde Aufarbeiten der NS-Vergangenheit.
- Quote paper
- Claudia Fritsche (Author), 2000, Die Ära Adenauer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105701