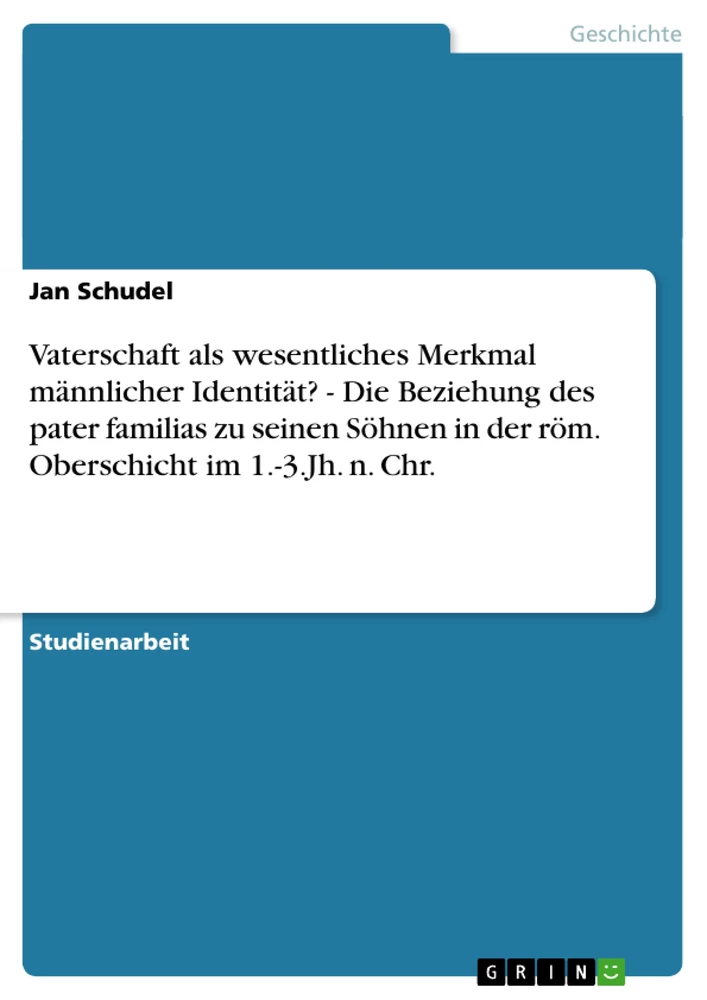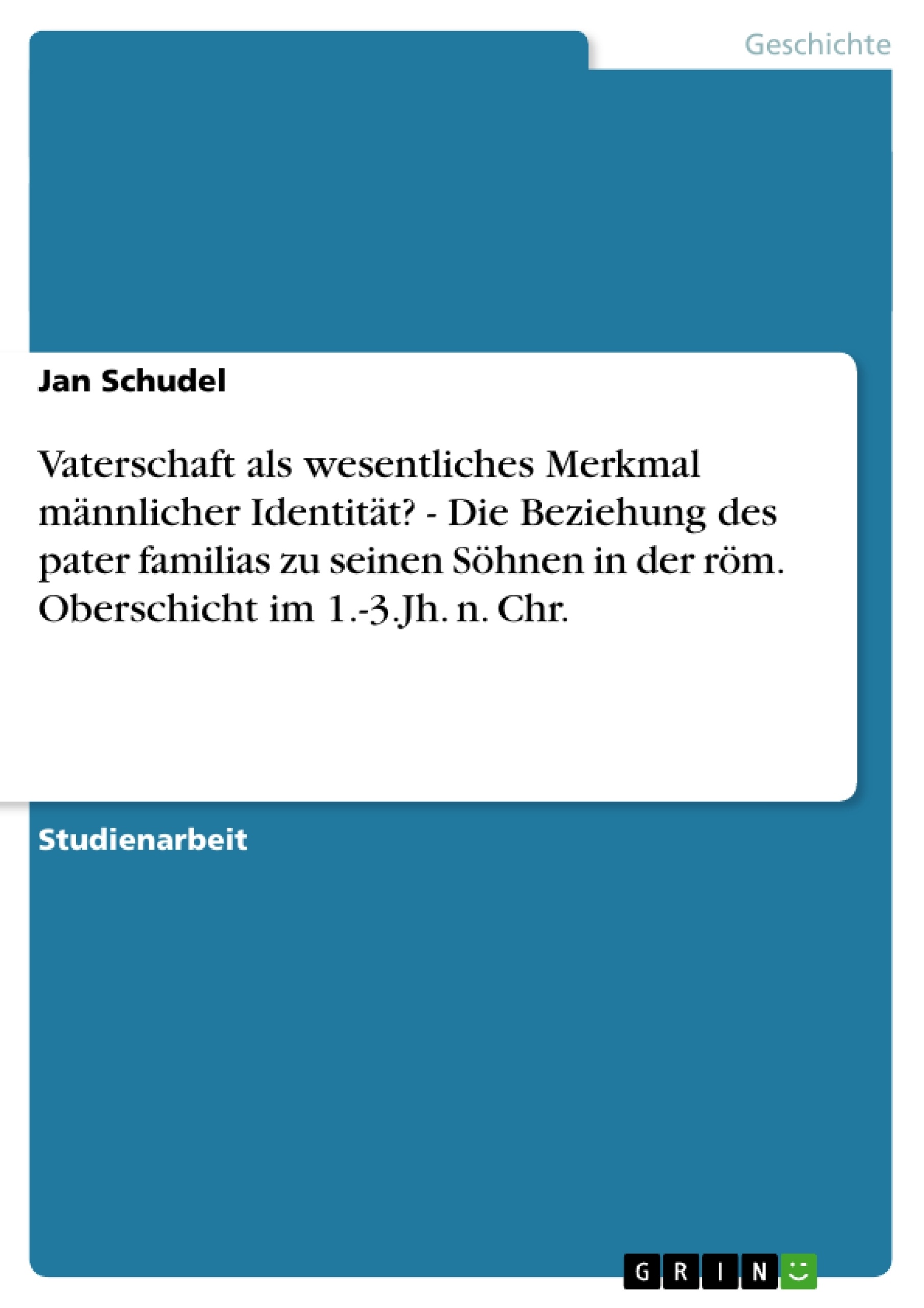Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Vaterschaft nicht nur eine biologische Tatsache, sondern der Eckpfeiler der männlichen Identität und gesellschaftlichen Ordnung ist. Dieses Buch entführt Sie in das Rom des Prinzipats, eine Epoche, in der der pater familias über Leben und Tod seiner Familie entschied, in der Söhne bis ins hohe Alter rechtlich unmündig blieben und in der die Fortpflanzung zum Staatsakt erhoben wurde. Tauchen Sie ein in die komplexen Machtstrukturen der römischen domus, in der die patria potestas des Vaters unantastbar schien, aber durch soziale Normen und politische Realitäten subtil untergraben wurde. Erfahren Sie, wie die römische Oberschicht mit Fragen der Nachfolge, des Erbes und der ehelichen Treue rang, während sie versuchte, ihre privilegierte Position in einer sich wandelnden Welt zu bewahren. Entdecken Sie die überraschenden Praktiken der "Gebär-Mütter"-Zirkulation, bei denen Frauen ausgeliehen wurden, um die Reproduktion sicherzustellen, und die subtilen Verschiebungen in der Sexualmoral, die den Aufstieg des Christentums vorbereiteten. Untersuchen Sie die Rolle der Söhne als "virtuelle Männer", gefangen zwischen Gehorsam und dem Wunsch nach Autonomie, und die Bedeutung der Adoption als Mittel zur Sicherung der Familienehre und des Fortbestands. Anhand von Rechtstexten, literarischen Quellen und archäologischen Funden zeichnet dieses Buch ein faszinierendes Bild der römischen Gesellschaft, in der die Vaterschaft nicht nur ein persönliches Schicksal, sondern eine politische und soziale Notwendigkeit war. Es werden die Begriffe pater familias, domus und familia erläutert. Es wird der gesellschaftlich-politische Hintergrund dieser Arbeit erläutert: Der römische Staat wurde zur Zeit des Prinzipats von den drei gesellschaftlichen Sektoren Heer, Senat und plebs urbana getragen. Die Vorstellung von Vaterschaft in der stadtrömischen Oberschicht des 1. bis 3. Jahrhunderts n. u. Z. wird behandelt. Der pater familias verfügte als chef de clan formal über eine beinahe unbeschränkte Macht über seine domus, in der Praxis war diese Mach jedoch durch gesellschaftliche Normen eingeschränkt. Bei sexuellen Beziehungen hatte er eine aktive Rolle einzunehmen und insofern Selbstbeherrschung zu üben, als dass er keinen Ehebruch mit der Frau eines anderen Bürgers zu begehen hatte und im Idealfalle auf die Ausbeutung ihm Untergebener verzichtete. Gleichzeitig sollte er in diesem Bereich seine Dominanz und Männlichkeit demonstrieren. Räumlich konnten sich die Söhne mit ihrer Familie aus der domus lösen, doch blieben sie ökonomisch vom chef de clan abhängig. Vaterschaft wurde als eine Angelegenheit willentlicher Entscheidung betrachtet: Der Vater konnte Kinder anerkennen, adoptieren, aussetzen lassen oder ihnen bloss das Recht auf Ernährung zubilligen. Erbschaften konnten nun auch auf der mütterlichen Linie weitergegeben werden. Die Männer der Aristokratie hatten Angst, es seien nicht genügend Frauen vorhanden, um eine ausreichende Nachkommenschaft zu sichern. Dies führte dazu, dass verheiratete Männer ihre gebärfähigen Frauen an andere Männer ausliehen und nach erfolgter Geburt wieder zurückerhielten. Im Laufe des untersuchten Zeitraumes erfuhren eheliche Beziehungen eine starke Aufwertung, nicht zuletzt mit dem Ziel, mehr legitime Söhne zu erzeugen.
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
1.1. Erläuterung der Fragestellung: die Begriffe pater familias, domus und familia
1.2. Skizze des Konzeptes: Was erwartet die Leserin und den Leser?
1.3. Gesellschaftlicher Hintergrund: Tripolare Machtverhältnisse in der römischen Gesellschaft
2. HAUPTTEIL: VATERSCHAFT ALS DAS WESENTLICHE MERKMAL MÄNNLICHER IDENTITÄT?
2.1 Die Macht des pater familias und das Bild von seiner Männlichkeit
2.2 „Virtuelle Männer“ - Söhne als Staatsbürger zweiter Klasse
2.3 Die Macht des Vaters - Vaterschaft als eine Sache der willentlichen Entscheidung
2.4 Patrilineare versus Matrilineare Vererbung
2.5 Reproduktion als oberstes Gebot: Die Zirkulation der „Gebär-Mütter“
2.6 Christliche Moral und die neue Rolle des Vaters in der Hohen Kaiserzeit
2.7 D er Stellenwert der Vaterschaft
3. SCHLUSSBEMERKUNGEN
3.1 Zusammenfassung
3.2 Schlussfolgerungen und Ausblick
4. BIBLIOGRAPHIE
1. EINLEITUNG:
Als Erstes möchte ich auf ein Grundproblem der antiken Geschlechterforschung hinweisen: Die Untersuchungen, auf die ich mich stütze, hatten alle mit dem Problem einer ungünstigen Quellenlage zu kämpfen. Durch die Analyse von literarischen oder juristischen Texten, von Inschriften sowie durch den Einbezug von archäologischen Untersuchungen muss indirekt auf das Verhältnis zwischen den Geschlechtern geschlossen werden. Da die vorhandenen antiken Texte jedoch beinahe ausschliesslich aus den Federn männlicher Autoren stammen, können wir bloss auf die gesellschaftlichen Normen männlichen Angehörigen der römischen Oberschicht schliessen. Wenn in dieser Arbeit gesellschaftliche Praktiken oder ähnliche Begriffe verwendet werden, so sind immer die Normvorstellungen dieser Gruppe über die gesellschaftliche Praxis gemeint.
1.1 Erläuterung der Fragestellung: die Begriffe pater familias, domus und familia
In der Spätzeit der römischen Republik und in den Anfängen des Prinzipats umfasste eine domus alle Personen, die vom pater familias abstammten, wie eine Grossfamilie1. Der pater familias hatte innerhalb dieser sozialen Einheit die zentrale Position inne: Seine Frau, seine Söhne mit ihren Gattinnen und deren Kindern und allenfalls Enkel sowie unverheiratete Töchter2 waren rechtlich und ökonomisch völlig von ihm abhängig, selbst wenn sie räumlich getrennt lebten. Ihm unterstand auch alles andere, was zur familia gehörte: Sklaven, Freigelassene, bewegliche und unbewegliche Güter.
Diese aktive und dominante Rolle des „ chef de clan “3 wurde verstanden als Ausdruck von Männlichkeit, die einem passiven, unterwürfigem Bild von Weiblichkeit gegenüberstand4. Warum wurde nun aber der Clanchef pater genannt? Dass diesem Begriff eine derart grosse Bedeutung zugemessen wurde, verweist darauf, dass die Vaterschaft im römischen Denken einen wichtigen Platz eingenommen haben musste.
Warum wurde die Vaterschaft als so hoch eingeschätzt? Wie beeinflusste das Bewusstsein, Vater zu sein den römischen Bürger in seinem Verhalten? Welche sozialen Praktiken leiteten sich aus den Normvorstellungen von Männlichkeit (und damit auch der Weiblichkeit) und Vaterschaft ab? Diesen Fragen möchte ich in meiner Arbeit nachgehen.
1.2 Skizze des Konzeptes: Was erwartet die Leserin und den Leser?
Im Folgenden soll nun untersucht werden, welche Rolle die Vaterschaft in der Vorstellung von männlicher Identität einnahm und wie sich diese Vorstellungen in der Beziehung des pater familias zu seinen Söhnen und Töchtern niederschlug.
Als Grundlage für die Beantwortung dieser Fragestellung werde ich anschliessend den gesellschaftlichen Hintergrund in der späten Republik und im frühen Prinzipat skizzieren. Zu Beginn des Hauptteils wird die zentrale Stellung des pater familias mit dem Konzept seiner Männlichkeit in Verbindung gebracht. Solange dieser lebte, konnte er das Leben seiner Söhne bestimmen. Dies führte zum Problem der „Virtuellen Männer“, das anschliessend behandelt wird. Das darauf folgende Kapitel stellt die absolute Gewalt des Vaters gegenüber dem Kind sowie den Umgang mit Kindern dar, die als überschüssiges Produkt der Natur betrachtet wurden. Anschliessend thematisiere ich die geschlechtsspezifischen habit ū s bei der Vererbung. Gebärfähige Frauen galten in der römischen Oberschicht als rar. Um die Reproduktion der Gesellschaft gleichwohl sicherstellen zu können, tauschten Männer untereinander Frauen aus, wie ich im Kapitel 2.5 darlegen möchte. Die Institution der christlichen Ehe mit mehr oder weniger noch heute gültigen Attributen wie Keuschheit und ewige Liebe bildete sich nach der Meinung Paul VEYNES als Reaktion auf den Machtverlust der Senatoren unter den Kaisern. Diese These werde ich eingehend prüfen, bevor ich endlich explizit auf die Bedeutung der Vaterschaft zurückkomme, die selbstverständlich im Zentrum der Schlussfolgerungen stehen wird.5
1.3 gesellschaftlich-politischer Hintergrund: tripolare Machtverhältnisse in der römischen Gesellschaft
Nach FLAIG lässt sich die Machtverteilung unter dem römischen Prinzipat nicht aus der Optik des modernen Staates betrachten, in dem eine Verfassung Regeln aufstellt, wem im Staate wie viel Macht zugestanden wird. Er betrachtet daher den herkömmlichen Verfassungsbegriff6 als ungeeignet, um die Machtverhältnisse im römischen Prinzipat zu beschreiben. Das Prinzipat stellte nicht eine absolute Monarchie, sondern ein Akzeptanz-System dar, in dem ein Prinzeps von drei massgeblichen gesellschaftlichen Sektoren getragen wurde: Heer, Senat und plebs urbana. Die Kontrolle und Absicherung der Herrschaft wurden durch die Kommunikation dieser drei Gruppen untereinander und mit dem Kaiser gewährleistet.7
Bei der Ernennung eines neuen Kaisers wurde dieser zuerst vom Heer akklamiert, dann wurde er im vom Senat bestätigt und schliesslich durch eine von den Komitien8 verabschiedeten lex de imperio in sein Amt eingesetzt. Alle drei Sektoren waren in der Lage, die Stabilität seiner Herrschaft zu bedrohen9 und erforderten deshalb die Zuwendung des Prinzeps, was für diesen einer ständigen Gratwanderung gleichkam: Neigte er sich beispielsweise zu sehr der plebs zu, indem er sich oft und lange bei den Spielen aufhielt, verminderte sich die Zeit, in der er sich der Aristokratie zuwenden konnte, und damit „... erhöhte sich die Macht der kaiserlichen Freigelassenen in wichtigen Funktionen. Sie entschieden faktisch, worüber der Kaiser nicht entschied.“10 Für die machtgewohnten Senatoren bedeutete es eine Demütigung, bei Freigelassenen um eine Audienz beim Kaiser bitten zu müssen. Dieser Umstand symbolisierte den Machtverlust des Senatorenstandes, der mit dem Ende der Republik verbunden war. Im Kap. 2.6 werde ich darauf zurückkommen, wie sich dieser Wandel eine Veränderung im privaten Leben der Patrizier nach sich zog.
2. HAUPTTEIL: Vaterschaft als das wesentliche Merkmal männlicher Identität?
2.1 Die Macht des pater familias und das Bild von seiner Männlichkeit
Wie bereits in 1.1 erwähnt, hatte der pater familias als „ chef de clan “ eine fast unumschränkte Gewalt über die Mitglieder seiner domus. Er hatte einem Männlichkeitsbild zu entsprechen, das „persönliche Freiheit mit und Souveränität mit Herrschaft über andere verbindet“11. Die absolute Herrschaftsgewalt, mit der er über seine domus verfügen konnte, hiess den Kindern und Enkeln gegenüber patria potestas, gegenüber der Ehefrau hingegen manus.12 Sie erlosch erst mit dem Tod des pater familias. Von ihm wurde erwartet, dass er diese Macht zur Durchsetzung gesellschaftlicher Normen einsetzte. Die patria potestas kann als Ersatz für eine Polizei gelten, da der römische Staat über keine derartige Institution zur Umsetzung des Rechts in die Praxis verfügte. THOMAS geht in der Beschreibung dieser Macht sogar noch weiter: „Die Einheit für den Zensus und die Steuereinheit ist der souveräne Familienälteste einer domus: er vereint, was wir heute Zivilgesellschaft und Staat nennen.“13 Aufgrund dieser Position vertrat der pater familias auch seine Söhne vor Gericht. Die patriarchale Macht umfasste ein ausgedehntes Recht zu strafen, das bei den Söhnen bis zur Todesstrafe reichte. Letztere wurde jedoch nur sehr selten angewendet, sie diente dem pater familias vielmehr als Druckmittel gegenüber seinen Söhnen (wie auch die Möglichkeit der Enterbung).14
Ganz allumfassend war die patria potestas jedoch nicht. Sie wurde bereits während der Zeit der Republik durch Gesetze, religiöse Vorschriften und die Sittenaufsicht des Zensors eingeschränkt.15
Trotz dieser Einschränkungen war die in der patria potestas enthaltene Macht so gross, dass sie entsprechend legitimiert werden musste: Die Beherrschung anderer war verknüpft mit der Forderung der Selbstbeherrschung. Bezüglich sexueller Beziehungen wurde unterschieden zwischen der necessitas (Notwendigkeit) und der libertas (Freizügigkeit).16 Die necessitas verlangte vom Familienältesten Zurückhaltung und Würde. Selbstbeherrschung und Zurückhaltung bedeutete, dass er zwar eine gewisse Lust (voluptas) zum Ausdruck bringen durfte, jedoch eine leidenschaftliche Begierde (cupiditas) zu vermeiden hatte.17 Beim Geschlechtsakt hatte er immer die aktive Rolle inne, der dominus musste hier immer wieder seine Männlichkeit unter Beweis stellen. Eine aktive Rolle bedeutete einerseits, bei sexuellen Beziehungen die Initiative zu ergreifen und dabei andererseits eine penetrierende Stellung einzunehmen.18 Er galt als asketisch, wenn er freiwillig auf den ihm zustehenden Geschlechtsverkehr mit Sklaven beiderlei Geschlechts sowie mit Prostituierten verzichtete. Demgegenüber konnte eine Frau nur bei Wahrung ihrer Jungfräulichkeit die Bezeichnung „Asketin“ beanspruchen.19 Gegen aussen sollte der Familienälteste daher immer Würde und Männlichkeit markieren, innerlich hatte er seine Bedürfnisse zu zähmen.20
Um seine Stellung zu bewahren, hatte der pater familias darauf zu achten, dass sein Vermögen erhalten blieb und sein Ruf (fama) nicht beschädigt wurde. Befleckt werden konnte die fama beispielsweise durch einen Ehebruch oder durch unmännliches, d. h. unterwürfiges oder passives Verhalten oder durch masslose Verschwendung . Den Vorwurf der effeminatio richtet beispielsweise Tacitus in den Annalen an den Kaiser Claudius. Nach der von diesem unbemerkten Heirat seiner Frau und Kaiserin Messalina berichtet er von den mächtigen Freigelassenen des Kaisers: „Es beschlich sie ohne Zweifel Angst, wenn sie an den stumpfsinnigen, seiner Gattin hörigen Claudius und an die vielen Hinrichtungen dachten, die auf Befehl Messalinas vollzogen worden waren.“21 Seiner Gattin hörig zu sein, war einer der schlimmsten Vorwürfe, die an einen pater22 gerichtet werden konnten, denn dies bedeutete eine Umkehrung der Geschlechterrollen. Gegen aussen sollte der Familienälteste daher immer Würde und Männlichkeit markieren, innerlich hatte er seine Bedürfnisse zu zähmen.23
Da der pater familias über ihm nachfolgende 3 Generationen herrschte, hatte er auch die Ahnen der 3 Generationen vor ihm zu ehren. Drei Vorväter galten in der Aristokratie als Masstab für die Erlangung oder den Verlust von Legitimität. Somit galt als homo novus, wer nicht zumindest als Urgrossvater einen Senator gehabt hatte.24
Dass chef de clan als pater familias bezeichnet wurde, obwohl er ja nicht der Vater seiner Frau oder seiner Sklaven war, unterstreicht die überragende Bedeutung, die der Vaterschaft beigemessen wurde: Die Vorstellung vom Vater, der seinen Sohn züchtigt, aber auch für ihn zu sorgen hat, wurde auf die gesamte familia übertragen.
2.2 „ Virtuelle Männer “ - Söhne als Staatsbürger zweiter Klasse
Die Dominanz des chef de clan führte zu einem unlösbaren Widerspruch in der gesellschaftlichen Rolle erwachsener Söhne: So lange der pater familias noch lebte, waren sie ihm Gehorsam und Ehrerbietung schuldig, sie waren nicht mündig25, oder zumindest nur sehr beschränkt. Sie hatten zwar das Recht, bei Volksversammlungen abzustimmen und durften politische Ämter bekleiden.26 Bei allen rechtlichen Angelegenheiten, sei dies ein Kaufvertrag oder eine gerichtliche Verhandlung, lag das letzte Wort beim pater familias. Auch wenn sie ihrem sich ihrem Vater zu unterwerfen hatten, so nahmen die erwachsenen Söhne ihren Kindern, ihrer Frau sowie den Sklaven und Freigelassenen gegenüber jedoch eine dominante, virile Position ein.27
Das System der lebenslangen Macht des ältesten Familienmitgliedes führte zu enormen Unterschieden im Schicksal von Männern der römischen Oberschicht. Ungefähr die Hälfte der Söhne konnte bereits mit 20 Jahren die Nachfolge des pater familias antreten und einen grossen Teil ihres Lebens die domus beherrschen, andere waren mit 50 oder gar 60 Jahren noch unmündig.28 Die Macht des pater familias zeigte sich beispielsweise bei der Eheschliessung: Rechtlich hatte das Einverständnis des Vaters Vorrang vor jenem des Sohnes; aus Angst vor Enterbung fügten sich die Söhne meistens dem Entscheid des Vaters.29 Töchter hatten in den allermeisten Fällen gar nichts zu ihrer Verheiratung zu sagen. Die Drohung der Enterbung soll sogar Volkstribune dazu bewogen haben, ihrem Vater missfallende Gesetze zurückzuziehen.30
Aus dieser Konstellation könnte man aus heutiger Optik auf einen zwingenden Generationenkonflikt schliessen: Erwachsene Söhne hätten gewichtige Gründe gehabt, gegen ihre Väter zu rebellieren. VEYNE spricht von einer „étonnante fréquence du parricide (Vatermord, J.S.) “ und schreibt weiter „on y voyait un fléau social trop explicable, plutôt qu’un drame interindividuel contre nature.“31 Wie für viele andere Aussagen bleibt uns hier VEYNE den Beleg aber schuldig: Wir wissen nicht, welche Quellen er ausgewertet hat, um eine „erstaunliche Häufigkeit“ der Vatermorde festzustellen. Das folgende Zitat von THOMAS erscheint mir dagegen plausibler: „Man könnte eine Fülle von Beispielen für solche verheirateten oder ledigen Söhne zitieren, deren Leben von einem [...] auf seine väterliche Gewalt erpichten Despoten aus der Ferne gelenkt wurde. Sein Tod wurde deshalb nicht selten herbeigesehnt und manchmal herbeigeführt. Das obsessive Echo solcher Verbrechen und noch mehr der Angst davor hallt aus rhetorischen und Rechtstexten wider.“32 In den uns überlieferten Texten sind folglich nur wenige Vatermorde belegt, doch die Angst davor zeigt, dass diese Möglichkeit in Betracht gezogen wurde. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass zwischen Vätern und Söhnen der römischen Oberschicht kein offen geführter Generationenkonflikt bestand, sondern dass die Söhne das System der Vorherrschaft des Vaters zum grössten Teil akzeptierten33 oder höchstens passiven Widerstand leisteten. Eine andere Erklärung wäre, dass sich die Beziehung zwischen Vater und Sohn durch eine gewisse Wärme auszeichnete, auch wenn der Vater keine allzu sentimentale Bindung an seine Kinder entstehen lassen wollte, um den Druck der möglichen Enterbung aufrecht erhalten zu können.34 Welche dieser Thesen der historischen Wirklichkeit näher kommt, ist im Rahmen einer Proseminararbeit nicht zu beantworten. Bei einer solchen Überprüfung müsste berücksichtigt werden, dass die individuellen Beziehungen auch innerhalb eines Systems gesellschaftlicher Regeln stark differenzieren können.
Um sich ein genaueres Bild von der Beziehung zwischen Vater und Sohn zu erhalten, kann eine Betrachtung der Wohnformen aufschlussreich sein. Verheiratete Söhne der Oberschicht drängten den Vater oft, ihnen eine selbständige Wohnung in der Stadt zu gewähren. Für diesen Drang zur Selbständigkeit finden sich in der antiken Literatur zahlreiche Beweise, so bei Plutarch oder Cicero.35 Obwohl die öffentliche Moral einen solchen Lebenswandel als unsittlich betrachtete, entsprachen die Väter diesem Wunsch, wenn ein triftiger Grund wie etwa eine politisch-rhetorische Ausbildung vorlag. Damit wurde zwar das Prinzip der Einheit von häuslicher Gewalt und Vermögen unterlaufen, doch die Söhne blieben ökonomisch in völliger Abhängigkeit: Sie erhielten nur eine Rente und nicht etwa Kapital, mit dem eigenständige geschäftliche Aktivitäten ermöglicht worden wären.36 Auch Magistraten und Senatoren, deren Vater noch lebte, waren noch von diesem abhängig. Ein eigener Wohnsitz bedeutete folglich nicht automatisch wirtschaftliche Unabhängigkeit, schon gar nicht rechtliche Autonomie. Aufgrund von Grundrissen ausgegrabener Häuser etwa in Pompeij sowie aufgrund sprachlicher Indizien vermutet THOMAS, dass es usus war, dass der Sohn seine Wohnung für seinen Haushalt unter dem Dach des väterlichen Hauses einrichtete.37 Beim Tode des Familienoberhauptes zogen mit Ausnahme des Haupterben38 alle Söhne aus und gründeten, einen neuen Hausstand. Cicero beschrieb diesen Ablösungsprozess folgendermassen: „Die erste Gesellschaft beginnt mit dem Ehepaar selbst und gleich danach mit den Kindern. Dann kommt eine einzige domus, in der alles gemeinsam ist. Hierin liegt der Keim der Gemeinschaft, sozusagen die Pflanzschule des Staates. Es folgen die Bande zwischen Brüdern, dann zwischen Vettern ersten und zweiten Grades; und dann, weil sie nicht mehr in einem einzigen Hause Platz finden, ziehen letztere aus, um andere Häuser wie Kolonien zu gründen.“39
Das Modell der aristokratischen Familie kommt der Realität wohl dann am nächsten, wenn man davon ausgeht, dass sie sich aus verschiedenen Kernfamilien unter der Gewalt eines Familienoberhauptes zusammensetzte, die räumlich auch getrennt sein konnten. Die Söhne des Familienoberhauptes hatten zwar innerhalb ihrer Kernfamilie prinzipiell eine dominante, männliche Rolle, doch wurden sie in dieser Funktion durch den pater familias so stark eingeschränkt, dass sie als „virtuelle Männer“ bezeichnet werden können.
2.3 Die Macht des Vaters - Anerkennung der Vaterschaft als willentliche Entscheidung
Väterliche Abstammung wurde - im Gegensatz zu unserer heutigen Auffassung - als eine Sache der willentlichen Entscheidung betrachtet: Der Vater hatte die absolute Gewalt über das Kind, er hatte die Möglichkeit, über dessen Leben und Tod zu bestimmen.40 Nach der Geburt eines Knaben entschied der Erzeuger, ob er das Kind als seinen Sohn und somit als Erben anerkannte. Erst durch ein symbolisches Emporheben des Knaben akzeptierte der (biologische) Erzeuger die Vaterschaft - mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten.41 Bei Mädchen dagegen gab es keine rechtliche Anerkennung der Vaterschaft.42 Die absolute Gewalt des Vaters über sein Kind erstreckte sich auch auf die Erziehung, die Mutter hatte keinerlei Einfluss.
Warum leibliche Nachkommen nicht automatisch als Erben akzeptiert wurden, beschreibt VEYNE folgendermassen: „Les nouveaux-nés sont un regain, une production de la nature, qui n’est reçue dans la société humaine que par une décision expresse.“43
Der rechtlichen Anerkennung der Abstammung stand die juristisch weniger klar abgegrenzte Funktion des Vaters als Ernährer entgegen: Kinder, die von einem römischen Bürger gezeugt worden waren (z. B. mit einer Sklavin), jedoch von ihm nicht offiziell anerkannt wurden, waren nicht erbberechtigt. Sie mussten aber vom Erzeuger ernährt werden, rechtlich hiess dann der leibliche Vater nicht „Vater“, sondern „Ernährer“. Ein alumnus hatte nur Anspruch auf Ernährung, nicht aber auf das Erbe.44
Die dritte Möglichkeit einer Entscheidung des Vaters bei der Geburt eines Neugeborenen lag darin, das Kind aussetzen zu lassen oder auf eine andere unblutige Art umzubringen. Die Aussetzung wurde sowohl von Armen als auch von Reichen praktiziert, in der Oberschicht vor allem, um eine bereits feststehende Erbfolge nicht mehr zu verändern. Sie stellte gleichzeitig die effizienteste Form von Geburtenkontrolle dar, vergleichbar mit der heutigen Abtreibung.45 Die ausgesetzten Kinder wurden oft von Sklavenhändlern aufgenommen und aufgezogen. Viele Sklaven in Rom waren also keine Kriegsgefangenen, sondern ausgesetzte römische Kinder.46
Wie sehr Vaterschaft als eine Angelegenheit der willentlichen Entscheidung betrachtet wurde, äusserte sich auch in der Häufigkeit und Selbstverständlichkeit von Adoptionen. Die Adoption stellte nebst der Blutsverwandtschaft eine gleichwertige Möglichkeit dar, bürgerliche Abstammung festzulegen.47 Sie hatte den Zweck, entweder das Fehlen direkter Nachkommen auszugleichen oder die Erbreihenfolge zu verändern. So konnte beispielsweise bei fehlenden direkten Nachkommen ein bevorzugter Neffe adoptiert und damit zum Haupterben gemacht werden.48 Es war wichtiger, einen würdigen Sohn zu haben, als dass eine Blutsverwandtschaft bestand.
2.4 Patrilineare versus matrilineare Vererbung
Das römische Erbrecht wurde im Laufe der Zeit immer wieder den veränderten gesellschaftlichen Normen angepasst. Durch das Studium desselben können wir deshalb versuchen, die Veränderungen zu rekonstruieren. Im Folgenden werde ich diesen Wandel kurz nachzeichnen. Dass dabei der Rolle der Vaterschaft eine besondere Beachtung geschenkt wird, versteht sich von selbst.
Aus der Frühzeit der Republik sind uns die berühmten Zwölftafelgesetze überliefert. Sie belegen, dass in dieser Zeit die Namensgemeinschaft der gens eine wichtige Rolle spielte, da ihr Erbschaften ohne Erbberechtigte zufielen. Erbberechtigt waren zu dieser Zeit an erster Stelle die sui, die unmittelbaren Nachkommen in männlicher Linie, und zwar sowohl Söhne und Enkel als auch Töchter und Enkelinnen, die nach Grad und Abstammung gleichberechtigt waren.49 Den weiteren Verlauf der Erbfolge beschreibt THOMAS folgendermassen: „Waren keine sei vorhanden, ging das Erbe an den nächsten Seitenverwandten innerhalb des agnatischen50 Verwandtschaftskreises bis zum siebten Grade. [...] Als der Prätor in der Spätzeit der Republik auch die Erbberechtigung der Verwandten in mütterlicher Linie einführte, geschah das nicht zur Gleichstellung beider Linien: Kognaten51 erbten nur, wenn keine Agnaten vorhanden waren.“52 Damit nähern wir uns dem Zeitraum, der hier untersucht werden soll. Es stellt sich die Frage, welcher Wandel in den gesellschaftlichen Normen den Anlass für diese Gesetzesänderung darstellte.
Eine mögliche Antwort lässt sich in der veränderten Bedeutung der Ehe finden. Ab dem 2. Jh. v. u. Z. wurden Wiederverheiratungen üblich: Da fruchtbare Frauen in der Oberschicht als rar galten, hatte eine Ehe nicht mehr lebenslänglichen Charakter, sondern die Frau wurde dem Mann nur noch so lange anvertraut, wie dies für die Reproduktion notwendig war.53 Auf diese Praxis werde ich weiter unten noch eingehen. Die Frau war somit nicht mehr der manus54 ihres Ehemannes unterstellt, sondern blieb auch nach der Heirat der patria potestas ihres Vaters unterworfen. Letzterer erhielt dadurch grosses Gewicht: „Der Vater kann seine Tochter zurücknehmen, die Mitgift folgte ihr (sic!), sie erbt das Vermögen, über das sie und die Ihren per Testament verfügen können.“55 Das Recht der Vererbung über die mütterliche Linie stellte gewissermassen eine Kompensation für die verlorengegangene rechtliche Bindung der Mutter an die Kinder dar.56 Wenn die Mutter nun ihren Kindern einen Teil ihres Vermögens vermachte, konnten diese frei darüber verfügen, dieses Vermögen unterstand nicht der patria potestas.
Diese Verschiebung der Macht über die Ehefrau vom Ehemann des Familienoberhauptes väterlicherseits zum Familienoberhaupt mütterlicherseits führte dazu, dass die Frauen tendenziell besser behandelt wurden, aus Angst, sie könnte ansonsten von ihrem Vater aus der Ehe gerissen und mit einem anderen Mann verheiratet werden.57 Ich denke, die Vaterschaft wurde durch diesen Wandel noch weiter aufgewertet, da Töchter nun „wertvoller“ wurden. Der Stolz der Väter bezog sich aber weiterhin in erster Linie auf die Söhne, denn nur sie waren in der Lage, die Familientradition der domus fortzuführen und die Familienehre zu erhalten.
2.5 Reproduktion als oberstes Gebot - die Zirkulation der Gebär-Mütter
Vater zu sein war eines der erstrebenswertesten Ziele für einen jungen Aristokraten. Das natürliche Begehren, Kinder haben zu wollen, wurde in den gesellschaftlichen Normen stark überhöht. Es galt als Dienst am Vater land (patria)58, viele Söhne zu zeugen. Aus welchen Voraussetzungen diese Normen entstanden sind, habe ich teilweise bereits beschrieben, auf weiter mögliche Gründe möchte ich später zurückkommen. Wie sie sich auf das Eheleben auswirkten, soll Thema dieses Kapitels sein.
Wie liess sich das Ziel einer möglichst hohen Reproduktionsrate erreichen? Als erstes ist zu berücksichtigen, dass die römische Gesellschaft von einer hohen Säuglingssterblichkeit geprägt war. Aufgrund von Grabinschriften kann man davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der Neugeborenen nicht überlebte und dass fast die Hälfte der Kinder vor der Pubertät starben.59 Um die Bevölkerungszahl konstant zu halten hätte ein Paar, das in einer stabilen Beziehung lebte, mindestens vier Kinder haben müssen. Die auf Grabinschriften erwähnten Paare hatten jedoch meist nur zwei Kinder.60 Aus diesem und vielen weiteren Indizien schloss die neuere Forschung, dass die Eheallianzen nicht so stabil waren, wie später die christliche Ehe zu sein hatte. Wiederverheiratung nach einer Verwitwung oder Scheidung waren vielmehr in allen Gesellschaftsschichten üblich. Eine Scheidung hatte keinerlei Prestigeverlust zur Folge und bedurfte keiner weiteren Formalität als einer schriftlichen Mitteilung.61 Das Konkubinat war keineswegs untersagt, doch konnte damit keine Erbberechtigung erwirkt werden.62
Die ausgeprägte Sorge um die Reproduktion führte gar zu einem Verhalten, das auf den ersten Blick im Vergleich zu unserem bis vor nicht allzu langer Zeit von Monogamie und Liebe geprägten Bild einer Ehe nur schwer fassbar erscheint: Die aristokratischen Römer liehen einander ihre Gattinnen aus, wenn der eine eine fruchtbare Frau und der andere nicht genügend Kinder hatte.63 Von der Gesellschaft wurde gefordert, dass eine Frau ihre Gebärfähigkeit nicht brachliegen liess, und es galt als besonders ehrenvoll, einem Freund zuliebe während etwa eines Jahres auf die eigene Frau zu verzichten.64 Nach Plutarch soll ein Zeitgenosse Ciceros diese Praxis folgendermassen verteidigt haben: „Nach Menschenmeinung kann ein solches Vorgehen seltsam erscheinen. Wenn man sich aber auf den Standpunkt der Natur stellt, ist es eine schöne und für die Gemeinschaft der Bürger nützliche Sache, dass eine junge Frau in der Zeit ihrer Fruchtbarkeit und in der Blüte ihres Lebens nicht müssig bleibt und ihre Gebärfähigkeit brachliegen lässt. [...] sie soll reichlich Tugend schaffen, indem sie sich Männern guten Rufes hingibt, die sie untereinander teilen, sie soll die Tugend in ihren Geschlechtern verbreiten und zum Grundpfeiler des Staates werden, indem sie die Bürger durch ihre Ehen miteinander verbindet.“65 Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass eine Frau von ihrem Ehemann geschieden wurde, um einem Freund oder politischen Verbündeten des Ehemannes Kinder gebären zu können. Damit diese Kinder eine makellose Abkunft vorweisen konnten, wurde die Frau von ihrem Ehemann geschieden und heiratete - oft nur für die Zeit der Schwangerschaft bis zur Geburt - den Freund des Gatten. Bei dieser Heirat war der bisherige Gatte anwesend, um die Rechtsmässigkeit der Beziehung zu bestätigen; damit war klar, dass es sich nicht um einen Ehebruch handelte.66 Nach der Niederkunft schied sie sich wieder von dem Mann, dem sie ein Kind geboren hatte, und kehrte zu ihrem ursprünglichen Gatten zurück.67
Diese Sitte beruhte auf einer Absprache zwischen Männern, die betroffene Frau wurde als tugendhaft dargestellt, wenn sie einwilligte, doch blieb ihr praktisch keine andere Wahl. Hier zeigt sich, warum der in Kap. 2.4 beschriebenen Verschiebung der Macht über die Ehegattin vom Gatten hin zu deren Vater ein so grosses Gewicht zuzumessen ist: Nicht der Gatte, sondern der Vater der Frau entschied über Wieder- oder Zwischenheiraten. Der Gatte selbst hätte seine Frau unter Umständen nicht so leicht weggegeben: THOMAS beschreibt den Fall Catos, der auf die Forderung des Hortensius, ihm seine Gattin zu entleihen, lediglich bemerkt habe, der Vater seiner Frau sei zu fragen.68 Aus dem nicht Gesagten lässt sich erahnen, dass Cato über diese Entscheidung nicht sehr glücklich war.
Was aber bewog die Männer zu diesem beinahe hektischen Austausch von Frauen? „Allem Anschein nach galten fruchtbare Frauen als selten; ob sie es wirklich waren, steht auf einem anderen Blatt...“69 schreibt THOMAS. Möglicherweise wurden Mädchen häufiger ausgesetzt als Knaben70, ausserdem starben viele Frauen zwischen 18 und 25 Jahren nach der Geburt eines Kindes. Wie stark sich dies auf das Geschlechterverhältnis in der Bevölkerung der römischen Oberschicht auswirkte, lässt sich heute nicht mehr feststellen, darüber hatten aber auch die damaligen Männer keine zahlenmässigen Angaben. Deshalb ist zu vermuten, dass die Angst der Männer vor dem Aussterben der Aristokratie als eigentlicher Antrieb für diese intensive Zirkulation der Gebärerinnen wirkte.71 Einen Ausdruck fand diese Angst der Oberschicht vor dem Aussterben auch in den Augusteischen Ehegesetzen, die im Jahre 18 v. Chr. erlassen wurden: Es wurde eine Ehepflicht eingeführt, Ehen von Senatoren mit Freigelassenen wurden verboten, Ehe- und Kinderlose bei Erbschaften benachteiligt und insbesondere Verheirateten mit möglichst vielen Kindern Vorteile bei staatlichen Ämtern eingeräumt.72
In der Vorstellung der führenden gesellschaftlichen Schicht galt aus der oben beschriebenen Angst heraus eine Frau dann als exemplarisch, wenn sie möglichst viele Kinder gebar.73 Dies führte sogar so weit, dass eine Gattin, die keine Kinder bekam, ihrem Mann eine andere Frau aussuchte, die den Part der Gebärerin übernehmen sollte. Die Rolle der mater familias brauchte sie deswegen aber nur für eine kurze Zeit abzutreten: Nach der Geburt unterstanden ihr die von der fremden Frau geborenen Kinder ebenso, wie wenn sie sie selbst geboren hätte. Da ein solches Verhalten einer Gattin weder selbstverständlich noch häufig war, wurde es auf Grabinschriften als „männliche Tugend“ glorifiziert.74
Eine weitere wichtige Norm, die das Überleben der Gesellschaft sicherstellen sollte, war das frühe Heiratsalter der Frauen.75 Das gesetzliche Mindestalter betrug 12 Jahre, üblich war ein Heiratsalter von ungefähr 15 Jahren. Bei den Männern kann davon ausgehen, dass sie in einem Alter von 18 bis 25 Jahren vermählt wurden. Die Augusteischen Ehegesetze weisen darauf hin, dass ein Altersabstand zwischen den Ehegatten von 5 Jahren als üblich betrachtet wurde, denn Frauen mussten bis zum zwanzigsten, Männer bis zum 25. Lebensjahr Nachwuchs geboren bzw. gezeugt haben.76
Die Sorge um die Reproduktion kann auch betrachtet werden als ein intensiver Wunsch der Männer, Vater zu werden. Dieser war aus dem hohen gesellschaftlichen Status der Vaterschaft entstanden, auf den ich in Kapitel 2.7 zurückkommen werde. Das Überleben der gesamten Gesellschaft hatte Vorrang vor dem individuellen Bedürfnis einer lange dauernden Ehe.
2.6 Der Wandel der Sexualmoral und der Ehe von der Zeitenwende bis zur Herrschaft der Severer
Im Kapitel 2.1 war bereits davon die Rede, dass der pater familias bei sexuellen Beziehungen eine aktive Rolle einzunehmen hatte. Betrachtet man die römischen Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit, so entdeckt man, dass das biologische Geschlecht nicht allein entscheidend war, ob ein Mensch als „viril“ oder „feminin“ betrachtet wurde. Die Zuordnung zu einem der Konzepte hing ebenso sehr von seiner sozialen Stellung ab. Die römische Gesellschaft der späten Republik und des frühen Prinzipats unterschied nicht zwischen Homo-, Bi- und Heterosexualität - Trennlinien, die später in weit über tausend Jahren christlicher Moral eine entscheidende Rolle spielten - sondern zwischen einer aktiven und einer passiven Haltung im Geschlechtsleben.77 Ein freier römischer Bürger hatte immer den aktiven Part einzunehmen, d.h. er nahm unter dem Gesichtspunkt der Penetration die aktive Rolle ein.78 Eine mögliche Erklärung für diese Verhaltensnorm bietet MEYER- ZWIFFELHOFERS These, die geschlechtlichen Beziehungen und Praktiken seinen als Herrschaftsbeziehungen und -praktiken begriffen worden.79 Demzufolge entsprach die aktive Rolle des freien Bürgers beim Geschlechtsverkehr einer Machtdemonstration. Das Einverständnis des Sklaven oder der Frau war nicht erforderlich, VEYNE spricht daher von einer „ s é xualit é de viol “ . Ein Sklave dagegen hatte immer eine passive Rolle einzunehmen, da er „sozial impotent“ war, was auf lateinisch mit dem Begriff mollitia (Weichheit) umschrieben wird. VEYNE verwendet für diese Sexualmoral den Begriff der „ bisexualit é de sabrage “80, der ungefähr mit phallozentrische Bisexualität 81 übersetzt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier um eine rein männliche Bisexualität handelte.82 Diese bisexualit é de sabrage ging nun nach VEYNE zwischen der Zeitenwende und dem 2. Jh. n. u. Z. über in eine „ h é t é rosexualit é de reproduction “ , die später zur Grundlage dessen wird, was wir christliche Sexualmoral nennen: einem (zumindest nach der Norm) auf die Ehe beschränkten Sexualleben.83
Im letzten Teil der Einleitung habe ich erwähnt, wie sich die politische Macht der Patrizier, des Standes der „Väter“, nach dem Übergang von der Republik zum Prinzipat verringerte. VEYNE beschreibt diese Rollenverschiebung als „... passage d’une aristocratie concurrentielle (sorte de féodalité où les rivalités entre les clans sont féroces) à une aristocratie de service, où l’on fait carrière en étant en bons termes avec ses pairs.“84 Da die chefs de clan, die Senatoren zur Zeit der Republik, in der Gesellschaft ausserhalb der Familie gewohnt waren, autoritär aufzutreten und Befehle zu geben, hätten sie auch keine Gewissensbisse, wenn sie ihre Untergebenen vergewaltigten.85 Dagegen seien die Senatoren zur Zeit der Severer zu fid è les serviteurs de l ’ é tat86 geworden, die es gegen aussen nicht mehr gewohnt waren, Macht anzuwenden, und deshalb auch in ihrem Geschlechtsleben keine Gewalt mehr anwenden wollten - auch nicht gegen sich selbst.87 Damit der Gatte seiner Frau keine Befehle mehr geben musste, haben nach VEYNE die Senatoren des 2. und 3. Jahrhunderts n. u. Z. den Mythos der ehelichen Liebe erfunden.
Dieser These widerspricht die neuere Forschung: „Weder ist der republikanische pater familias ein völlig unabhängiger, gewalttätiger Freibeuter, noch der kaiserzeitliche Aristokrat ein furchtsamer Staatsdiener.“88 Vielmehr habe schon beim früheren pater familias ein Zwang zur Selbstdisziplinierung bestanden.89 Ausserdem liessen sich nach MEYER-ZWIFFELHOFER die beiden Haltungen gegenüber dem Geschlechtsleben nicht so klar von einander abgrenzen, sondern die beiden Formen bisexualit é de sabrage und h é t é rosexualit é de reproduction existierten nebeneinander. Ebenso waren auch Mischformen zu finden.90
Nun wollen wir uns der Institution der Ehe zuwenden. Das römische Ideal der ehelichen Gemeinschaft war nicht Liebe, sondern concordia - „das gegenseitige Einvernehmen oder besser: die Vermeidung von Zwietracht.“91 Wer öffentlich Verliebtheit demonstrierte, wurde sozial ausgegrenzt, da die Liebe weder mit dem Rationalismus der stoischen sapientia noch mit den natürlichen familiären und gesellschaftlichen Bindungen vereinbar sei.92
Eine Ehe, aus Liebe geschlossen wurde, war nicht denkbar. Deshalb konnten sich die Berater des Kaisers Claudius nach der Erzählung des TACITUS sich gar nicht vorstellen, dass sich die Kaiserin Messalina in einen anderen verliebt hatte, sondern vermuteten nach der Heirat von Messalina und ihrem Geliebten Silius einen Komplott: „So lange ein Schauspieler93 mit dem Schlafzimmer des Princeps sein Spiel getrieben habe, sei ihm zwar Schande angetan worden, aber von Untergang keine Rede gewesen; jetzt sei es ein junger Mann von Adel, der sich durch die Würde seiner Erscheinung, durch die Kraft seines Geistes und das bevorstehende Konsulat zu höherer Hoffnung rüste; es sei doch offensichtlich, was man von einer solchen Eheschliessung zu erwarten habe.“94 Sie vermuteten eine politische Intrige gegen den Kaiser. Demgegenüber nimmt VEYNE Messalina aus heutiger Optik in Schutz: „Cette jeune femme de vint-quatre ans [...] était en réalité und sentimentale, une amoureuse romantique. […] Messaline est un cas authentique d’amour fou.“95 Als Beweis, dass es keine Intrige gewesen sei, führt er an derselben Stelle an: „[…] l’évenément le prouvera, mais un peu tard […]“. Eine Bestätigung für diesen „Beweis“ habe ich leider im Text nicht gefunden.
Die Ehe sollte die Sexualität der Jugendlichen zügeln und der Frau ein Mittel sein, durch die Herrschaft des Mannes zur Selbstbeherrschung zu gelangen.96 VEYNES zweite zentrale These zum römischen Verhältnis zwischen den Geschlechtern besagt, dass sich die Ehe von einer Institution der Privilegierten zu einer institution de la soci é t é gewandelt habe.97 Dem widerspricht MEYER-ZWIFFELHOFER aufgrund einer Untersuchung stadtrömischer Inschriften, in der eine Verbreitung eheähnlicher Zustände selbst für die Sklavenschicht belegt wurde. Auch die Augusteischen Ehegesetze hätten zur Verbreitung der Ehe bereits um die Zeitenwende beigetragen, indem ehelose Personen diskriminiert wurden.98 Fest steht aber, dass im 1. und 2. Jahrhundert n. u. Z. (sexuelle) Beziehungen in der Ehe eine Aufwertung erfahren haben.99
2.7 Der Stellenwert der Vaterschaft
Ein wichtiges, wenn nicht gar das Ziel der aufgewerteten Institution der Ehe war es, legitime Söhne hervorzubringen. „Vater zu sein ist Bürgerpflicht und folglich Tugend...“100 schreibt THOMAS. Rom war im untersuchten Zeitraum im okzidentalen Raum eine Weltmacht und brauchte als solche viele Soldaten, die glorreich für ihr Vaterland starben. Den Vätern im Kampfe gefallener Krieger wurde eine beeindruckende Anerkennung zuteil. Entsprechend überwog - zumindest nach der Verhaltensnorm - beim Tode eines Sohnes im Krieg die Freude ob des dadurch erworbenen Ruhmes die Trauer: nach einem Geschichtsschreiber aus der Zeit des Augustus feierten die Väter Triumphe, wenn ihr Sohn zum Wohle des Staates gestorben war.101 Die Bereitstellung von Kriegern war jedoch nicht das einzige Ziel der hohen Bewertung der Vaterschaft: Gesellschaftlich-politische Machtpositionen sollten über viele Generationen hinweg in derselben Familie behalten werden Aus diesem Grund wurden Söhne schon früh zu Bürgern abgerichtet: Sie mussten ihren Vater bei politischen Angelegenheiten überallhin begleiten. Bei offiziellen Anlässen hatten sie an der Seite des Vaters als Repräsentationsfiguren aufzutreten: „Der Bürger war Vater und zeigte das“.102 Die Macht des pater familias über seine Söhne war fast unbeschränkt, wie wir weiter oben gesehen haben, doch sein Stolz darauf, Vater zu sein, war es auch.
3. SCHLUSSBEMERKUNGEN
3.1 Zusammenfassung
Einleitend wurden die Begriffe pater familias, domus und familia geklärt und der gesellschaftlich-politische Hintergrund dieser Arbeit erläutert: Der römische Staat wurde zur Zeit des Prinzipats von den drei gesellschaftlichen Sektoren Heer, Senat und plebs urbana getragen, wobei dem Prinzeps eine vermittelnde Funktion zwischen den drei Gruppen zukam.
Der darauffolgende Hauptteil der Arbeit behandelt die Vorstellung von Vaterschaft in der stadtrömischen Oberschicht des 1. bis 3. Jahrhunderts n. u. Z. Der pater familias verfügte als chef de clan formal über eine beinahe unbeschränkte Macht über seine domus, in der Praxis war diese Mach jedoch durch gesellschaftliche Normen eingeschränkt. Bei sexuellen Beziehungen hatte er eine aktive Rolle einzunehmen und insofern Selbstbeherrschung zu üben, als dass er keinen Ehebruch mit der Frau eines anderen Bürgers zu begehen hatte und im Idealfalle auf die Ausbeutung ihm Untergebener verzichtete. Gleichzeitig sollte er in diesem Bereich seine Dominanz und Männlichkeit demonstrieren. Erwachsene Söhne, deren Vater noch lebte, hatten sich mit noch widersprüchlicheren Rollenerwartungen auseinander zu setzen: Einerseits schuldeten sie den Pater familias Gehorsam, andererseits nahmen sie gegenüber den übrigen Angehörigen der familia eine männliche, dominante Position ein. Räumlich konnten sich die Söhne mit ihrer Familie aus der domus lösen, doch blieben sie ökonomisch vom chef de clan abhängig. Zwischen Söhnen und Vätern ergab sich kein offen ausgetragener Generationenkonflikt, so dass von einer Akzeptanz der patriarchalen Macht durch die Söhne ausgegangen werden kann. Vaterschaft wurde als eine Angelegenheit willentlicher Entscheidung betrachtet: Der Vater konnte Kinder anerkennen, adoptieren, aussetzen lassen oder ihnen bloss das Recht auf Ernährung zubilligen. Ab dem 2. Jahrhundert v. u. Z. unterstand die Ehefrau weiterhin der patria potestas ihres Vaters und nicht mehr der manus ihres Gatten. Erbschaften konnten nun auch auf der mütterlichen Linie weitergegeben werden. Der grösste Teil des gesellschaftlichen Vermögens blieb jedoch in männlicher Hand.
Die Männer der Aristokratie hatten Angst, es seien nicht genügend Frauen vorhanden, um eine ausreichende Nachkommenschaft zu sichern. Dies führte dazu, dass verheiratete Männer ihre gebärfähigen Frauen an andere Männer ausliehen und nach erfolgter Geburt wieder zurückerhielten. In bezug auf die sexuellen Praktiken wurde nicht zwischen Homo- und Heterosexualität, sondern zwischen aktivem (virilen) und passivem (femininen) Verhalten unterschieden. Im Laufe des untersuchten Zeitraumes erfuhren eheliche (sexuelle) Beziehungen eine starke Aufwertung, nicht zuletzt mit dem Ziel, mehr legitime Söhne zu erzeugen.
3.2 Schlussfolgerungen und Ausblick
Im Titel dieser Arbeit wurde die Frage aufgeworfen, ob Vaterschaft ein oder sogar das wesentliche Mermal männlicher Identität gewesen sei. Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Beziehungen zwischen dem pater familias und seinen Söhnen, die (willentliche) Beziehung des Vaters zum Kind und das römische Erbrecht untersucht sowie Thesen über den Austausch von gebärfähigen Frauen, den Wandel der Normen über sexuelle Beziehungen und die Veränderung der Vorstellung einer Ehe erörtert. All diese einzelnen Aspekte lassen sich unter einer Formel zusammenfassen: „die Verherrlichung der Vaterschaft, die zur öffentlichen Norm erhoben wird.“103 Damit lässt sich die Eingangs gestellte Frage ganz klar bejahen: Die Vaterschaft stellte in der römischen Oberschicht des 1. bis 3. Jahrhunderts n. u. Z. ein wesentliches Merkmal männlicher Identität dar.
Die meiner Arbeit zugrunde liegenden Untersuchungen stützten sich zu einem grossen Teil auf Rechtstexte als Quellen. Damit lassen sich wohl die Normen über die Vaterschaft erschliessen, jedoch weniger deren Umsetzung in die Praxis. Neue Einsichten könnte hier beispielsweise eine systematische Untersuchung uns erhaltener Briefe zwischen Vätern und Söhnen liefern. Über die Rolle der Vaterschaft in tieferen sozialen Schichten kann die Geschichtswissenschaft aufgrund der spärlichen Quellenlage nur begrenzt zu neuen Erkenntnissen gelangen. Hier wäre eine Zusammenarbeit mit Archäologen und Ephigraphikern angebracht.
Spannend wäre auch ein Vergleich der Ergebnisse dieser Arbeit mit der Vorstellung von Vaterschaft in römischen Provinzen oder mit den Werten anderer Kulturen, beispielsweise mit dem an Rom angrenzenden Reich der Perser.
4. BIBLIOGRAPHIE
Quellen
TACITUS: Publius Cornelius Tacitus: Annalen. Lateinisch-deutsch, herausgegeben und übersetzt von Erich Heller. 3. Auflage. Düsseldorf; Zürich 1991.
CICERO: De officiis. Ausgewählt und eingeleitet von Gottfried Gröhe. Münster 1994. Nachschlagewerke
BROCKHAUS 2000: Der Brockhaus multimedial 2001 premium. DVD-ROM. Mannheim 2000.
PLOETZ, Karl (Begründer): Der grosse Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte, Freiburg i. Br. 1994.
WISSENSCHAFTLICHER RAT DER DUDENREDAKTION (Hg.): Duden, Rechtschreibung der
deutschen Sprache, 21., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 1996. (Der Duden, Bd. 1).
WISSENSCHAFTLICHER RAT DER DUDENREDAKTION (Hg.): Duden, Fremdwörterbuch, 6., auf der Grundlage der amtlichen Neuregelung der deutschen Rechtschreibung überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim; Wien; Zürich 1997. (Der Duden, Bd. 5).
Sekundärliteratur
DAHLHEIM 1994: Werner DAHLHEIM: Die griechisch-römische Antike, Band 2: Rom. Paderborn; München; Wien, Zürich 1997.
FLAIG 1992: Egon FLAIG: Den Kaiser herausfordern. Die Ursupation im Römischen Reich. Frankfurt a. M.; New York 1992. S. 174-207.
MEYER-ZWIFFELHOFFER 1995: Eckhard MEYER-ZWIFFELHOFER: Im Zeichen des Phallus, Die Ordnung des Geschlechterlebens im antiken Rom. Frankfurt a. M.; New York 1995. S. 212- 231.
OPITZ 2001: Claudia OPITZ: „Gender - eine unverzichtbare Kategorie der historischen Analyse. Zur Rezeption von Joan W. Scotts Studien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“ In: HONEGGER, Claudia; ARNI, Caroline (Hg.): Gender - die Tücken einer Kategorie, Joan W. Scott, Geschichte und Politik. Zürich 2001. S. 95-115.
SCOTT 1988: Joan Wallach SCOTT: „Gender - a useful Category of historical Analysis” in: Ead.: Gender and the Politics of History. New York 1988. S. 28-50.
THOMAS 1986: Yan THOMAS, „Rom: Väter als Bürger in einer Stadt der Väter”, in: André
BURGIÈRE et al. (Hg.), Geschichte der Familie 1: Altertum. Frankfurt a. M.; New York; Paris 1996. S. 277-326.
VEYNE 1978: Paul VEYNE: „La famille et l’ amour sous l’ Haut-Empire Romain.”in : Annales E. S. C., Band 33. Paris 1978. S. 35-63.
[...]
1 Für die Begriffsdefinitionen in diesem Abschnitt beziehe ich mich auf das Kapitel „Kern- oder Grossfamilie? Abhängigkeiten, Kontrolle, Wohnform“ in: Yan THOMAS, “Rom: Väter als Bürger in einer Stadt der Väter”, in: André BURGIÈRE et al. (Hg.), Geschichte der Familie 1: Altertum, Frankfurt a. M.; New York; Paris 1996. S. 277-326, hier S. 179-307. (Zit. THOMAS 1986)
2 Ab den 1. Jh. nach unserer Zeitrechnung unterstanden dem pater familias auch verheiratete Töchter oder Enkelinnen (siehe Abschnitte 2.4 und 2.5).
3 Diese aus der Ethnologie stammende Bezeichnung für den pater familias erachte ich als sehr treffend. Sie
stammt aus: Paul VEYNE: “La famille et l’ amour sous l’ Haut-Empire Romain.”in : Annales E. S. C., Band 33. Paris 1978. S. 35-63, hier S. 37. (Zit. VEYNE 1978)
4 Zur Definition von Männlichkeit und Weiblichkeit siehe Eckhard MEYER-ZWIFFELHOFER: Im Zeichen des Phallus, Die Ordnung des Geschlechterlebens im antiken Rom. Frankfurt a. M.; New York 1995. S. 212-231. (Zit. MEYER-ZWIFFELHOFFER 1995) und Joan Wallach SCOTT: “Gender - a useful Category of historical Analysis” in: Ead.: Gender and the Politics of History. New York 1988. S. 28-50. (Zit. SCOTT 1988)
5 Im folgenden Abschitt beziehe ich mich hauptsächlich auf Egon FLAIG: Den Kaiser herausfordern. Die Ursupation im Römischen Reich. Frankfurt a. M.; New York 1992. S. 174-207. (Zit. FLAIG 1992)
6 In FLAIG 1992, S. 174 wird dieser Begriff folgendermassen umschrieben: „Verfassung ist die Summe aller Regeln, gemäss welchen abgegrenzte Herrschaftsbefugnisse bestimmten Personen oder Gruppen erteilt werden.“
7 Deshalb wird in FLAIG 1992, S. 175 folgende Definition für Verfassung gefordert : „Verfassung meint die Gesamtheit der Regeln und Praktiken eingefordeter Kommunikation und Interaktion der politisch relevanten Gruppen untereinander und jeder einzelnen mit dem Kaiser.“
8 Volksversammlung der nichtadligen römischen Bürger, d.h. der plebs urbana, die mit der Bestätigung des Kaisers signalisierte, dass dieser auf ihre Unterstützung angewiesen war.
9 FLAIG 1992, S. 177.
10 FLAIG 1992, S. 181.
11 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 213. MEYER-ZWIFFELHOFER nennt dieses Konzept von Männlichkeit Virilität.
12 BROCKHAUS 2000, Schwerpunktartikel zu „Familie und Gesellschaft in der Antike“ von Joseph MARTIN. Im 2. Jh. v. u. Z. ging die Gewalt über die Gattin aus der manus des Ehemannes in die patria potestas ihres Vaters über (s. Kap. 2.4).
13 THOMAS 1986, S. 325.
14 BROCKHAUS 2000, Schwerpunktartikel zu „Familie und Gesellschaft in der Antike“ von Joseph MARTIN. Zur Bemerkung in Klammern s. Kap. 2.4.
15 DAHLHEIM 1994: Werner DAHLHEIM: Die griechisch-römische Antike, Band 2: Rom, Paderborn; München; Wien, Zürich 1997.
16 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 212.
17 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 214.
18 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 216. Zu diesem Punkt s. Kap. 2.7
19 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 218.
20 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 219.
21 TACITUS 11.28. Tacitus beklagte in seinen Werken ganz allgemein einen Sittenzerfall seit dem Ende der Republik. Um diese Aussage zu unterstützen, stellte er in den Annalen Kaiser wie Claudius oder Nero als unmännlich dar.
22 Auch der Kaisergalt als pater: Schon Augustus bezeichnete sich als pater patriae. Die Verwendung des Begriffes „Vater“ im politischen Kontext unterstreicht erneut den hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Vaterschaft.
23 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 219.
24 THOMAS 1986, S. 290.
25 Der Begriff „Mündigkeit“ als Übersetzung für sui iuris erscheint mir im Deutschen angemessener als „Minder- bzw. Volljährigkeit“, da in letzteren Begriffen das Erreichen eines bestimmten Alters impliziert wird, was nicht dem altrömischen Denken entsprechen würde.
26 BROCKHAUS 2000, Schwerpunktartikel zu „Familie und Gesellschaft in der Antike“ von Joseph MARTIN.
27 Unveröffentlichtes Protokoll des Proseminars „Unmännliche Kaiser...“ vom 30. Mai 2001.
28 VEYNE 1978, S. 36. Die lebenslange Übertragung von Herrschaft an einzelne Personen in einem System, in dem Macht durch Vererbung weitergegeben wird, führt noch heute zu Problemen, beispielsweise in Königshäusern. Man denke an das tragische Schicksal des britischen Kronprinzen Charles, der sich bereits dem Rentenalter nähert und noch immer auf seine Krönung wartet...
29 THOMAS 1986, S. 321.
30 VEYNE 1978, S. 36.
31 ebd.
32 THOMAS 1986, S. 302f.
33 Nach einem unveröffentlichten Mail von Thomas SPÄTH.
34 VEYNE 1978, S. 36. Kinder der Oberschicht wurden durch eine nutrix (Amme) oder einen nutritor aufgezogen; weder Vater noch Mutter wendeten viel Zeit für die Erziehung auf. Dies führte zu einer geringeren emotionalen Bindung der Kinder an ihre Eltern.
35 THOMAS 1986, S. 300f.
36 THOMAS 1986, S. 301.
37 THOMAS 1986, S. 303ff.
38 Zum Erbrecht siehe das folgende Kapitel.
39 Cicero: De officiis. Ausgewählt und eingeleitet von Gottfried Gröhe. Münster 1994. Liber 1,54. Übersetzung zitiert nach: THOMAS 1986, S. 289f. Die Wendung der „Familie als Grundlage und Keimzelle (seminarium) des Staates ist auch heute noch gebräuchlich und stammt laut Brockhaus 2000 von dieser Stelle bei Cicero.
40 THOMAS 1986, S. 280.
41 THOMAS 1986, S. 282.
42 THOMAS 1986, S. 282.
43 VEYNE 1978, S. 47.
44 THOMAS 1986, S. 284f.
45 VEYNE 1978, S. 46. Bekannt als Methode der Empfängnisverhütung ist der coitus interruptus, vermutet wird auch, dass dem rituellen Bad der Frau nach dem Geschlechtsakt eine empfängnisverhütende Wirkung zugeschrieben wurde. Dieser Ritus findet sich im Judentum noch heute.
46 VEYNE 1978, S. 47.
47 THOMAS 1986, S. 279f.
48 THOMAS 1986, S. 280.
49 THOMAS 1986, S. 291f. „Abstammung“ ist hier wie in Abschnitt 2.3 beschrieben als eine Sache der willentlichen väterlichen Entscheidung und nicht als leibliche Verwandtschaft zu verstehen!
50 Mit „Agnaten“ werden im römischen Recht alle der väterlichen Gewalt durch Geburt oder Adoption Unterworfenen bezeichnet (Nach BROCKHAUS 2000).
51 Im römischen Recht die Blutsverwandten. Die kognatische Verwandtschaft beruht auf der gemeinsamen Abstammung von einem Mann oder einer Frau (BROCKHAUS 2000).
52 THOMAS 1986, S. 292.
53 THOMAS 1986, S. 293 sowie S. 307-320.
54 Die manus („Hand“) bezeichnet die Gewalt des Ehemannes gegenüber der Frau, sie entspricht der patria potestas gegenüber den Kindern (Siehe auch Kap. 2.1)
55 THOMAS 1986, S. 294.
56 THOMAS 1986, S. 292.
57 VEYNE 1978, S. 41.
58 Nach STOWASSER 1994 ist das Substantiv patria eng verwandt mit dem Adjektiv patrius, das sowohl mit „väterlich“ als auch mit „heimisch“ übersetzt werden kann. Ist das Vaterland das Land, in dem man sich so heimisch fühlt wie in der domus des paters ? Oder ist es aus der Vorstellung des Staates entstanden, der sich rechtlich einzig aus den patres zusammensetzt? Eine entsprechende sprachliche Untersuchung könnte wertvolle Hinweise auf die Bedeutung der Vaterschaft geben, doch gelang es mir trotz intensiver Recherchen leider nicht, eine solche ausfindig zu machen. STOWASSER 1994 : STOWASSER , Joseph u.a.: Stowasser: lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Ausgabe 1994. Oldenburg; München; Wien 1994
59 THOMAS 1986, S. 307.
60 ebd.
61 THOMAS 1986, S. 309.
62 THOMAS 1986, S. 316.
63 THOMAS 1986, S. 310.
64 THOMAS 1986, S. 311.
65 Zit. nach THOMAS 1986, S. 310. Siehe auch: PLUTARCHUS: Fünf Doppelbiographien: griechisch und deutsch. Übers. von Konrat Ziegler und Walter Wuhrmann. Teil 1: Alexandros und Caesar. Aristeides und Marcus Cato. Perikles und Fabius Maximus. Zürich 1994.
66 THOMAS 1986, S. 311f. Die Grenzen zwischen Abtretung und Ehebruch waren nicht immer klar definiert, was zwischen Männern zu Auseinandersetzungen führen konnte.
67 THOMAS 1986, S. 310f.
68 ebd.
69 THOMAS 1986, S. 312f.
70 THOMAS 1986, S. 312f. Die Tendenz zu einem erhöhten Männeranteil in einer patriarchal geprägten Gesellschaft lässt sich auch heute noch feststellen: In Indien beispielsweise wird viel häufiger abgetrieben, wenn ein Mädchen erwartet wird; dies wirkt sich auch auf die gesellschaftliche Struktur aus, indem bereits heute der Männeranteil den Frauenanteil überwiegt.
71 THOMAS 1986, S. 314.
72 PLOETZ, Karl (Begründer): Der grosse Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte. Freiburg i. Br. 1994. Seite 257.
73 THOMAS 1986, S. 308.
74 THOMAS 1986, S. 314f.
75 In MEYER-ZWIFFELHOFER wird auf S. 221 als ein Grund für das frühe Heiratsalter der Frauen vermutet, dass sich so das Problem der Jungfräulichkeit beim Einzug in die Ehe nicht stellt
76 Für den ganzen Abschnitt: THOMAS 1986, S. 318ff.
77 VEYNE 1978, S. 35-63 sowie MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 226-229.
78 Nach mündlichen Äusserungen von Thomas SPÄTH im Rahmen des Proseminars „Unmännliche Kaiser...“.
79 MEYER-ZWIFFELHOFER S. 213.
80 VEYNE 1978, S. 39.
81 Übersetzung des Begriffs nach einem Mail von Thomas SPÄTH VOM 30. 7. 2001 (unveröffentlicht).
82 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 228. Im Falle von weiblicher Homosexualität hätte eine Frau eine „aktive“ Rolle innegehabt, was nicht mit der Norm der männlichen Dominanz vereinbar gewesen wäre. Deshalb wurde diese Form von Sexualität tabuisiert.
83 VEYNE 1978, S. 37.
84 ebd.
85 ebd.
86 VEYNE 1978, S. 40.
87 VEYNE 1978, S. 37.
88 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 228.
89 Siehe Kap. 2.1.
90 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 229.
91 THOMAS 1986, S. 321.
92 THOMAS 1986, S. 321 sowie VEYNE 1978, S. 49.
93 Gemeint ist Mnester, ein früherer Geliebter Messalinas.
94 TACITUS 11.28
95 VEYNE 1978, S. 42. Mit dem Bild der „verrückten Liebe“ übernimmt VEYNE unkritisch die von Tacitus verwendete Assozation von Weiblichkeit und Chaos. Dazu siehe Sandra R. JOSHEL, „Femle desire and the Discourse of Empire: Tacitus’ Messalina“, in: Judith P. HALLET, Marlyn B. SKINNER (Hg.): Roman Sexualities. Princeton 1997. S. 221-254.
96 THOMAS 1986, S. 321f.
97 VEYNE 1978, S. 39.
98 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 227f.
99 MEYER-ZWIFFELHOFER 1995, S. 229.
100 THOMAS 1986, S. 323.
101 Ganzer Abschnitt: THOMAS 1986, S. 324.
102 THOMAS 1986, S. 325.
Häufig gestellte Fragen: Analyse von Vaterthemen in römischen Gesellschaftsnormen
Worum geht es in dieser Analyse?
Diese Analyse untersucht die Rolle und Bedeutung der Vaterschaft in der römischen Gesellschaft, insbesondere in der Oberschicht während der späten Republik und des frühen Prinzipats. Sie beleuchtet, wie Vaterschaft die männliche Identität prägte und wie sich dies in den gesellschaftlichen Normen und Praktiken widerspiegelte.
Welche Begriffe werden in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung erläutert die Schlüsselbegriffe pater familias (Familienoberhaupt), domus (Haushalt) und familia (Familie), um ein grundlegendes Verständnis der römischen Familienstruktur zu schaffen.
Welche gesellschaftlichen Machtverhältnisse werden betrachtet?
Die Analyse betrachtet die tripolaren Machtverhältnisse in der römischen Gesellschaft, bestehend aus Heer, Senat und plebs urbana (städtisches Volk), und wie diese das Prinzipat prägten.
Wie wird die Macht des pater familias dargestellt?
Die Macht des pater familias wird als fast unumschränkt beschrieben, jedoch durch gesellschaftliche Normen und Gesetze eingeschränkt. Er hatte die patria potestas (väterliche Gewalt) über seine Kinder und die manus (Gewalt) über seine Frau, zumindest bis zum Wandel des Eherechts.
Was bedeutet der Begriff "Virtuelle Männer" in Bezug auf die Söhne?
Der Begriff "Virtuelle Männer" bezieht sich auf erwachsene Söhne, die solange ihr Vater lebte, in ihren Rechten und Entscheidungsbefugnissen eingeschränkt waren, obwohl sie in ihren eigenen Familien eine virile Position einnahmen. Sie waren ihren Vätern zum Gehorsam verpflichtet.
Wie wurde Vaterschaft als willentliche Entscheidung betrachtet?
Die Anerkennung der Vaterschaft wurde als willentliche Entscheidung des Vaters angesehen. Er konnte entscheiden, ein Kind als seinen Erben anzuerkennen, es aussetzen zu lassen oder ihm lediglich das Recht auf Ernährung zubilligen. Adoption war eine gleichwertige Möglichkeit zur Festlegung bürgerlicher Abstammung.
Was ist der Unterschied zwischen patrilinearer und matrilinearer Vererbung?
Patrilineare Vererbung bedeutet, dass das Erbe hauptsächlich in männlicher Linie weitergegeben wurde. Matrilineare Vererbung bezieht sich auf die Vererbung über die mütterliche Linie. Im Laufe der Zeit wurde die matrilineare Vererbung in der römischen Gesellschaft wichtiger, besonders ab dem 2. Jh. v. u. Z., aber der grösste Teil des Vermögens blieb in männlicher Hand.
Was bedeutete die "Zirkulation der Gebär-Mütter"?
Die "Zirkulation der Gebär-Mütter" beschreibt die Praxis, dass verheiratete Männer ihre Frauen an andere Männer "ausliehen", um die Nachkommenschaft zu sichern. Dies war ein Ausdruck der Sorge um die Reproduktion der Aristokratie.
Wie veränderte sich die Sexualmoral in der römischen Gesellschaft?
Die Sexualmoral wandelte sich von einer "Bisexualität des Säbelhiebs" (aktive vs. passive Rolle im Geschlechtsleben, bei der Männer immer die Aktiven waren) zu einer "Heterosexualität der Reproduktion" (die später zur Grundlage christlicher Moral wurde). Die Ehe erfuhr eine Aufwertung, um legitime Nachkommen zu zeugen.
Welchen Stellenwert hatte die Vaterschaft in der römischen Gesellschaft?
Die Vaterschaft hatte einen sehr hohen Stellenwert in der römischen Gesellschaft und war ein wesentliches Merkmal männlicher Identität. Sie galt als Bürgerpflicht und Tugend, und Väter wurden für ihre Söhne geehrt, die im Dienst des Staates starben.
- Quote paper
- Jan Schudel (Author), 2001, Vaterschaft als wesentliches Merkmal männlicher Identität? - Die Beziehung des pater familias zu seinen Söhnen in der röm. Oberschicht im 1.-3.Jh. n. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105665