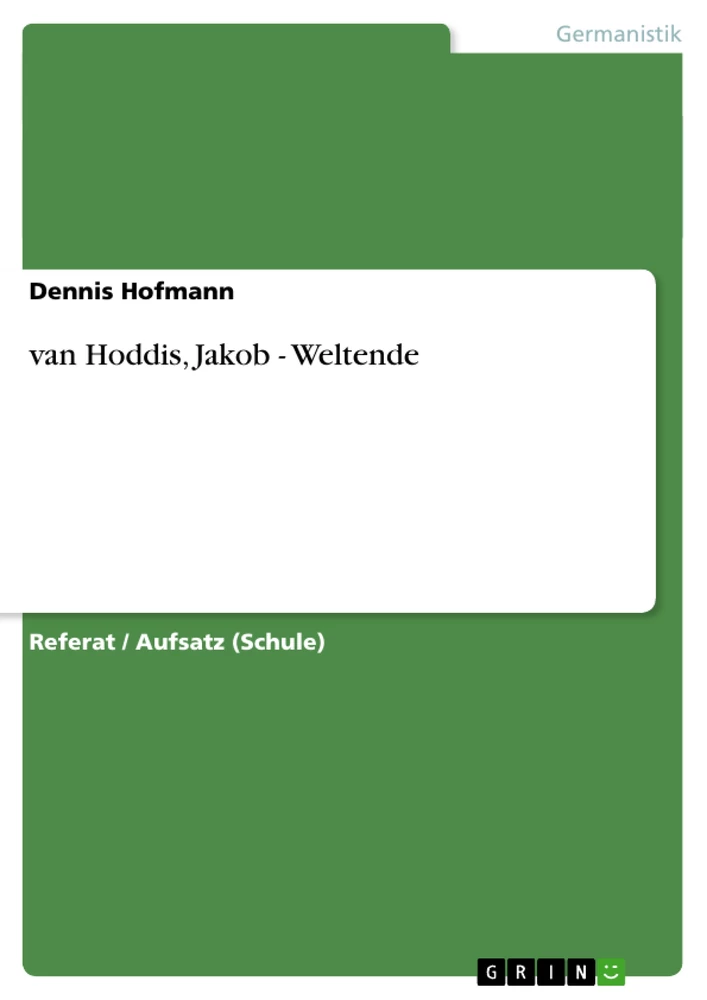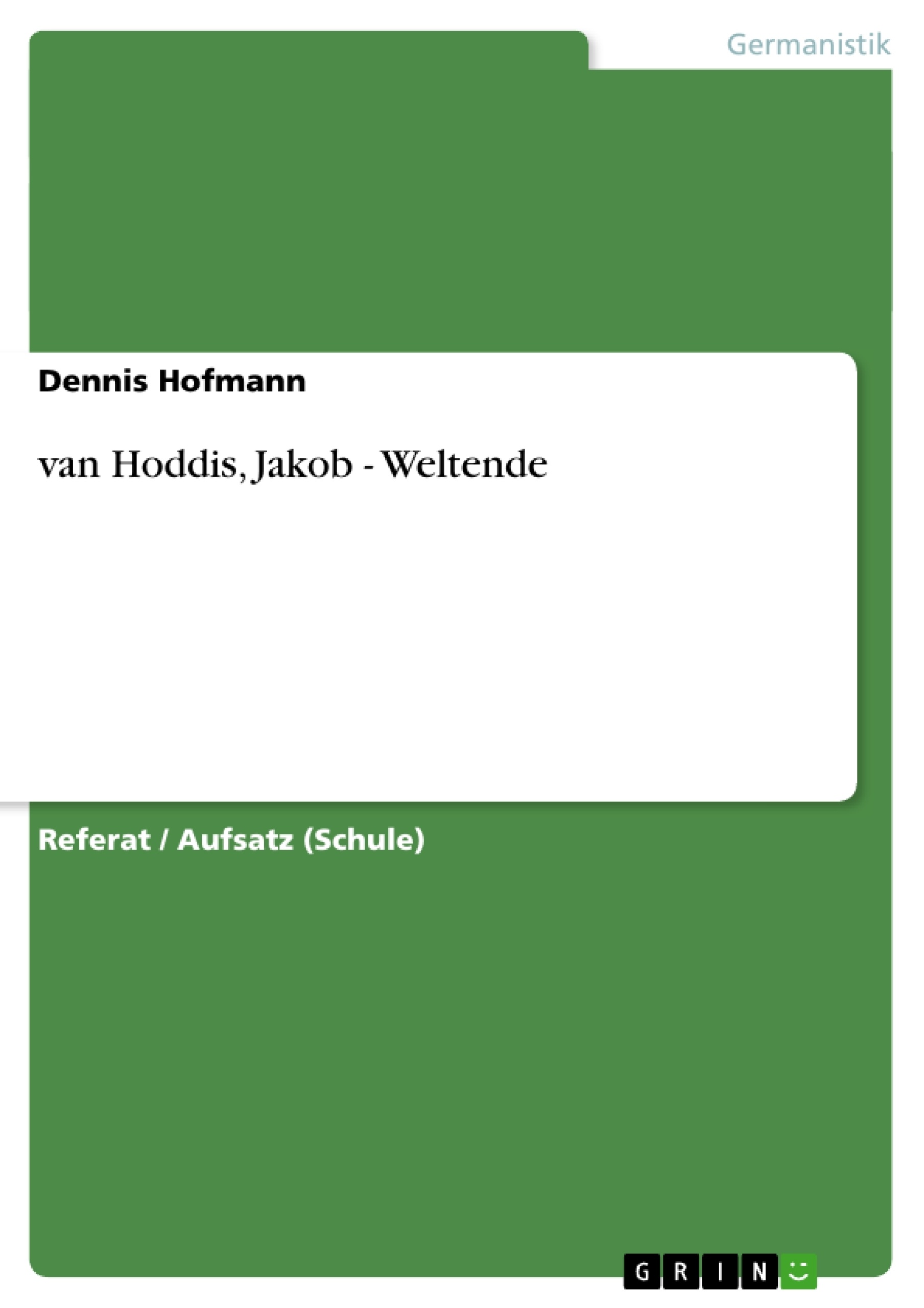Stellen Sie sich eine Welt vor, in der bürgerliche Konventionen in Staub zerfallen und apokalyptische Bilder in dadaistischer Manier aufscheinen. Jakob van Hoddis' "Weltende", ein Schlüsselwerk des deutschen Expressionismus, katapultiert uns in ein verstörendes Szenario, in dem Hüte von spitzen Köpfen fliegen, Dachdecker entzwei gehen und die Flut unaufhaltsam steigt. Doch was verbirgt sich hinter dieser grotesken Fassade? Ist es die Vorahnung einer drohenden Katastrophe, eine sozialkritische Abrechnung mit dem Wilhelminischen Zeitalter oder gar die "Marseillaise der expressionistischen Revolte"? Diese tiefgründige Analyse entschlüsselt die vielschichtigen Bedeutungsebenen des Gedichts, von der formalen Struktur mit ihren umarmenden Reimen, die das Festhalten am Alten symbolisieren, bis hin zur revolutionären Sprengkraft, die in der Zerstörung von Dämmen und dem Entgleisen von Eisenbahnen zum Ausdruck kommt. Entdecken Sie, wie van Hoddis mit sprachlicher Virtuosität und dadaistischen Elementen eine beunruhigende Vision der Moderne erschafft, die den Leser zwischen Lachen und Weinen schwanken lässt. Eine detaillierte Interpretation, die sowohl die formale Gestaltung als auch die inhaltliche Tiefe von "Weltende" beleuchtet und es als prophetisches Zeugnis einer Epoche des Umbruchs und der Angst vor dem Untergang präsentiert. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Expressionismus, Lyrikinterpretation und die Auseinandersetzung mit den großen Fragen der Zeit interessieren. Tauchen Sie ein in die expressionistische Welt von van Hoddis und erleben Sie, wie ein Gedicht zum Spiegel einer Epoche wird, die von Krisen, Umbrüchen und dem Aufbruch in eine ungewisse Zukunft geprägt ist. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung des Hutes als Standesmerkmal, die Rolle der Dachdecker als Sinnbild für den schutzlosen Zustand und die prophetische Kraft der "Westentaschenapokalypse", die bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren hat. Eine Reise durch die expressionistische Lyrik, die Sie so schnell nicht vergessen werden!
Interpretation des Gedichtes „Weltende“ von Jakob van Hoddis
Dem B ü rger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, In allen L ü ften hallt es wie Geschrei. Dachdecker st ü rzen ab und gehn entzwei Und an den K ü sten - liest man - steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen An Land, um dicke D ä mme zu zerdr ü cken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Br ü cken.
Das Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis, mit bürgerlichem Namen Hans Davidsohn, wurde erstmals im Jahre 1910 im „Neopathetischen Kabarett“ verbal vorgetragen und dann 1911 in der Zeitschrift „Der Demokrat“ schriftlich publiziert.
Was von Hoddis damals noch nicht wissen konnte war, dass sein Werk als das berühmteste Gedicht1 in die Geschichte des deutschen Expressionismus eingehen würde.
Formal ist das Gedicht in zwei Strophen mit jeweils vier Zeilen, die wiederum aus fünf Jamben zusammengesetzt sind, gegliedert. Die Zeilen reimen sich nach dem Schema abba und abab. Der umarmende Reim in der ersten Strophe könnte inhaltlich auf das Festhalten des Bürgertums am Kaiserreich, dessen Ende van Hoddis prophezeit, hinweisen.
Eben dieses Bürgertum wird in der ersten Zeile durch den Verlust seines Standesmerkmales, dem Hut, unfreiwillig bloßgestellt. Die Metapher des spitzen Kopfes steht für den Spießbürger2 und festigt so die Annahme, dass das Bürgertum bzw. die Bourgeoisie gemeint ist.
Wir erfahren also über den Bürger nichts, außer, dass er einen spitzen Kopf hat. Ebenso erfahren wir nichts über Zeit und Ort des Geschehens. So erzeugt der Autor eine Distanz des Lesers zu den Geschehnissen und hindert ihn daran, sich mit dem Bürger, der seinen Hut verliert, zu identifizieren3.
Die zweite Zeile beschreibt das kollektive Entsetzen der erzkonservativen Gesellschaft über den Verlust des Standesmerkmals, der auch als Andeutung des Zusammenbruches des Wilhelminischen Zeitalters gedeutet werden kann.
In der dritten Zeile wird den von den Dächern stürzenden Dachdeckern, wie zuvor schon dem Bürger, jegliche Individualität genommen. Sie werden als Kollektiv erwähnt und auf ihren Beruf reduziert. Die dadaistischen Ansätze („...und gehn entzwei“), die dem Gedicht eine gewisse infantile Naivität verleihen machen es dem Leser einfach, sich die einzelnen Szenen als Bild oder Filmsequenz vorzustellen4. Eine weitere Folge dessen ist auch, dass der Leser nicht weiß, ob er das Gedicht nun als lustig oder traurig empfinden soll. Inhaltlich ist die dritte Zeile dahin gehend interessant, dass man das Dach als Schutzsymbol auffassen kann, welches durch das Entzweigehen der Dachdecker schutzlos der Witterung ausgesetzt ist und morbide vor sich hin vegetiert. Deutet man nun das Dach als Schutz des fragilen Kaiserreiches, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis dieses einstürzen würde5.
In der vierten Zeile wird durch den Einschub „liest man“ erneut Distanz erzeugt. Durch die, im Vergleich zur dritten Zeile, sprachlich ernste Darstellung des Steigens der Flut, bekommt man zum ersten Mal den Eindruck einer gefährlichen Situation. Diesen Ernst der Lage scheint die Bevölkerung (der Bürger) aber nicht wahrzunehmen, da diese drohende Gefahr zwar registriert aber nicht weiter beachtet wird.
In der darauffolgenden fünften Zeile ist es dann soweit: „Der Sturm ist da“. Der Sturm ist da und die schützenden Dächer des Kaiserreichs sind fragil. Folglich fällt es den wilden Meeren auch leicht, über die Ufer zu treten, was durch den abermals dadaistischen Ausdruck „hupfen“ verdeutlicht wird.
Ebenfalls ein Hinweis darauf, dass sich die Lage zuspitzt, ist der Wechsel von den bisher stakkatohaften Sätzen auf das Enjambement (fünfte zur sechsten Zeile). Dieser Zeilensprung kann auch bildlich auf das Überspringen der Meere an Land gedeutet werden.
Die Intention der Meere für das „an Land hupfen“ wird alliterarisch in der sechsten Zeile dargestellt: „um dicke Dämme zu zerdrücken“. Diese Alliteration beschreibt die unaufhaltsame Wucht und nicht zu bändigende Absicht der Meere die schützenden Dämme wie Kinderspielzeug zu zerstören6. Nun befindet sich das Kaiserreich auf dünnem Eis und die sich unterdrückt fühlende und sich nach Demokratie sehnende Arbeiterklasse, sowie die expressionistische Bewegung, warten nur darauf es zu versenken. Doch das zu erwartende Spektakel wird dem Leser zunächst vorenthalten. Jakob van Hoddis bricht an dieser Stelle das Gesetz der Steigerung7, indem er die Auswirkungen der Ereignisse auf die Menschheit durch ein simples „Verschnupftsein“ ausdrückt. Diese Tatsache ist für den Leser sehr verwirrend: soll er nun lachen oder weinen, nachdenken oder nicht?
Unmittelbar danach, in der achten und letzten Zeile, wird jedoch Klarheit geschaffen: van Hoddis beendet sein Gedicht damit, dass er Eisenbahnen von Brücken stürzen lässt. Nun realisiert der Leser, dass es sich bei „Weltende“ um ein sozialkritisches, bürgerliches „Trauerspiel“ und keinesfalls um eine „Komödie“ handelt.
Aus sozialistischer Sichtweise könnte die Tatsache, dass van Hoddis Eisenbahnen abstürzen lässt und nicht etwa Pferdekutschen umkippen, auf die Abneigung der Arbeiterklasse gegen Maschinen hinweisen, die ihrer Meinung nach für die schlechte soziale Lage verantwortlich waren und die Arbeiter zu Fabriksklaven machten.
Insgesamt ist diese „Westentaschenapokalypse8 “ prophetisch zu deuten, was jedoch keinesfalls bedeutet, dass van Hoddis im Sinn hatte einen realen Weltuntergang oder den Ersten Weltkrieg vorauszusagen. Wenn jedoch van Hoddis´ Dichterkollege Johannes R. Becher das Gedicht rückblickend als „Marseillaise der expressionistischen Revolte“ bezeichnet, so steckt auch in diesem pathetischen Vergleich mit dem Kampflied der Französischen Revolution eine prophetisches Verständnis9. Wie die Französischen Revolution das Ende des Feudalismus in Frankreich bedeutete, so soll „Weltende“ und die gesamte expressionistische Revolte eine Kampfansage an das Kaiserreich und die bürgerliche Welt darstellen.
[...]
1 ) expressionistische Gedichte, hg. von Peter Rühmkopf, Berlin 1976 (in Zukunft: eG), Seite (in Zukunft: S.) 61
2 ) Lektürehilfen: Lyrik des Expressionismus, hg. Von Franz Karl von Stockert, Stuttgart-Düsseldorf-Leipzig, 1999 (in Zukunft: LH) S. 30
3 ) LH, S. 30
4 ) LH, S. 36
5 ) eG, S. 61
6 ) eG, S. 61
7 ) LH, S. 31
8 ) eG, S. 62
9 ) LH, S. 32
Häufig gestellte Fragen zum Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis
Was ist das Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis?
„Weltende“ ist ein Gedicht von Jakob van Hoddis (bürgerlicher Name Hans Davidsohn), das erstmals 1910 im „Neopathetischen Kabarett“ vorgetragen und 1911 in der Zeitschrift „Der Demokrat“ veröffentlicht wurde. Es gilt als eines der berühmtesten Gedichte des deutschen Expressionismus.
Wie ist das Gedicht formal aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus zwei Strophen mit jeweils vier Zeilen. Jede Zeile besteht aus fünf Jamben. Das Reimschema ist abba und abab (umarmender Reim in der ersten Strophe, Kreuzreim in der zweiten Strophe).
Was symbolisiert der Verlust des Hutes des Bürgers in der ersten Zeile?
Der Verlust des Hutes symbolisiert den Verlust des Standesmerkmales des Bürgertums und kann als Andeutung des Zusammenbruchs des Wilhelminischen Zeitalters gedeutet werden. Der "spitze Kopf" steht für den Spießbürger.
Welche Rolle spielt die Distanzierung des Lesers vom Geschehen im Gedicht?
Durch das Fehlen von Details zu Zeit und Ort und die pauschale Beschreibung der Personen (z.B. "der Bürger", "Dachdecker") erzeugt der Autor eine Distanz, die es dem Leser erschwert, sich mit den beschriebenen Personen zu identifizieren.
Was bedeuten die stürzenden Dachdecker und das steigende Hochwasser?
Die stürzenden Dachdecker, denen ihre Individualität genommen wird, symbolisieren den Verlust des Schutzes und die Instabilität der bestehenden Ordnung. Das steigende Hochwasser stellt eine gefährliche Situation dar, die aber von der Bevölkerung scheinbar nicht ernst genommen wird.
Was wird mit dem Ausdruck „hupfen“ im Bezug auf die Meere ausgedrückt?
Der dadaistische Ausdruck „hupfen“ verleiht der Darstellung des Überlaufens der Meere eine gewisse Naivität und verstärkt den Eindruck einer surrealen, chaotischen Welt.
Warum bricht van Hoddis das Gesetz der Steigerung, indem er die Auswirkungen der Ereignisse als "Verschnupftsein" darstellt?
Dieser Bruch dient der Verwirrung des Lesers und zwingt ihn, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es ist unklar, ob die Situation nun lustig oder traurig ist, zum nachdenken anregend oder nicht weiter von Bedeutung.
Was symbolisiert der Absturz der Eisenbahnen am Ende des Gedichts?
Der Absturz der Eisenbahnen verdeutlicht das Ausmaß der Katastrophe und macht deutlich, dass es sich bei „Weltende“ um ein sozialkritisches „Trauerspiel“ handelt. Aus sozialistischer Sicht könnte dies auch die Ablehnung der Arbeiterklasse gegenüber Maschinen symbolisieren, die als Ursache für ihre schlechte soziale Lage gesehen wurden.
Wie ist das Gedicht „Weltende“ zu interpretieren?
Das Gedicht ist als prophetische „Westentaschenapokalypse“ zu deuten, die nicht unbedingt einen realen Weltuntergang oder den Ersten Weltkrieg voraussagt, sondern vielmehr als Kampfansage an das Kaiserreich und die bürgerliche Welt verstanden werden kann. Es spiegelt die expressionistische Revolte wider.
- Citar trabajo
- Dennis Hofmann (Autor), 2001, van Hoddis, Jakob - Weltende, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105614