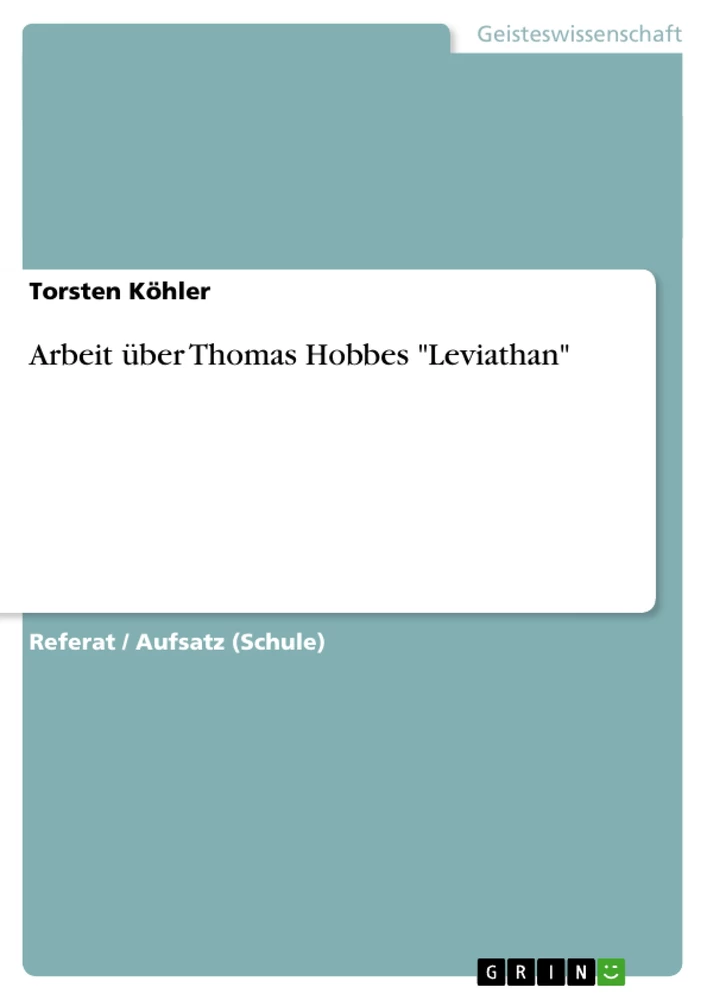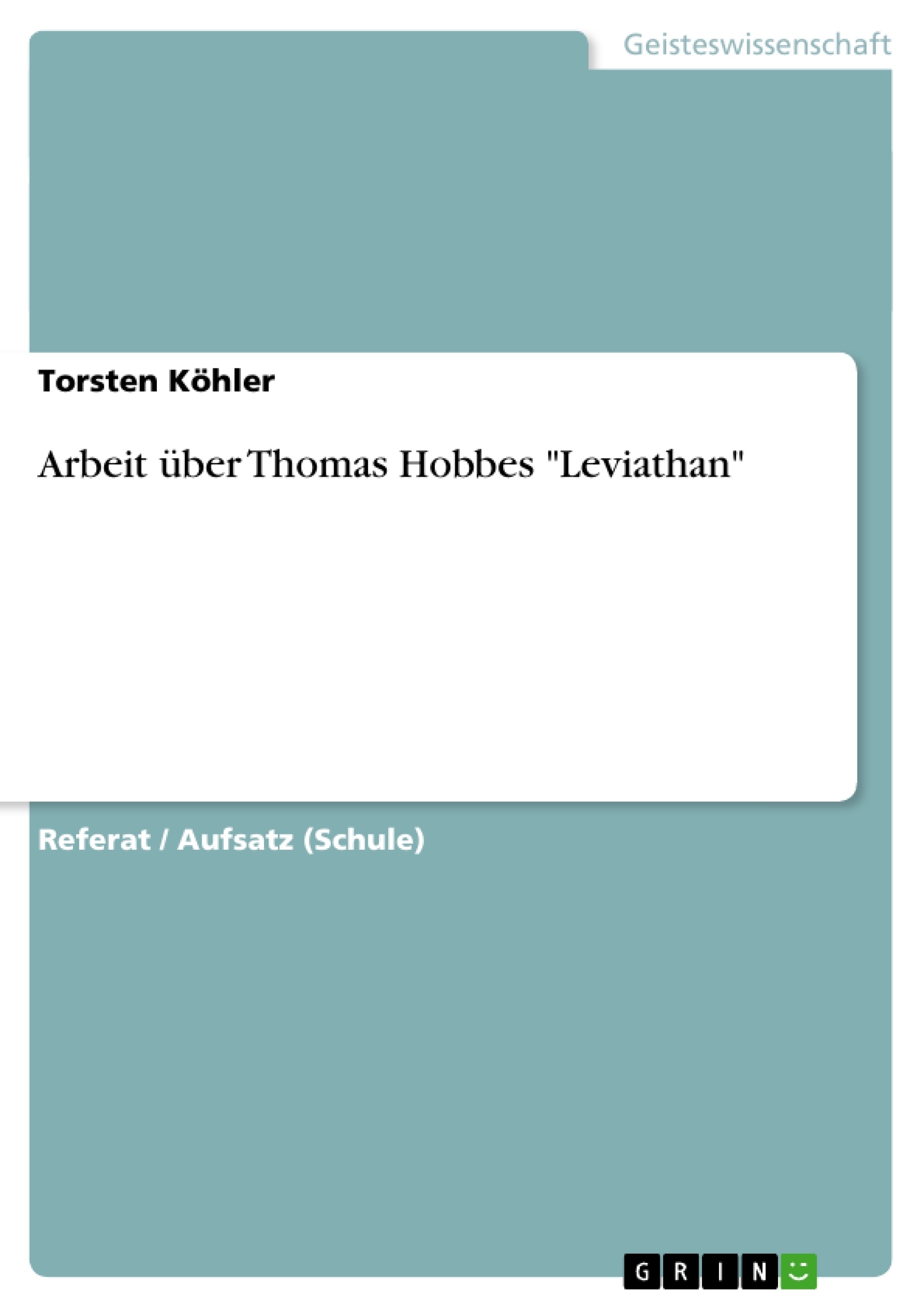Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die tiefsten Ängste des Menschen die Triebfeder für die Gestaltung einer Gesellschaftsordnung sind. In dieser düsteren Vision, entworfen vom brillanten und umstrittenen Denker Thomas Hobbes, ringt der Einzelne in einem unerbittlichen Kampf ums Überleben. "Leviathan" entführt uns in eine Epoche des Umbruchs, in der politische und soziale Unruhen die Fundamente der menschlichen Existenz erschüttern. Hobbes' bahnbrechende Analyse der menschlichen Natur enthüllt eine schonungslose Wahrheit: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Doch aus diesem Zustand des "Krieges aller gegen alle" erwächst die Notwendigkeit eines allmächtigen Staates, des Leviathans, der Ordnung und Sicherheit garantiert. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Thomas Hobbes, dessen anthropologische Erkenntnisse und staatstheoretischen Überlegungen bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben. Ergründen Sie die Tiefen der menschlichen Seele, die von Furcht, Selbsterhaltungstrieb und dem unstillbaren Verlangen nach Macht gezeichnet ist. Entdecken Sie, wie Hobbes' mechanistisch-materialistische Philosophie die Grundlage für seine Vision eines absolutistischen Staates bildet, der die individuellen Freiheiten zugunsten des Gemeinwohls beschneidet. Dieses Werk ist nicht nur eine Analyse des Naturzustands und der Notwendigkeit staatlicher Ordnung, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der menschlichen Vernunft und der Rolle der Religion in einer säkularen Gesellschaft. Begeben Sie sich auf eine intellektuelle Reise, die Sie dazu anregen wird, Ihre eigenen Vorstellungen von Freiheit, Sicherheit und der Natur des Staates zu hinterfragen. "Leviathan" ist ein zeitloses Meisterwerk der politischen Philosophie, das Sie mit unbequemen Wahrheiten konfrontiert und zum Nachdenken über dieConditio humanaanregt.Schlüsselwörter:Thomas Hobbes, Leviathan, Staatstheorie, Anthropologie, Naturzustand, Naturgesetze, Absolutismus, politische Philosophie, Krieg aller gegen alle, Selbsterhaltung, Furcht, Vernunft, Gesellschaftsvertrag, Souveränität, bürgerliche Freiheit, politische Ordnung, Menschenbild, Gewaltmonopol, soziale Gerechtigkeit, Macht, Recht, Moral, Religion,Sicherheit, Frieden. Eine Reise in die Abgründe der menschlichen Natur, die den Leser noch lange nach der letzten Seite beschäftigen wird.
Inhaltsangabe
I. Aufgabenstellung
II. Beantwortung
- Einleitung
- Beschreibung seiner Anthropologie und Staatstheorie
- Stellungnahme
III. Quellenverzeichnis und Zeichenerklärung
I. Aufgabenstellung
( Informieren Sie sich über Werk und Leben von Thomas Hobbes (1588 - 1679) )
1. Legen Sie die Grundlagen der Anthropologie von Thomas Hobbes dar und beurteilen Sie diese!
2. Welche Schlußfolgerungen zieht Hobbes aus seiner Anthropologie für die natürlichen Gesetze, sowie die Notwendigkeit des Staates?
Charakterisieren Sie diesen Staat in seinen Grundzügen und beurteilen Sie das hier vorgeschlagene Modell!
(Hinweis: Die Beantwortung der Fragen kann in einem zusammenhängendem Text durchgeführt werden. )
II. Beantwortung:
(Einleitung)
Die mechanisch - materialistische Philosophie von Thomas Hobbes, einem englischen Materialisten der Aufklärung während der Revolution in England liegt, wie so oft, im sozialen Umfeld begründet. Wie dieses aussah, und welche Ansichten er vertrat, will ich in den folgenden Abschnitten darlegen.
Während des Angriffs der Spanier auf England im Jahre 1588 wurde Thomas Hobbes als Sohn eines Landgeistliche am 3.4.1588 in Westport, Malsbury geboren. Auf Grund dieser Herkunft, war, meiner Ansicht nach, der Grundstein für seine Überlegungen gelegt. Er lebte in relativ gesicherten Verhältnissen und auch seine als klassisch bezeichnete Ausbildung (Latein und Griechisch) sowie das Studium an der Oxford Universität von 1603-1608 trägt ihren Teil mit bei, dass Hobbes als Ideologe der Bourgeoisie wirkte und zu verstehen ist.
Die Bourgeoisie war zwar zu seiner Zeit soziologisch erstarkt, strebte aber trotzdem zur Macht. Aus diesem Grund war Hobbes wohl auch ein typischer Vertreter der Interessen des Bürgertums und des verstaatlichten Adels.
Von 1610-1613 reiste Hobbes, als Lehrer von Adligen, durch Frankreich und Italien. Während dieser Jahre entwickelte sich seine antifeudalistische Haltung und der Glaube an den Herrschaftsanspruch des Bürgertums immer mehr. Das Treffen mit Bacon, dem Stammvater des englischen Materialismus, der das Ziel der rationalen Beherrschung der Natur durch den Menschen, verfolgte, beeinflusste Hobbes indes stark.
In den Jahren 1621-1626 traf er aber noch viele weitere Politiker und Religionskritiker, mit denen er sich beschäftigte. Zu ihnen gehörte auch der Sohn Karl I.. Auf Grund dieser Sympathie zum englischen Adel musste er um 1640, als die revolutionären Bewegungen in England begannen, ins Exil nach Frankreich (Paris) flüchten.
In dieser Zeit änderte er die geplante systematische Darstellung seiner Philosophie und es entstand u.a. sein wohl bekanntes Werk „Leviathan“, dessen atheistischen Anschauungen und rationalen Begründungen seiner Staatstheorie viel Kritik, besonders von Seiten der Adelsanhänger, bis zu seinem Tode nach sich zog.(2/391) Die Ablehnung der Scholastik ( Wissenschaft, die auf der christlichen Lebensauffassung aufbaut und mit biblischen sowie philosophischen Texten stritt.) und „die Einsichten in die Materialität der Welt“, wie er es beschrieb, erlangt er ebenfalls während seiner Zeit in Frankreich.
In seinen Werken über die Staatsphilosophie verteidigt er zwar den Absolutismus, er kritisiert aber auch heftigst Kirche und Religion. Hierin lag auch der Grund für seine zweite Flucht wieder zurück nach England, wo er bis zum Tod lebte und im sehr hohen Alter von 91 Jahren 1679 starb.
Das typische an seiner Philosophie war , dass er versuchte die Wissenschaft als Grundlage seiner Ansichten zu nehmen, indem er die menschlichen Antriebe analysierte und aus ihnen seine Sozialphilosophie ableitete (1/ 309).
Als zentrales Leitmotiv seiner politischen Philosophie ist das Gefühl ( bzw. die Leidenschaft , wie er es selbst nannte) „Furcht“ zu sehen, mit dem er sein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte. H. sagte hierüber sogar aus: „Zwillinge brachte meine Mutter zur Welt, mich und die Furcht“ (1/309). Bürgerkriege und Kriege (z.B. der „Dreißigjährige Krieg“) erlebte er mit oder flüchtete vor ihnen. Aber auch in seiner Heimat England gab es revolutionäre Aufstände, denen u.a. König Karl I. zum Opfer fiel, als er der Absolutismus einführen wollte.
Diese Furcht den Selbsterhaltungstrieb aber auch die Vernunft sah er - wahrscheinlich durch eigene Erfahrungen begründet- als „Grundtriebe“ der Menschen.
Die hobbessche Philosophie hat ihrerseits einen sehr atheistische und wissenschaftlichen Charakter. Die Ablehnung bzw. Ausgrenzung der Religion sieht man besonders gut darin, dass er Theologie, Offenbarung usw. als „Gegenstände des Glaubens“ und nicht der Wissenschaft bezeichnet (2/392). In seiner Staatstheorie gesteht er dem Staat jedoch die Aufrechterhaltung von religiösen Auffassungen zu, um den Gehorsam im selbigen aufrecht zu erhalten.- Aber dazu später mehr.
Wie auch viele andere Philosophen teilt H. ebenfalls seine Philosophie ein. Für ihn gibt es die Naturphilosophie und die Staats- bzw. die Moralphilosophie (2/392), wobei die Zweite sich mit der menschlichen Gesellschaft befasst und somit den Nachweis für den natürlichen Ursprung des Staates gibt (In „Leviathan“ festgehalten.).
Thomas Hobbes stellte die Forderung auf die natürlichen und gesellschaftlichen Gesetze zu erforschen und diese für die Entstehung eines neuen Staates zu nutzen. Sein Ziel hierbei ist darin zu sehen, dass alle Übel der Gesellschaft beseitigt werden, um diese sittlich zu verbessern. Dieser Teil seiner Ansichten ist auch als Ausdruck des antifeudalen, progressiven bürgerlichen Selbstbewußtseins zu sehen (2/392). Wenn man die Antwort H.’s auf die Grundfrage der Philosophie betrachtet, sieht man, dass er diese materialistisch auf die sich nach mechanischen Gesetzen bewegende Körper - wozu er Mensch und Gesellschaft zählt - reduziert. Er selbst beschrieb es so: „Der Körper ist alles, was unabhängig von unserem Denken mit irgendeinem Teil des Raumes zusammenfällt oder sich mit ihm zusammen ausdehnt.“ (2/ 391). Seine Anthropologie und Staatstheorie findet sich hauptsächlich in seinem Werk „Leviathan“ wieder, was mit dazu beitrug, dass er „einer der meistgehasstesten politischen Denker“ war, und seine Schriften noch lange nach seinem Tod verbrannt wurden.(1/ 309).
(Anthropologie)
Im Folgenden werde ich nun näher auf dieses Werk eingehen, die Anthropologie von H. nennen, sowie seine Staatstheorie. Ich werde aber erst im Nachhinein, wenn alle Fakten bekannt sind meine Gedanken ausführlicher darlegen, kann aber nicht ausschließen mich zu einigen kurzen Bewertungen hinreißen zu lassen. Der Name „Leviathan“ steht ursprünglich für ein Seeungeheuer, das im AT als Symbol des Chaos steht.(3) Er ist aber sicherlich bevorzugt als Name der absolutistischen Staatsform, die Hobbes entwarf zu sehen, wobei „Leviathan“ die Bezeichnung des Staates oder der Person ist.
In den, für die Analyse wichtigen Kapitel 13-17, geht er besonders auf seine Anschauungen des Menschen ein und zieht daraus seine Schlußfolgerungen für den „idealen Staat“.
Die Anthropologie von Hobbes lässt sich gut anhand von fünf Thesen festmachen, die sich alle in einem recht kleinen Raum (von 128-130) wiederfinden. Die erste These, welche man auch als Hauptthese ansehen kann, sagt aus, dass die „Menschen (...)hinsichtlich der Körperkräfte untereinander gleichmäßig begabt“ sind (128/1-2).
Hier könnte man ganz schnell auf den Gedanken kommen, dass er schon von falschen Vorstellungen ausgeht, da die Menschen doch offensichtlich unterschiedlich sind. H. entkräftet jedoch sofort diese Kritik, indem er sehr genau seine Gedanke beschreibt und auf jegliche kleine Unstimmigkeit kurz eingeht- was er aber nur an wenigen Stellen im „Leviathan“ macht. Er spricht davon, dass ein Mensch, der körperlich vielleicht gegenüber einem anderen unterlegen bzw. ungleich begabt ist, diesem, eventuell, in List überlegen ist und ihn auch ohne Gewalt umbringen kann(128/6-9). Hier sehe ich einen Kritikpunkt, den man ihm vorwerfen kann. Es gibt nämlich auch Menschen, die kräftig und schlau sind (Beispiele aus unserer Zeit verlieren allerdings jegliche Wirkung, da H. nur über den Menschen im Naturzustand spricht.).
Um jedoch dieser Eventualität aus dem Weg zu gehen, behauptet er einfach, dass sich die Menschen in ihren Geistesfähigkeiten noch mehr ähneln (128/9-14), sie sich aber selbst zu sehr überschätzen und somit den Eindruck von sich selbst bekommen, dass sie klüger als andere seien (128/18).
Ein für mich nicht ganz nachvollziehbare Gedanke, der sich zu allem Übel auch noch durch das gesamte Werk zieht, ist jener, dass H. während seiner gesamten Ausführungen immer vom „Naturzustand“ des Menschen ausgeht. Er sagt selbst, dass der Mensch mit eigenständig angeeignetem Wissen nicht in dieses Schema hineinpasst (128/10-13).
Hier frage ich mich aber, wo gibt es noch Menschen, die im Naturzustand leben und einen Staat gründen wollen. Und wann begann dieser Zustand eigentlich? Auch würden nur die Babys und vielleicht noch die Kleinkinder hier mit zugehören, da sich weitestgehend noch nicht beeinflusst sind. Von denen ist sich aber keines von seinem Zustand der Gleichheit bewusst und ist schon gar nicht in der Lage einen Staat zu gründen. Im Übrigen ist es so, dass H. all seine Beispiele und Beweise aus seiner Zeit nehmen muss, da er nie den Naturzustand aktiv miterlebt hat. - Wie es dazu kommen konnte stelle ich später noch genauer dar.
Dies ist auch der Hauptkritikpunkt, den ich sehe, der sich auf Grund seiner Grundlagenstellung überall im Werk wiederfindet, und dieses somit aushebelt, was ich aber ebenfals noch zeigen werde.
Das Problem ist also der Ursprung, den H. in seiner „Vorstellung eines unveränderlichen, individualistischen, egoistischen, im Naturzustand lebenden Menschen sieht, dessen Folge die Begierde nach Macht und Besitz den „Krieg alle gegen alle“ mit sich bringt“ (2/392)
Auch die zweite These befasst sich folglich mit diesem Zustand. Sie handelt davon, dass wenn „zwei ein und dasselbe wünschen, dessen sie aber nicht gleichzeitig bekommen können, einer des anderen Feind wird“. Da dies aber mit dem Selbsterhaltungswunsch verbunden ist, den nach ihm jeder Mensch besitzt (129/9- 11), ist das Ziel der beiden Feinde entweder der Tod des anderen oder das Erreichen seiner Unterwürfigkeit.(128/31-32)
Zur Erklärung dieser These zieht H. außerdem noch sein zentrales Motiv, die Furcht, zu Hilfe. Sie ist angeblich der Grund dafür, dass sich die Menschen gegeneinander sichern müssen, was nur durch Zuvorkommen oder durch Bündnisse mit anderen funktioniert.(129/1-3). Er gesteht auch den Menschen im Naturzustand die Gewalt gegeneinander zu, da sie sich ja schützen sollen.(129/ 9-11). Dieser Zustand des ständigen Mißtrauens würde aber dazu führen, dass es ständig diesen Kampf jeder gegen jeden geben würde. H. berücksichtigt meiner Ansicht nach nicht in diesem Punkt, dass die Menschen früher in Horden bzw. Stämmen zusammengelebt haben. Sie haben sich zwar untereinander auch bekämpft, lebten aber im Stamm friedlich zusammen.Er übersieht aber diesen Punkt und sagt sich, dass deshalb eine höhere Macht nötig ist, die das Leben der Menschen leichter macht, da es sonst mit dem ständigen Mißtrauen zu beschwerlich wäre. Der Staat ist somit in seinen Augen nur gut für die Menschen, und ein Zustand (oder Person), den alle nur gut finden können.(129/ 12-19).
Die dritte These befasst sich mit den drei Hauptgründen für den Streit zwischen den Menschen. Dies sind „Mitbewerbung, Verteidigung und Ruhm“(129/20) oder mit anderen Worten: Wettstreben, Argwohn und Ruhmsucht. H. sieht die Mitbewerbung in dem Streben nach Macht und Gewinn, die Verteidigung bezieht er auf das oberste Ziel, die Sicherheit der Person und ein leichteres Leben. Der Ruhm, der seiner Meinung nach der letzte der Gründe für Auseinandersetzungen zwischen den Menschen ist, bezeichnet das Streben nach Ansehen, welches schon durch ein Lächeln zum falschen Zeitpunkt, als verletzt angesehen werden kann.(129/25-27) H. erklärt an dieser Stelle etwas genauer seine Begriffe, bleibt aber wie fast im gesamten Werk sehr rational in seinen Ausführungen.
Ich denke aber, dass er trotzdem die drei Hauptgründe für Streitigkeiten genannt hat, da er in seinen Ausführungen nicht auf jede kleine Ausnahme eingehen kann, wie z.B. Langeweile oder Hass. Diese sind sicherlich auch Gründe für Streit, aber Langeweile als Motiv ist bestimmt erst in der Zeit der Industrialisierung entstanden, weshalb dies sowieso nicht in seine Naturzustand - Theorie hineinpasst.
Die von ihm genannten Begriffe und der daraus resultierende „Krieg alle gegen alle“, den er immer vor Augen hatte, sind für ihn der Anlaß eine Macht auf den Plan zu fordern, die „in der Lage ist die Ordnung zu bewahren“(1/97/104). Diese soll die drei Steitgründe der Menschen unter Kontrolle halten und so ihr Leben friedlicher gestalten. Diese Macht fördert seiner Meinung nach durch ihre Kontrolle auch den Fortschritt der Menschen. Denn H. ist der Meinung, dass der Mensch im ständigen Kampf jeder gegen jeden seine gesamte körperliche Kraft und seinen Verstand zur Selbsterhaltung oder Machtergreifung nutzen muss. Somit dienen seine Erfindungen nur zur Erleichterung seiner Verteidigung und für keinen anderen Zweck, womit aber der Fortschritt auf der Strecke bleibt. Das ist einer der Punkte für ihn, weshalb ein Staat gebraucht wird.(129/28-43)
Die vierte These sagt aus, dass die Natur den Menschen ungesellig und zum Mörder des anderen gemacht hat.(129/44-46). H. fragt den Leser direkt, ob er die Menschen nicht durch sein Verhalten anklagt. Er bringt das Beispiel, dass der Mensch die Türen abschließt, bevor er sich schlafen legt(130/3-4). H. selbst aber nimmt die Menschen in Schutz, indem er sagt, dass ihre „Furcht vor einem gewaltsamen Tod“ und die daraus resultierenden Handlungen nicht als Sünde zu sehen sind, da keine Macht da ist, die sie beschützt. Um nun noch stärker die Notwendigkeit eines Staates, der wegen dem Naturzustand der Menschen gebraucht wird, zu unterstreichen, bringt er eins der wenigen geschichtlichen Faktenargumente. Er spielt auf Kain an, der seinen Bruder (wohl) aus Neid ermordete und stellt die rhetorische Frage ob er diese Tat auch gewagt hätte, wenn eine Macht bestünde, die soetwas ahndet.
In diesem Punkt denke ich, dass H. ein bißchen zu wenig beschrieben oder nachgedacht hat. Denn nach seiner Auffassung sind Menschen im Naturzustand immer potentielle Mörder des anderen. Man kann also annehmen, dass eine Mutter ihr Kind auf Grund von „Mitbewerbung, Verteidigung und Ruhm“ umbringen würde. Das halte ich aber im Allgemeinen für sehr unwahrscheinlich (Ausnahmen gibt es immer.), denn ein Kind wird, zumindest im Naturzustand (wenn ich das Leben von Regenwaldstämmenals diesen annehme), zur Art- bzw. Familienerhaltung gezeugt. Außerdem ist eine Mutter aufgrund des Gefühls „Liebe“ sehr eng mit ihm verbunden und wird es nicht umbringen.
Die letzte große These in der Anthropologie von H. schließt sich an seine Ausführungen darüber an, dass es im Naturzustand kein „Mein und Dein“ gibt. Was jemand vom anderen, wie auch immer, durch Gewalt oder List, erwirbt, gehört ihm. Um nun aus diesem kriegerischen Zustand zu entkommen, bleibt dem Menschen nur seine Vernunft und seine Leidenschaften (130/44-46), die er von Natur aus besitzen muss, da er ja bis jetzt seinen Verstand nur zur Selbsterhaltung genutzt hat. Die Leidenschaft, wie H. sie definiert, ist die „Furcht vor einem gewaltsamen Tod“, der Wunsch nach einem glücklichen Leben mit allem was dazugehört und die Hoffnung auf Erreichen dieses Ziels.(131/1-5) Somit findet sich das zentrale Motiv, die Furcht, auch in diesem Punkt wieder.
Ich denke, dass H. seine eigenen Erfahrungen und Gefühle miteinbezieht, was aber in meinen Augen nicht tragbar ist. H. ist ein Individuum, projiziert sich aber auf die ganze Menschengattung. Außerdem sehe ich die von ihm genannte Definition für mich als falsch an. Eine Leidenschaft ist für mich etwas, das ich mit einer solchen Hingebung mache, dass ich sogar bereit wäre dafür zu sterben. Sie ist für mich die absolute Freude, die ich immerwieder machen möchte, weshalb das meiner Meinung nach schon ein ganz entscheidender Kritikpunkt ist.
Die Vernunft, die der Mensch besitzt, führt ihn zu einigen Grundsätzen des Friedens, den „natürlichen Gesetzen“, wie H. sie bezeichnet.(131/5-8) Er versäumt es aber an dieser Stelle den Begriff „Vernunft“ näher zu erklären und man muss dies dann später ein wenig aus dem Zusammenhang erkennen. Ich stimme aber ansonsten mit seiner Auffassung der Vernunft überein. Sie bringt uns dazu möglichst nur das zu tun, was zu meinen aber auch zu Gunsten anderer ist.
Somit lässt sich diese Anthropologie meiner Ansicht nach in die Idee des homo sapiens einordnen, da in ihr die Vernunft den Menschen zur Welt- und Gotteserkenntnis („Leviathan“) befähigt.(5)
In der gesamten Beschreibung der Menschen lässt sich erkennen, dass H. einige Faktenargumente benutzt, z.B. bei Kain und Abel. Ansonsten sehe ich in seinen Ausführungen, trotz des Rationalismus im gesamten Werk seinen Wille jegliche Angriffspunkte (z.B. dass nicht alle Menschen gleich sind)zumndest am Anfang, mit zu berücksichtigen und diese zu erwähnen (siehe S.128). Dies muss auch der Grund dafür sein, dass er sehr viele Schachtelsätze verwendet, was allerdings nicht zum guten Verständnis seiner Anthropologie beiträgt.
(Staatstheorie)
H. geht nun von seiner Anthropologie aus und bezieht diese, in meinen Augen völlig richtig- da der Mensch einen Staat bildet und in ihm lebt- auf seine Staatstheorie. Diese ist schon ein wenig in 13. Kapitel durchgeklungen, H. nutzt aber die Kapitel 14 und 15 noch intensiver um seine „natürlichen Gesetze“ zu formulieren und sie zu erläutern. Desweiteren geht er näher auf den für ihn sehr wichtigen Vertragsbegriff ein, bei dem ich sehr gut sein spezielles Wissen im Recht erkennen konnte. Das macht H. dem Leser aber nicht schwer, da die gesamten Erklärungen diesbezüglich sehr umfassen und genau ausfallen (133/17-21).
Die Staatstheorie von H. hat als Grundlage das Problem, welches die Menschen, nach ihm, plagt. Der ständige mit allen Mitteln führbare „Krieg alle gegen alle“, den er schon im 13. Kapitel (130/16-17) zu Ausdruck brachte. Dieser muss, wie von allen Menschen gewünscht (131/1-5), beigelegt werden, wozu die Naturrechte (14. Kapitel), die die absolute Freiheit (d.h. ohne jegliche Vorschriften) „bestimmen“ durch die natürlichen Gesetze („niemand darf etwas tun, was er als schädlich für sich selbst anerkennt“) eingeschränkt werden müssen. Zur Überwindung dieses Problems wünscht er sich eine Person, eine Macht oder sogar einen „sterblichen Gott“, der die Menschen leitet.
Da er aber Jurist ist, kann er dies nicht so einfach fordern,das wäre seinem Wissen zugegen. Aus diesem Grund macht H. sehr genaue Beschreibungen, wie dieser Staat zustande kommen soll. Für ihn muss der Mensch, der alle Naturrechte besitzt, durch die Leidenschaft, besonders die Furcht, und die Vernunft (siehe oben) selbst darauf kommen dass er den „Frieden suchen und ihm folgen soll.“. Das ist für H. das erste natürliche Gesetz.(131/32). Wenn dann die Ruhe und Selbsterhaltung sicher sind, dann kann der Mensch sein Recht auf alles abgeben und soll mit der ihm zur Verfügung gestellten Freiheit zufrieden sein. So formuliert es das zweite Gesetz(131/35-38). Die beiden ersten Gesetze sind auch die wichtigsten, obwohl H. noch weitere 17 ableiten kann. Sie befassen sich mit gegenseitigem Nutzen, Vergebung, Rücksichtnahme, Gleichheit, Toleranz, Unparteilichkeit und noch weiteren Verhaltensweisen, die im großen und ganzen das Allgemeinwohl fördern und die Sicherheit der einzelnen fördern sollen.(140-143)
H. selbst bringt zum Ende hin sogar eine Zusammenfassung dieser Gedanken. Er schreibt: „Was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch.“ oder „Was du nicht willst, das dir geschehe, das tue anderen auch nicht.“ (143/10- 12) Die Bemühungen diese natürlichen Gesetze zu erfüllen reichen jedoch schon in den Augen von H. aus. Hierzu ist es aber unabdingbar, dass die Menschen diese Gesetze kennen, was für ihn zu seiner Sittenlehre gehört.
Die zusammengefassten Gesetze sind für mich persönlich gut nachvollziehbar und in dieser Hinsicht sehe ich ein, dass die Menschen die Vernunft brauchen, um diese Gesetze zu verstehen. Fraglich ist mir aber ob die Menschen von selbst darauf kommen würden. Aber sicherlich liegt der Grund darin, dass sich Thomas Hobbes als „Lehrmeister“ der Politik betrachtete (2/ 391) und er somit die Gesetze für die Menschen formuliert um ihnen zu helfen. Allerdings würde dies bedeuten, dass die Menschen zu seiner Zeit im Naturzustand leben (was eventuell unter Rücksichtnahme meiner späteren Ausführungen nachvollziehbar wäre).
Im späteren Teil von Leviathan (S.146) listet H. sogar nochmal auf, warum die Menschen nicht friedlich wie die Tiere (z.B. Ameisen) zusammenleben können.
Daraus zieht H. nun seine Schlüsse und sagt, dass die Menschen Verträge brauchen um in Eintracht zu leben. Tiere hingegen brauchen nur die Natur.
Wenn die Menschen nun, seiner Ansicht nach, diese natürlichen Gesetze tatsächlich anerkannt haben, sollen bzw. kommen sie zu dem alles entscheidenden Schluss, dass sie all ihre Macht durch Verträge auf einen Menschen, bzw. auf eine Ansammlung von Menschen übertragen müssen, um glücklich zu werden.
Der Vertragsgedanke ist hierbei für H. entscheidend. Er geht sehr ausführlich auf diesen ein und definiert ihn als „wechselseitige Übertragung der Rechte“(133/43-44). Sogar Verträge, die zwischen Gott und den Menschen geschlossen werden könnten berücksichtigt er (136). Diese müssen aber mit Mittelsmännern geschlossen werden und dienen am Ende dazu, dass sich der Staat auf die „Furcht der Menschen vor einem unsichtbaren Wesen“ stützen kann, wenn sie sich nicht mehr vor der vom Staat verkörperten Macht fürchten(136/27-28).
Ein Problem sehe ich jedoch bei diesen genannten Verträgen. Was ist mit Kindern, die in diesem Staat hinein geboren werden. Sie selbst sind Individuen. Müssten sie nun auch Verträge abschließen und wann sind sie alt genug für diese Entscheidung? Aber was noch entscheidender ist, was macht der Staat mit den Kindern, um sie in den Naturzustand zu versetzen, so dass sie aus ihrer Leidenschaft und Vernunft heraus dem Staat ihre Rechte übergeben? All diese Fragen bleiben unbeantwortet, was die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft des Werkes untergräbt.
Dies ist aber auch ein entscheidender Punkt, in dem sich H. widerspricht. Er behauptet in seiner Anthropologie, dass der Mensch nur seine Leidenschaft und seine Vernunft braucht, um dem Naturzustand zu entkommen. Jetzt sagt er aber, dass er dazu Verträge und vielleicht sogar ein unsichtbares Wesen, um ihre Situation zu verbessern.
Somit kann ich schon ab diesem Gedanken seine Anthropologie nicht mehr anerkennen, weil er seine Ansichten nur durch Widersprüche beschreiben kann.
Wenn nun alle Menschen ihre Rechte übertragen haben, dann erst nennt H. diese Person „Staat“. Er selbst behauptete, dass es dann zur „Erzeugung jenes großen Leviathan oder besser (...) jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken.“(4/139) kommt. Seine genaue Definition lautet deshalb wie folgt:
„Staat ist eine Person, deren Handlungen eine große Menge Menschenkraft der gegenseitigen Verträge eines jedenmit einem jeden als ihre als ihre eigenen ansehen, auf daß diese nach ihrem Gutdünken die Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen Verteidigung anwende“ (147/6-9)
Diese Person hat dann die Rechte aller Menschen des Staates auf sich vereint und der Einzelne unterwirft sich dem allgemeinen Wille, also dem Machtinhaber. Der kann z.B. ein Heer bilden, Staatsbeamte ernennen und Geld eintreiben. Dafür muss er aber den im Vertrag gebundenen Menschen die Freiheit und Verteidigung ihres Lebens gewährleisten sie wiederum werden durch die Furcht (Leidenschaften) vor Strafen (der gewaltsame Tod ist für Menschen das schlimmste) dazu getrieben die natürlichen Gesetze und Verträge zu akzeptieren. Da jedoch bloße Worte allein keinen Krieg verhindern können mehr muss es mehr anschauliche Macht (Waffen) im Staat geben, um die Sicherheit zu gewährleisten und Feinde abzuschrecken. Um diese Staatsform dem Leser besser verständlich zu machen, geht H. näher auf schon bestehende Staatsformen ein. Er drückt z.B. seine Ablehnung gegenüber der Demokratie aus und behauptet, dass in ihr zu viele Meinungen berücksichtigt werden müssen, was sie nach außen und innen sehr leicht angreifbar macht.(145/18-20) Aber auch seine eigenen schlechten Erfahrungen mit der Demokratie spielen hier eine Rolle. Jedoch ist H. von der Person und seinen Anschauungen her sehr stark von seinen Leidenschaften geleitet. Er sagte sogar, dass sein Zwilling die Furcht (Leidenschaft) sei.
Wie man schon aus seinen ganzen Andeutungen erkennen kann, ist die bevorzugte Staatsform von H., der Absolutismus - eine Form der Diktatur.
Beweise für diese Annahme gibt es viele. Er sprich ständig von „einer“ Person, die alle Macht auf sich vereint. Sie beherrscht alle Menschen im Staat, welche sich unterordnen müssen (s.o.). Desweiteren nennt er die Person einen „unsterblichen Gott“ und in der Geschichte wurden nunmal vorrangig die Könige vergöttert. Diese Obermacht muss, um wirksam zu sein dauerhaft wirken, was nun einmal nur in einer Monarchie funktioniert. Hier wird die Macht bis zum Tod des Königs nur von diesem genutzt und wird dann an einen seiner Kinder weitergegeben. H. spricht aber auch von „Untertanen und Bürger“ (147/ 11), was wieder einen Rückschluss auf den Absolutismus zulässt, weil die Menschen in einem absolutistischen Staat nun einmal Untertanen genannt wurden.
Aber auch in einer Kurzcharakteristika von H. (4/194) findet sich wieder, dass er die „Rechtfertigung des Absolutismus als Ordnungsmacht (betrieb), die den Menschen vor dem Menschen schützte“.
Der Staat ist somit ganz einfach aufgebaut. Die Untertanen und Bürger übergeben aus eigener Vernunft und Erkenntnis all ihre Rechte durch Verträge an eine Person und werden im Gegenzug von ihr beschützt, was ihnen Freiheit und ein leichteres Leben bringt.
(Bewertung)
Das Problem hierbei ist aber, dass er nicht sagt ob es überhaupt diese Person geben kann, die die übergebene Macht der Menschen nicht gegen sie selbst ausnutzt. Die Menschen im Staat können ihrerseits nicht einmal widersprechen, wenn sich die zwar vertraglich gebundene Person als „falsch“ entpuppt. Diese hat die Macht und soll die Sicherheit der Menschen gewährleisten, welche aber in dieser Situation nicht mehr für alle gegeben ist,weshalb die Person den Aufstand mit Gewalt niederwerfen muss. Solche Vorstellungen- wie der letzte Gedanke- muss auch H. gehabt haben, nur mit dem Unterschied, dass er diesen gut fand. Er lebte während den Wirren der Bürgerkriege in England und behauptete von sich, sich vor einem gewaltsamen Tod zu fürchten. Dies ist ein ganz entscheidender Grund für mich zu behaupten, dass er den „Leviathan“ als Beschützer gesehen und gesucht hat. H. flüchtete zweimal aus einem Land wegen drohender Strafen. Er war Lehrer bei Adligen und unterstützte den Sohn Karl I.. Die Bürgerkriege in England zerstörten jedoch seine heile Stellung und er musste befürchten, dass er, sowie die Bourgeoisie von der Masse (die durch rohe Gewalt an die Macht kommen wollten- folglich noch im Naturzustand leben müssen) überrannt wird. Das ist der Grund dafür, dass ich denke, dass die Triebkraft oder der Grund für das Entwerfen des „Leviathan“ ganz einfach die Furcht war. die er vor den Aufständischen hatte.
Seine Erfahrungen mit ihnen und ihrer Vorgehensweise: Gewalt, List und Besitzergreifung bzw. Machtübernahme finden sich ganz klar in seiner Anthropologie wieder. Bei dieser wollte ich zuerst ganz stark kritisieren, dass H. einfach die Naturrechte nennt, aber nicht sagt, woher er diese hat, obwohl er nie im Naturzustand gelebt hat. Wenn ich aber seine Furcht (sein Zwilling) vor dem Bürgerkrieg mit den Hauptthesen in Verbindung bringe, fällt mir auf, dass die Verhaltensweise der Aufständischen mit der Charakterisierung des ursprünglichen Menschen sehr viele Gemeinsamkeiten besitzt. H. muss durch seine Furcht so geblendet worden sein, dass er sich in den Naturzustand zurückversetzt sah, wodurch er annahm, wie dieser wohl gewesen sein muss.(Herausgabe „Leviathan“ 1651, im Exil beendet)
> Was aber nur eine Vermutung von mir ist!
Somit sind aber die gesamten Grundlagen seiner Anthropologie, in meinen Augen nutzlos. Er sieht den Menschen nur als ein aufgebrachtes Wesen. Was aber der Grund dafür war, interessierte ihn nicht. Die andere Seite, den sozialen Menschen unterschlägt er im Naturzustand aber gänzlich. Dieser, da er ja gebildet und „listig“, wie er, ist, kommt nur durch Vernunft und Verträge zustande und lebt in Staat friedlich. Genau betrachtet wie H. selbst. Ihm ging es gut, er stammte aus einer gehobenen Schicht und hatte keine Probleme mit dem Adel, wie z.B. die Bauern. Die Demokratie aber war nichts für ihn, da sie offensichtlich scheiterte und zu viele Meinungen- vor allem auch von den Menschen aus dem Naturzustand - kommen würden.
Ich habe zwar geschrieben, dass er sich als „Lehrmeister“ der Politik sah und im allgemeinen sollte man auch annehmen, dass eine solche Schrift die anderen überzeugen sollte. Dies war aber in meinen Augen nur teilweise seine Absicht. In der Politik, die er beeinflussen wollte, saßen fast ausschließlich gebildete Leute und eher nicht das einfache Volk. Man sollte aber vermuten, dass er gerade dieses davon überzeugen sollte, sich einem „sterblichen Gott“ zu unterwerfen, auch um seiner Sicherheit willen. Die gesamte Schrift und Sprache ist aber so hochgestochen (s.o.), dass diese nichts verstehen würden. Auch die Tatsache, dass er Unmengen von Erklärungen für juristische Begriffe verwendet (s.o.) hilft nicht dem Verständnis. Für mich zeugt dies eher von einer Art Ablenkungsmanöver von seiner Angst, indem er mit seinemWissen über Verträge den Leser vom eigentlichen Sinn einer solchen Schrift (Darlegung und Beweis seiner Theorien) wegführt. Der Teil, wo er die Art der Vertragsschlüsse vorstellt, ist meiner Meinung nach unwichtiges Beiwerk in einer Vorstellung der Staatstheorie und Anthropologie. Er könnte lieber den Menschen mit seinen Eigenschaften näher erklären. Da H. sich darin aber wohl nicht so recht auskennt spricht er lieber über Gebiete von denen er mehr weiß.
H. geht auch in keiner Weise auf die Anfänge der Menschen ein, dass sie in Stämmen lebten und nur als Gruppen überleben konnten. Dass Menschen Liebe empfinden können- für mich eine ganz wichtige Leidenschaft, die er u.a. vergessen hat zu nennen- und dadurch nicht zu den Mördern werden, wie er sie beschrieb. Wenn ich mir somit seine Anthropologie nüchtern betrachtet ansehe, erhalte ich den Eindruck, dass der Mensch mit einem Mal gelebt hat und von Anfang an so, wie H. ihn beschreibt, war. Kein einziges Wort zu einer möglichen Entwicklung, die sie durchgemacht hätten können. Die Menschengeschichte lässt er fast völlig außen vor. Sogar in 2/393 wird zugegeben, dass H., wie der „vormarxsche Materialismus“ u.a. die Mängel besitzt, die „Gesellschaft (...) unhistorisch (zu) betrachte(en)“. Da die Menschen sich aber doch weiterentwickelt haben- sie haben ihren Verstand genutzt um sich ihre Arbeitsbedingungen zu erleichtern und nicht nur zur Selbsterhaltung- hat sich auch ihr Verhalten geändert. Die Anthropologie von H. ist somit schon zu seiner Zeit nicht mehr aktuell. Ich bin dieser Meinung, da er keinen ursprünglichen Zustand der Menschen beschrieben hat, sondern einen, der irgendwie mittendrin liegt (>Aufständische zu H.’s Zeit).
Hätte H. nun aber nachvollziehbare und noch erkennbare Merkmale genannt, würde seine Staatsform auch nicht auf so wackligem Beinen stehen.
Da H. , wie ich schon gezeigt habe von einer falschen bzw. beeinflussten Anthropologie ausgeht und sich seine Staatstheorie darauf aufbaut, kann sie eigentlich nur falsch sein, ich finde aber, dass sie trotzdem, wenn auch nur einige, recht interessante Gedanken beinhaltet.
Die Idee, dass der Mensch von einer höhergestellten Macht oder Person geleitet wird mag vielleicht durch die Zeit des Nationalsozialismus verpönt sein. Ich denke aber, dass die Menschen eine Leitperson, wie im Rudel (bei den Tieren) oder in den Familien brauchen. Diese muss ihnen den Weg weisen und ihnen genaue Aufgaben zuteilen, mit denen jeder für jeden arbeiten.( Genauere Ausführungen würden den Rahmen sprengen.)
Allerdings widerspricht mir bei dieser Staatsform (Diktatur), dass ich nicht weiß, ob es diesen Menschen überhaupt gibt, der seine Untergebenen gut behandelt- d.h. z.B. nicht irgendwelche imperialistischen Vorhaben mit ihnen durchsetzen will- oder ob er überhaupt gefunden werden kann und wenn, wird er durch die große Macht nicht übermütig?
Diese Unsicherheit reicht mir schon aus, um dann doch jegliche Form der Diktatur, in der Realität, abzulehnen, weil ich den Menschen im allgemeinen für machtbesessen halte und ihn in dieser Hinsicht so einschätze, dass er Seine Stellung ausnutzen wird. ( siehe CDU Spendenaffäre).
Der Fakt, dass auch H. eine solche Staatsform, allerdings Monarchie, bevorzugt und er einen „sterblichen Gott“ als Staat haben will, schreckt mich ein wenig vor seiner Bereitschaft zur Untergebenheit ab. Was ist, wenn der „Leviathan“ nur mit Gewalt herrscht. Dann hat der Mensch auch im Staat ständig „Furcht vor einem gewaltsamen Tod“ (131/2-3), obwohl er diese jedoch durch den Staat beenden sollte. Außerdem ist auch ein König nur ein Mensch und kein „Gott“. auch er kann sich irren oder beeinflusst werden. Ihn von seiner Macht abgelösen ist dann jedoch nicht mehr so einfach.
H. seinerseits hielt die Staatsform der Monarchie für die beste, da sie die angeblich die beste Garantie für Machtvollkommenheit aufweist und sie eine sichere bürgerliche Lebensweise ermöglicht. Der interessanteste Punkt jedoch, ist, dass sie „den Bürgerkrieg beenden könne“ (2/393). Hierin sehe ich meine Vermutung, dass H. den „Leviathan“ nur aus Furcht geschrieben hat, wieder einmal begründet. Er will die Gefahr beendet sehen und die Monarchie ist für ihn auch aus dem Grund die beste Staatsform, da ihm die andere Form der Diktatur, wie wir sie kennen, noch nicht bekannt war.
Abschließend kann ich behaupten, dass die Philosophie von H. sehr viele Fragen und Widersprüche hinterlässt. Er wollte zwar die „Erklärung von realen Sachverhalten mit Hilfe materialistischer Prinzipien systematisch erfassen, diese verallgemeinern und somit anwendbar machen.“ -sie wurde als „Meilenstein im Entstehungsprozeß der Philosophie als Wissenschaft“ bezeichnet(2/394). Jedoch hilft dieses Vorhaben in meinen Augen nicht im geringsten mich davon zu überzeugen, dass H. doch genau wusste, wovon er schrieb. Sonst würden sich in seiner Argumentation nicht derartig gravierende Widersprüche finden. Auch denke ich, dass sein Zwilling, die Furcht (3/309) ihn schlecht beraten hat und sein Werk höchstwahrscheinlich unter einem zu großen Druck, der durch den Bürgerkrieg auf ihn lastete, entstanden ist. Auch der Wunsch von H. einer Gesellschaft mit großem Gewaltpotential, wie es zu seiner Zeit in England vorhanden war, eine vernünftig begründete Ordnung entgegenzusetzen ist sicherlich nicht zu verdammen. Lediglich die gedachte Umsetzung dieses Wunsches ist nicht argumentativ richtig formuliert und auch nicht richtig durchdacht.
Durch den fatalen Fehler in seiner Anthropologie, die von einem nicht nachvollziehbaren ausführlich beschriebenen Naturzustand ausgeht, ist auch seine Staatstheorie und dessen gesamte Grundlage fehlerhaft und für mich nicht auf die Realität übertragbar.
III. Quellenverzeichnis und Zeichenerklärung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungen:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Anthropologie und Staatstheorie von Thomas Hobbes, basierend auf seinem Werk "Leviathan". Es untersucht Hobbes' Vorstellungen vom Naturzustand des Menschen, die Notwendigkeit eines Staates und die Charakteristika dieses Staates.
Wer war Thomas Hobbes und in welchem Kontext entstand seine Philosophie?
Thomas Hobbes (1588-1679) war ein englischer Philosoph des Materialismus und der Aufklärung. Seine Philosophie entwickelte sich im Kontext der sozialen und politischen Unruhen in England, einschließlich der Revolution. Er reiste durch Frankreich und Italien und wurde stark von Bacon beeinflusst. Seine antifeudalistische Haltung und der Glaube an den Herrschaftsanspruch des Bürgertums nahmen immer mehr zu.
Was sind die Grundlagen der Anthropologie von Thomas Hobbes?
Hobbes' Anthropologie basiert auf der Annahme, dass Menschen im Naturzustand gleich sind und von Furcht, Selbsterhaltungstrieb und Vernunft angetrieben werden. Er argumentiert, dass Menschen egoistisch sind und im "Krieg aller gegen alle" leben, da jeder nach Macht und Besitz strebt.
Welche Schlussfolgerungen zieht Hobbes aus seiner Anthropologie bezüglich der natürlichen Gesetze und der Notwendigkeit des Staates?
Hobbes folgert, dass die natürlichen Gesetze, die aus der Vernunft resultieren, den Menschen dazu bringen, Frieden zu suchen und ihre Rechte an einen Staat abzugeben. Der Staat ist notwendig, um Ordnung zu gewährleisten, die Menschen vor Gewalt zu schützen und Fortschritt zu ermöglichen.
Wie charakterisiert Hobbes den Staat und welche Staatsform bevorzugt er?
Hobbes charakterisiert den Staat als eine Person oder Macht, der die Rechte aller Menschen übertragen wurden, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Er bevorzugt den Absolutismus bzw. die Monarchie, da er glaubt, dass diese Staatsform die beste Garantie für Machtvollkommenheit bietet und Bürgerkriege beenden kann. Er lehnt die Demokratie ab, da er diese als leicht angreifbar betrachtet.
Was sind die natürlichen Gesetze nach Hobbes?
Das erste natürliche Gesetz ist, dass der Mensch den Frieden suchen und ihm folgen soll. Das zweite Gesetz besagt, dass der Mensch sein Recht auf alles abgeben und mit der ihm zur Verfügung gestellten Freiheit zufrieden sein soll. Weitere Gesetze befassen sich mit gegenseitigem Nutzen, Vergebung, Rücksichtnahme, Gleichheit, Toleranz und Unparteilichkeit.
Welche Rolle spielt der Vertragsgedanke in Hobbes' Staatstheorie?
Der Vertragsgedanke ist zentral für Hobbes' Staatstheorie. Er definiert den Vertrag als "wechselseitige Übertragung der Rechte". Die Menschen übertragen ihre Rechte auf den Staat, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten.
Welche Kritik wird an Hobbes' Anthropologie und Staatstheorie geübt?
Kritiker bemängeln, dass Hobbes' Anthropologie von einem unrealistischen Naturzustand ausgeht und die sozialen Aspekte des Menschen vernachlässigt. Außerdem wird kritisiert, dass Hobbes' Präferenz für den Absolutismus zu Unterdrückung und Machtmissbrauch führen kann.
Welche Rolle spielt die Furcht in Hobbes' Philosophie?
Die Furcht ist ein zentrales Motiv in Hobbes' Philosophie. Er betrachtet die "Furcht vor einem gewaltsamen Tod" als einen der Hauptgründe für die Notwendigkeit des Staates, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
Welche Bedeutung hat das Werk "Leviathan" von Thomas Hobbes?
"Leviathan" ist Hobbes' bekanntestes Werk und legt seine Anthropologie und Staatstheorie dar. Es argumentiert für die Notwendigkeit eines starken Staates, um den "Krieg aller gegen alle" zu verhindern. Hobbes will die Gefahr beendet sehen und die Monarchie ist für ihn aus dem Grund die beste Staatsform, da ihm die andere Form der Diktatur, wie wir sie kennen, noch nicht bekannt war.
- Quote paper
- Torsten Köhler (Author), 2000, Arbeit über Thomas Hobbes "Leviathan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105607