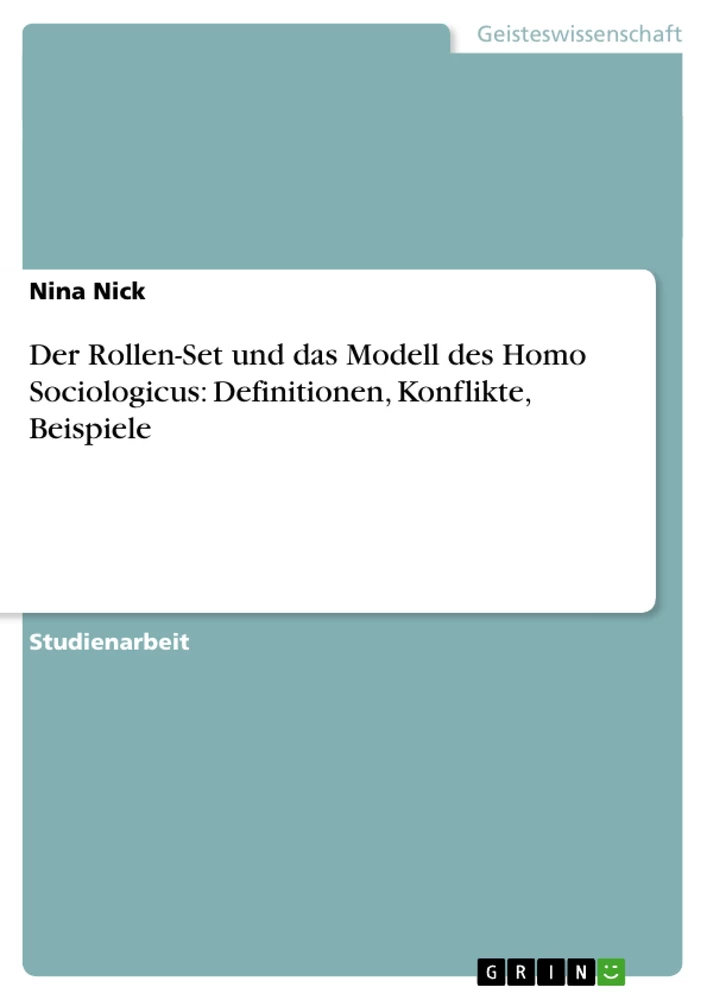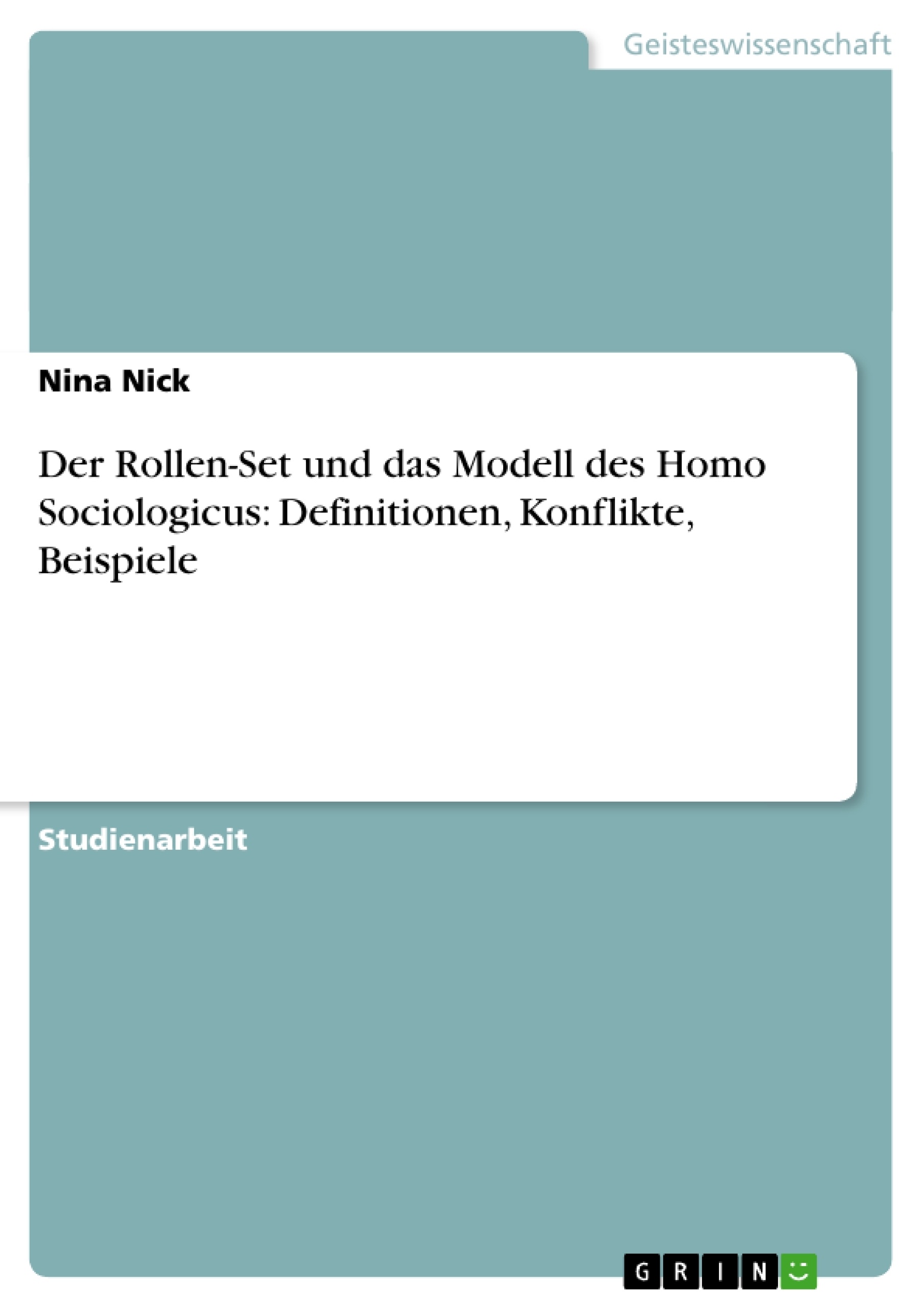Stellen Sie sich vor, Sie sind gefangen in einem Netz aus Erwartungen, ein Jongleur sozialer Rollen, der verzweifelt versucht, die Balance zu wahren. Dieses Buch enthüllt die verborgenen Mechanismen unserer sozialen Welt, indem es Robert K. Mertons bahnbrechende Analyse des "Rollen-Sets" seziert. Tauchen Sie ein in die komplexen Beziehungen, die uns als Individuen definieren, von den subtilen Machtdynamiken bis hin zu den überraschenden Strategien, die wir entwickeln, um Konflikte zu entschärfen. Entdecken Sie, wie soziale Strukturen unser Handeln prägen und wie wir uns gleichzeitig anpassen und widersetzen. Anhand von Beispielen wie dem einer Talkshowmoderatorin, die zwischen den Erwartungen ihrer Redaktion, ihrer Gäste und des Publikums navigiert, wird die Theorie lebendig und greifbar. Untersuchen Sie die relative Bedeutung verschiedener Positionen, die Abschirmung des Rollenhandelns, die Übersehbarkeit widersprüchlicher Forderungen und die gegenseitige soziale Unterstützung – allesamt Strategien zur Konfliktbewältigung. Das Buch ergründet auch das Modell des Homo Sociologicus, seine Wurzeln bei Durkheim und Parsons, und die Weiterentwicklung durch Schimank, der die kreative Gestaltung von Rollen betont ("role-making"). Es analysiert Intra-Rollenkonflikte, Inter-Rollenkonflikte und die Bedeutung von Bezugsgruppen. Sind wir wirklich Marionetten unserer Rollen, oder haben wir die Freiheit, diese aktiv zu gestalten? Diese tiefgreifende Analyse bietet nicht nur ein besseres Verständnis der Soziologie, sondern auch praktische Einsichten für den Alltag, indem sie uns hilft, die Komplexität sozialer Interaktionen zu entschlüsseln und unsere eigene Rolle in der Gesellschaft bewusster zu gestalten. Erforschen Sie die essentielle Frage, inwieweit soziale Normen unser Verhalten bestimmen und welche Spielräume uns zur individuellen Entfaltung bleiben. Ein Muss für Studierende der Soziologie, Sozialarbeiter und alle, die die Dynamik menschlicher Beziehungen besser verstehen wollen. Schlüsselwörter: Soziologie, Rollentheorie, Rollen-Set, Homo Sociologicus, soziale Strukturen, soziale Rollen, Konfliktbewältigung, Robert K. Merton, Ralf Dahrendorf, Uwe Schimank, soziale Interaktion, soziale Normen, Bezugsgruppen, Status, Macht, Rollenkonflikte, Rollenerwartungen, Rollengestaltung, "Role Taking", "Role Making", soziale Mechanismen, Verhaltenserwartungen.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Definition zentraler Begriffe: Position, Status, Rolle, Rollen-Set
3 Die Problematik innerhalb des Rollen-Set
4 Die sozialen Mechanismen im Rollen-Set
4.1 Relative Bedeutsamkeit verschiedener Positionen
4.2 Machtunterschiede zwischen den Personen in einem Rollen-Set
4.3 Abschirmung des Rollen-Handelns gegenüber der Beobachtung durch Mitglieder des Rollen-Set
4.4 Übersehbarkeit widersprüchlicher Forderungen seitens der Mitglieder eines Rollen-Set
4.5 Gegenseitige soziale Unterstützung zwischen den Statusinhabern
4.6 Beschränkung des Rollen-Set
5 Verbleibende Konflikte im Rollen-Set
6 Das Model des Homo Sociologicus
7 Schlussbetrachtung
8 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Soziale Strukturen in Gesellschaften prägen Motive, Gelegenheiten und Ausdrucksformen des sozialen Handelns. Durch Normen und Verhaltenserwartungen reguliert, ist jedes Individuum Träger mehrere Positionen und Rollen, an die spezielle Erwartungen von der Gesellschaft geknüpft sind.
Die Kombination aus den einzelnen Rollen, auch Rollen-Set genannt, sowie die Mechanismen, die Konflikte innerhalb des Rollen-Sets abschwächen, sind das zentrale Thema in Robert K. Mertons Aufsatz „Der Rollen-Set: Probleme der soziologischen Theorie“ (Merton 1967). Dabei lehnt er sich stark an die von Ralph Linton verfasste Rollentheorie an.
Merton will dabei keine allgemeine, umfassende Theorie, sondern eine Ansicht „über einen begrenzten Bereich sozialer Erscheinungen“ (Merton 1973, S. 320) entwickeln. Er bezeichnet diese als Theorie mittlerer Reichweite. Sie bietet für ihn ausreichende Erklärung für seine Beschreibung des Rollen-Set.
Merton und Lintons Rollentheorie ist eng mit der strukturell- funktionalen Theorie von Ralf Dahrendorf, dem Model des Homo Sociologicus, verankert. Hier sind die beiden oben genannten Begriffe Position und Rolle, auf die im Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen wird , zentral für den Homo Sociologicus. Ihnen widmet Dahrendorf alle Aufmerksamkeit der soziologischen Analyse der Gesellschaft. Im zweiten Teil meiner Hausarbeit werde ich mich mit dieser Betrachtung, sowie Ausführungen von Uwe Schimank zu diesem Thema auseinandersetzen.
Zunächst möchte ich aber auf den Rollen-Set und seine Problematik eingehen und die dazu entwickelten sozialen Mechanismen am Beispiel einer Talkshowmoderatorin diskutieren. Die Arbeit wird mit einem Vergleich der verschiedenen wissenschaftlichen Auffassungen schließen.
2 Definition zentraler Begriffe: Position, Status, Rolle, Rollen-Set
Die meisten soziologischen Wissenschaftler stimmen in der Aussage überein, „dass der soziale Status und die soziale Rolle wesentliche Bausteine der sozialen Struktur“ (Merton 1973, S. 321) sind. Dies ist auch die Vorraussetzung für Mertons Analyse des Rollen-Set.
Bei der Definition der Termini Rolle und Status schließt sich Merton weitgehend der Auffassung Ralph Lintons an. Dieser beschreibt den sozialen Status als eine Stellung einer Person innerhalb eines sozialen System. Rollen werden im Hinblick auf Rechte und Pflichten im Verhältnis zu anderen Individuen einer Gesellschaft eingenommen. Sie charakterisieren Erwartungen, welche sich an den vom Status vorgegebenen Verhalten orientieren. Die Begriffe Status und Position verwendet er gleichbedeutend.
Linton geht davon aus, dass ein Mensch mehrere Statuspositionen innehat. Diese Kombination bezeichnet er als Status-Set, wobei nach Linton jeder Status nur eine spezifische Rolle besitzt.
Im Gegensatz zu Linton hebt Merton hervor, dass jede soziale Position nicht mit einer einzelnen, sondern mit einer Reihe von sozialen Rollen verbunden ist. Die daraus entstehende „Kombination von Rollen-Beziehungen, in die eine Person aufgrund ihrer Inhaberschaft eines bestimmten Status verwickelt ist“ (Merton 1973, S.322) bezeichnet er als Rollen-Set.
Merton verdeutlicht weiterhin die Differenz zwischen der RollenAusstattung und dem Rollen-Set. Dieser besteht darin, dass mit dem Begriff der Rollen-Ausstattung sämtliche Rollen, die mit allen verschiedenen Positionen zusammenhängen, gemeint sind. Im Gegensatz dazu bezeichnet der Rollen-Set aber nur die Rollen, die zu einem einzigen Status gehören.
3 Die Problematik innerhalb des Rollen-Set
Merton teilt die Auffassung Lintons, jede Person habe mehrere Statuspositionen inne. Demnach muss sie auch dieselbe Anzahl verschiedener Rollen-Sets besitzen. Diese miteinander verbundenen Rollen setzen den Positionsinhaber mit vielen Mitgliedern des jeweiligen Rollen-Sets oder auch anderer in Beziehung. Dieser Zustand birgt Konflikte, da ebenso die Mitglieder untereinander in Beziehung stehen, und ihrerseits unterschiedliche Forderungen und verschiedene oder sogar gegensätzliche Verhaltenserwartungen an den jeweiligen Statusinhaber haben können. Für diesen wird es schwierig alle Ansprüche zu koordinieren.
Es handelt sich dabei um ein Problem der sozialen Struktur, da „die sozialen Arrangements, durch die die Erwartungen derer in einem Rollen-Set integriert werden“ ( Merton1973, S. 323) den grundlegenden Rollenkonflikt eines Statusinhabers auslösen.
Zur Verdeutlichung dieses Tatbestandes dient ein Beispiel:
Eine Talkshowmoderatorin beim Fernsehen hat einen bestimmten sozialen Status inne, der einen dazugehörigen Rollen-Set mit sich bringt. Dieser Rollen-Set konfrontiert die Moderatorin mit den Verhaltenerwartungen ihrer Redaktion, ihrer Gäste, ihres Publikums Ihrer Zuschauer vor dem Fernsehen ,etc. Daneben ist sie ebenso Trägerin anderer Positionen. Beispielsweise hat sie die der Mutter, der Ehefrau, eines Mitglieds des Sportbundes und des Handballvereins ,etc., inne, welche wieder jede Position für sich ein eigenes Rollen-Set mit sich bringt.
Dass sich unterschiedliche Ansprüche seitens der Teilnehmer eines Rollen-Set an den Rollenträger ergeben, wird damit deutlich. Dadurch können Störungen im Rollen-Set hervorgerufen werden.
Die Redaktion und das Publikum möchten vielleicht, dass die Moderatorin möglichst viel Spannung und Aufregung während der Sendung erzeugt, wohingegen den Talkgästen nur an einer friedlichen und ruhigen Klärung ihrer Situation gelegen ist. Außerdem könnte es sein, dass die Kinder von ihrer Mutter ständig umsorgt sein möchten, dies wegen ihres Berufes für sie aber nicht machbar ist.
Die wesentliche Ursache dieses Konfliktes, so Merton, ist die Möglichkeit, dass die Teilnehmer in einem Rollen-Set „sich in ihren sozialen Positionen von der des betreffenden Statusinhabers“ (Merton 1973, S.324) differenzieren. Umso verschiedener die Einstellungen und moralischen Wertvorstellungen der Mitglieder gegenüber denen des Positionsinhaber sind, desto unterschiedlicher sind auch ihre Anforderungen an ihn.
Es zeigt sich, dass Probleme zwischen den Mitgliedern im, als auch zwischen den einzelnen Rollen-Sets entstehen müssen.
4 Die sozialen Mechanismen im Rollen-Set
Es existieren soziale Mechanismen, die außerhalb der Person des Statusinhabers liegen und die helfen, Konfliktsituationen im RollenSet abzuschwächen. Dies muss in der sozialen Struktur gegeben sein, ansonsten hat der Statusinhaber keine Möglichkeit den an ihn gestellten Anforderungen gerecht zu werden.
Im folgenden werden die sechs sozialen Mechanismen, welche eine stärkere Verschränkung in Rollen-Set herbeiführen, erläutert.
Anhand Mertons Theorie wird zudem beschrieben, inwiefern diese Prozesse einen notwendigen Grad an sozialer Ordnung herstellen, eine Integration der Rollen in den Rollen-Set unterstützen und strukturell vorgegebenen Rollen-Sets Stabilität verleihen.
4.1 Relative Bedeutsamkeit verschiedener Positionen
Durch die soziale Differenzierung innerhalb der Sozialstruktur werden verschiedenen Positionen in einer Gesellschaft höhere Stellungen zugewiesen als anderen. D.h. dass nicht allen Mitglieder eines Rollen-Set die Anforderungen an das Verhalten des Statusinhabers gleich wichtig sind. Durch den unterschiedlichen Beziehungsgrad wird das Zusammenstoßen verschiedener Erwartungen der Teilnehmer verringert.
In dem Beispiel könnte der Sachverhalt der relativen Bedeutsamkeit folgendermaßen aussehen: Den Gästen und dem Publikum ist es mitunter nicht wichtig, ob die Moderatorin ihren Geschmack an Kleidung trifft. Im Gegensatz zur Redaktion, die eventuell Werbeeinnahmen in Form eines Product- Placement1 dafür erhält.
Es würde sich ein wesentlich gravierender Konflikt ergeben, stellten alle Rollen-Set Mitglieder die gleichen Ansprüche an den Statusinhaber.
Die Probleme werden durch den ersten Mechanismus zwar nicht ganz ausgeschaltet, es ergibt sich aber eine bedeutende Erleichterung für den Statusinhaber.
4.2 Machtunterschiede zwischen den Personen in einem Rollen- Set
Dieser Mechanismus, der eine Verschränkung in Rollen-Set bewirkt, „liegt in der Verteilung von Macht und Autorität“ (Merton, 1973, S. 325).
In Anlehnung an Max Weber versteht auch Merton Macht „als jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber 1972, S.28). „Die kulturell legitimierte Macht“ (Merton 1973, S. 326) bezeichnet bei Merton die Autorität.
Die Angehörigen eines Rollen-Set haben aufgrund sozialer Schichtung einen unterschiedlichen Anteil an Machtpotential gegenüber dem Positionsinhaber.
Hat ein Mitglied ein höheres Maß an Macht als die anderen, so spricht Merton von einem „Machtmonopol“ (Merton 1973, S.326). Es muss aber nicht so sein, dass besonders autoritäre Mitglieder immer einen stärkeren Einfluss auf den Statusinhaber haben, da sich manchmal auch „Machtkoalitionen“ (Merton 1973, S.326) bilden. Dadurch wird der Positionsinhaber entlastet, denn die Auseinandersetzungen verlagern sich zwischen die Teilnehmer des Rollen-Set und müssen nicht mehr zwischen ihm und den Mitgliedern ausgetragen werden.
Die Redaktion der Talkshowmoderatorin möchte gegebenenfalls, dass die Moderatorin unseriöse oder intime Fragen an ihre Gäste stellt. Die Gäste möchten diese Fragen aber nicht beantworten, weil sie ihnen unangenehm sind. Die Moderatorin agiert dann hier lediglich als Mittelsmann zwischen den beiden Parteien, die versuchen den Konflikt untereinander zu lösen. Oder sie gibt der Einstellung ihrer Redaktion nach, da diese eine größere Macht auf sie ausübt.
Dadurch ergibt sich eine gewisse Freiheit für den Statusinhaber bei gegensätzlichen Meinungen der Angehörigen des Rollen-Set nicht den einflussreichsten Mitgliedern völlig ausgeliefert zu sein, sofern diese überhaupt an einer Beziehung mit ihm interessiert sind. Demnach können sich widersprüchliche Ansichten der Rollenspieler untereinander zum Vorteil für den Positionsinhaber entwickeln.
4.3 Abschirmung des Rollen-Handelns gegenüber der Beobachtung durch Mitglieder des Rollen-Set
Der Positionsinhaber kann nicht zur gleichen Zeit mit Teilnehmern verschiedener Rollen-Sets und meist auch nicht gleichzeitig mit allen Angehörigen eines Rollen-Set interagieren. Er wird sich demzufolge nur mit einem oder wenigen Rollenspielern auseinandersetzen und ihnen seine Haltung anpassen. Anderen könnte dieses Verhalten missfallen, da sie es aber nicht einblicken, bleibt dem Statusinhaber der Freiraum zu tun, was er möchte ohne für sein Handeln sanktioniert zu werden.
Auf diese Weise kann der Rollenträger eine Reihe von Konflikten vermeiden.
Am Beispiel gesehen, würde dies bedeuten, dass die Talkshowgäste nicht mitbekommen, was hinter verschlossener Tür in der Redaktion gemeinsam mit der Moderatorin über den Ablauf der Sendung geredet wird. Dies erspart der Moderatorin eventuell Konflikte mit ihren Gästen, die gegebenenfalls auch ein wenig mitbestimmen wollen wie die Show verlaufen soll.
Diese Abschirmung bewirkt, dass das Rollenhandeln des Statusinhabers nicht von allen Gegenspielern in gleicher Weise eingesehen werden kann, und er nicht ständig den widerstreitenden Interessen der Rollenspieler ausgesetzt ist.
Privatsphäre ist ebenso eine wichtige soziale Tatsache, ohne die die Sozialstruktur nicht funktionieren könnte. Jeder Mensch braucht ein gewisses Maß an „ Immunisierung und Isolierung des Selbst gegen die Beobachtung durch andere“ (Merton 1973, S. 328). Diese ist durch den dritten Mechanismus gegeben.
Individuen müssen dennoch einer sozialen Kontrolle unterliegen, d.h. ihre Autonomie muss gesicherte Grenzen haben. Ansonsten könnte unsere Gesellschaft zu einer zügellosen Gesellschaft mutieren, in der jeder tut und lässt, was er will.
Zusammenfassend kann man zu diesem Mechanismus sagen, dass eine „Abschirmung von Handlungen und Ansichten gegen die Beobachtung durch andere“ (Merton 1973, S. 328) zur strukturellen Basis gehört und der Vorraussetzung der Konfliktminderung in der Gesellschaft dient. Trotzdem ist eine soziale Kontrolle zur Stabilisierung des Rollen-Set nötig.
4.4 Übersehbarkeit widersprüchlicher Forderungen seitens der Mitglieder eines Rollen-Set
Es kann der Fall eintreten, dass Mitglieder eines Rollen-Set widersprüchliche und völlig unvereinbare Forderungen an den Statusinhaber haben. Solange sie davon allerdings nichts wissen, können sie ohne weiteres versuchen, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen.
Der vierte Mechanismus, der ebenso zur Stabilisierung des Rollen- Set beiträgt, besagt, dass der Positionsinhaber aus dem Zentrum des Konflikts heraustreten kann, sobald die Parteien voneinander wissen, dass sich ihre Forderungen unterscheiden. Es ergibt sich für die Rollenspieler nun die Aufgabe, diese Widersprüche untereinander zu klären. Dem Statusinhaber fällt hierbei oft die Position des neutralen oder nutzniesenden Dritten zu.
Wenn Gäste und Redaktion feststellen, dass sie nicht das eine oder andere von der Moderatorin verlangen können, müssen sie, ähnlich wie beim zweiten Mechanismus, untereinander versuchen, zu einer Einigung zu gelangen. Dabei entspannt sich für die Moderatorin die Situation. Indem sie wieder aus dem Konflikt heraustritt, kann sie weiterhin ihren Interessen nachgehen.
4.5 Gegenseitige soziale Unterstützung zwischen den Statusinhabern
Die Sozialstruktur bringt mit sich, dass alle Individuen verschiedene State besitzen. Demnach sind viele Personen gleichen oder ähnlichen Problemen ausgesetzt. Die Lösung eines Konfliktes kann folglich unter den Inhabern des gleichen oder eines verwandten Status gemeinsam angegangen werden.
Durch diese Gegebenheit entstehen Organisationen und Gewerkschaften gleichgestellter Statusinhaber, die versuchen widersprüchliche Erwartungen seitens des eigenen oder anderer Rollen-Sets zu lösen. Diese Organisationen stellen also „ein Bindeglied zwischen dem Individuum und der Gesellschaft“ (Merton 1973, S.330) dar. Dem einzelnen wird daher soziale Unterstützung gewährt.
Zum Beispiel könnte sich die Moderatorin in einer freiwilligen Arbeitsorganisation befinden, die bei Lohnkürzung im entsprechenden Bereich gegen die solche angeht. Die Moderatorin müsste sich nun nicht allein und völlig wehrlos gegen Ihre Vorgesetzten behaupten.
4.6 Beschränkung des Rollen-Set
Wenn es zu einem nicht lösbaren Konflikt zwischen Positionsinhaber und einem seiner Rollenpartner kommt, führt es im Grenzfall dazu, dass dieses Verhältnis beendet wird. Dies ist aber nur in wenigen Einzelfällen möglich, da das Rollen-Set nicht individuell wählbar ist, sondern zu einem durch die soziale Struktur geprägten Apparat gehört.
Im Beispiel kann die Talkshowmoderatorin den Kontakt zu einzelnen Gästen abbrechen, mitunter sogar mit allen, die vorher in ihrer Sendung waren. Niemals aber ist es ihr möglich die Talkshow ohne Gäste zu gestalten oder ohne Redaktion zu arbeiten.
Der Statusinhaber kann sich nur aus Rollenbeziehungen lösen, wenn die Weiterbestand der Funktion der übrigen Rollen gewährleistet ist. Ist dies nicht der Fall, bricht der gesamte Status zusammen.
5 Verbleibende Konflikte im Rollen-Set
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die sechs genannten sozialen Mechanismen, die eine Verschränkung ermöglichen, noch nicht ausreichend sind, um die Problematik im Rollen-Set zu lösen.
Merton sagt dazu: „Der verbleibende Konflikt innerhalb des Rollen-Set, kann so groß sein, dass er eine wirksame Rollen- Leistung des betreffenden Statusinhabers wesentlich stört“ (Merton 1973, S. 331). D. h. dass ein entsprechendes Rollen- verhalten des Positionsinhabers durch die verbleibenden Probleme im Rollen-Set, nur mit Einschränkung oder überhaupt nicht mehr ausführbar ist. Es müssen infolgedessen weitere Mechanismen entwickelt werden, die helfen, Konflikte zu be- wältigen.
6 Das Model des Homo Sociologicus
Das Modell des normorientierten Akteurs herrscht bis heute in der Soziologie vor.
Dabei gibt es in den Ausführungen von Uwe Schimank drei Schritte der Darstellung des Homo Sociologicus:
Er beschreibt, dass Emil Durkheim im normativen Paradigma den analytischen Kern des Homo Sociologicus herausarbeitet.
Hier ist der Gegenstand der Soziologie im Zwang, den soziale Normen auf das Individuum ausüben , zu suchen. Die sozialen Normen werden in der Erziehung vermittelt.
Die Erziehung stellt den Mechanismus über den die Regel- mäßigkeiten in der Welt erzeugt werden, dar. Diese Regelmäßigkeiten sieht Durkheim als objektiv an und erkennt darin ein Handlungsmuster das von dem Druck des sozialen Milieus ausgeht. D.h., dass der Einzelne sein Verhalten in Orientierung an vorgegebenen sozialen Normen auswählt.
Auch bei Talcott Parsons besitzen soziale Normen einen zentralen Stellenwert. Seine Bedingungen sind, dass der Akteur ein Ziel verfolgt, diese Zielverfolgung in einer Situation stattfindet, und dass das Handeln des Individuums immer normativ reguliert sein muss. Seine Betonung liegt dabei auf der vom Utilitarismus ausgeblendeten Orientierung des Handelns.
Diese beiden Theorien lassen sich unter dem Begriff des „rolltaking“ (Schimank 2000, S. 37) ansiedeln. Hier ist eine absolute Rollenbefolgung die Vorraussetzung.
„Die Strukturfunktionalistische Rollentheorie, die soziale Normen als Rollenerwartungen konzipiert und dementsprechend den Akteur als Rollen-Handelnden akzeptiert hat“ (Schimank 2000, S. 37) ist der grundlegende Ausgangspunkt der Betrachtung.
Der dritte Schritt hat im Kern die Idee des „roll-making“ (Schimank 2000, S. 55). Der Begriff zählt zu dem interpretativen Paradigma und gibt dem Akteur größere Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb einer Rolle kreative Eigenleistung hervorzubringen.
Beim Rollenhandeln ist die Vorraussetzung die gleiche wie beim Rollen-Set. Es gibt soziale Positionen und die dazugehörigen Rollen. „Der Terminus soziale Position bezeichnet jeden Ort in einem Feld sozialer Beziehungen“ (Dahrendorf 1958, S. 190). Positionen sind unabhängig vom Individuum, sie existieren, ohne dass diese von Personen definiert sind. Da Positionen komplex sind, d.h. viele Bezüge zu anderen Positionen beinhalten, führt Dahrendorf den Begriff Positionssegmente ein. Positionen bestehen demnach aus einer Menge von Positionssegmenten.
Rollen sind nach Dahrendorf als Knäuel von Verhaltenserwartungen an den jeweiligen Positionsträger definiert. Daraus geht klar hervor, dass die Rolle gesellschaftlich bestimmt ist. Auch hier hat der Einzelne mehrere soziale Rollen „deren jede der Möglichkeit nach eine Mehrzahl von Rollensegmenten umschließt“ (Dahrendorf 1958, S.192).
Das Modell des Homo Sociologicus sieht von der Willensfreiheit des Individuums ab und besagt, dass ein Rollenspieler stets fremdbestimmt ist. Weiterhin wird festgehalten, dass eine Person bei so gut wie allen sozialen Handlungsvollzügen austauschbar ist. Er vergleicht dies mit der Rolle, die ein Schauspieler am Theater innehat.
Dahendorf vertritt die Auffassung, dass die Rolle, die einem von der Gesellschaft auferlegt wird „eine ärgerliche Tatsache ist, der wir uns nicht ungestraft entziehen können“ (Dahrendorf 1958, S. 194). Es besteht ein von der Gesellschaft ausgehender Zwang, dem jeder in seiner Rolle unterliegt, ob die Person will oder nicht.
Die Verbindlichkeit von Verhaltensregeln wird von einer Gesellschaft durch negative als auch durch positive Sanktionen ermöglicht. Muss-Erwartungen sind demnach hochgradig verbindlich, Soll-Erwartungen haben einen schwächeren Ver- bindlichkeitsgrad und Kann-Erwartungen können erfüllt werden. Geschieht dies nicht, hat der Rollenhandelnde keine negativen Sanktionen zu erwarten, im Gegenteil oft erfolgen auf sein Verhalten positive Reaktionen. Obwohl der Rollenspieler dem Zwang der Gesellschaft durch Sanktionen unterliegt und dies weitestgehend sein Handeln bestimmt, gibt es einen gewissen freigestaltbaren Handlungsspielraum für ihn. Z.B. ist ihm nicht vorgeschrieben, ob er essen geht oder sich selbst etwas kocht, wenn er Hunger hat.
Dahrendorf stellt sich die Frage, woher die Rollenerwartungen rühren, nach denen sich der Positionsträger richtet. Er beruft sich in seiner Analyse auf Merton, der den Terminus der Bezugsgruppen entwickelte. Es bedeutet, dass „ein Einzelner sein Verhalten an der Zustimmung oder Anlehnung von Gruppen orientiert“(Dahrendorf 1958, S.200). Diesen Sachverhalt muss man allerdings dahingehend eingrenzen, dass nur die Gruppen gemeint sind, zu denen seine Positionen notwendigerweise in Bezug stehen. Hier kann die ganze Gesellschaft als eine neben anderen stehende Bezugsgruppe, in der Bestimmung und Kontrolle von Verhaltenserwartungen herrschen, angesehen werden.
Weiterhin nimmt Dahrendorf die Unterscheidung zwischen „zugeschriebenen Positionen“ (Dahrendorf 1958, S. 346), die dem Individuum zukommen, ohne dass es etwas dafür tut, und „erworbenen Positionen“ (Dahrendorf 1958, S. 346), die der Positionsträger durch eigenes Zutun bekommen hat, vor. Egal ob zugeschriebene oder erworbene Position, es wird immer eine Leistung angesichts der Rollenerwartungen von der Person erwartet. Die Verinnerlichung dieser zu vollbringenden Leistung geschieht durch Internalisierung von Verhaltensmustern.
„ Für Gesellschaft und Soziologie ist der Prozess der Sozialisierung stets ein Prozess der Entpersönlichung, in dem die absolute Individualität und Freiheit des Einzelnen in der Kontrolle und Allgemeinheit sozialer Rollen aufgehoben wird“ (Dahrendorf 1958, S. 48).
Der Wirkungsbereich des Homo Soziologicus ist eine Welt, in der alles berechenbar, verlässlich und kontrollierbar ist. Allerdings kann sich die Kontrolle im Laufe der Zeit verändern, da die Rollenerwartungen genauso dem Wandel der Zeit unterliegen wie die Gesellschaft selbst.
Uwe Schimank geht ein seinem Kapitel „Role making“ auf die Konflikte, die ein Positionsinhaber bei der Ausführung seiner Rollen haben kann, ein. Es gibt für den Homo Sociologicus des normativen Paradigmas verschiedene Vorraussetzungen seine Verhaltenserwartungen erfüllen zu können.
Dabei müssen die Erwartungen unterschiedlicher Bezugsgruppen kompatibel sein. Außerdem müssen die Rollen, die der Einzelne innehat, zusammenpassen. Es muss gegeben sein, dass die Rollenerwartungen verständlich sind, und die Möglichkeiten diese Rolle spielen zu können besteht. Als letzten Punkt führt Schimank auf, dass die jeweilige Rolle „mit den persönlichen Bedürfnissen, Interessen, Zielen u.ä.“ (Schimank 2000, S. 55) vereinbar sein muss.
Ob diese Mechanismen immer gegeben sind, wird von dem interpretativen Paradigma kritisch hinterfragt. Sobald eine der Vorraussetzungen nicht existent ist, muss der Rollenspieler seine Rolle in geistreicher Eigenleistung situativ selbst ausfüllen.
Ein Intra-Rollenkonflikt entsteht, wenn an einen Rollenhandelnden verschiedene Ansprüche seitens der Bezugsgruppen gestellt werden. Er kann dann sein Handeln von der Stärke des Erwartungsdrucks, dem „Ausmaß der Beobachtbarkeit von Erwartungskonformität“ (Schimank 2000, S. 57), oder der offenen Thematisierung gegenüber den betroffenen Bezugsgruppen, abhängig machen.
Geht es um Widersprüchlichkeit zwischen Verhaltenserwartungen, die an unterschiedliche Rollen gerichtet sind, so spricht man von einem Inter-Rollenkonflikt. Dem kann mit der gleichen Bewältigungsform wie im Intra-Rollenkonflikt begegnet werden.
Beim defizit ä ren Rollenwissen, hat der Rollenspieler nicht genug Wissen darüber, wie er seine Rolle ausfüllen soll und muss versuchen, seine Verhaltensunsicherheit durch kreative Gestaltung seiner Rolle zu umgehen oder zu überdecken.
Wenn ein Ressourcenmangel vorliegt, muss der Rollenhandelnde improvisieren, um nicht als Unglaubwürdiger oder sogar Geächteter vor seinen Bezugsgruppen dazustehen. Er muss etwas finden, um das fehlende Medium auszugleichen.
„ Person-Rolle-Konflikte entstehen (...) aus der Unfähigkeit oder der Unwilligkeit der Person, den Rollenerwartungen zu entsprechen“ (Schimank 2000, S. 63), weil diese nicht ihren Interessen oder Zielen entsprechen. Trotzdem sollte der Rollenträger versuchen einige Erwartungen, die in dieser Form an ihn gestellt werden, zu erfüllen. Ansonsten wäre es möglich, dass er seine gesamte Position aufgeben muss.
Es wird hierbei also aufgezeigt, dass all die genannten Konflikte ein „role making“ erfordern.
Zusammenfassend kann man daher sagen, dass sich der Homo Sociologicus in zwei Versionen aufteilt. Das „role taking“ ist gegeben, wenn absolute normative Erwartungssicherheit, die dem Rollenträger durch normative Handlungsorientierung geliefert wird, vorhanden ist. Das „role making“ hingegen bezieht sich auf Gegebenheiten, in denen genau dies nicht der Fall ist, und dem Rollenträger kreative situative Bewältigung von Komplikationen abverlangt wird.
Schluss
Abschließend kann man sagen, dass der von Robert K. Merton entwickelte Rollen-Set sich in Dahrendorfs Modell des Homo Sociologicus, als auch in die von Schimank herausgestellten Begriffsbestimmungen des „role taking“ und „role making“, ein- gliedern lässt.
Bei allen drei Autoren sind Position und Rolle ein wesentlicher Faktor der sozialen Struktur. Die beiden Begriffe machen den Homo Sociologicus aus, ihnen gilt alle Aufmerksamkeit der soziologischen Analyse der Gesellschaft. Man muss hier allerdings davon absehen, die gesamte soziologische Theorie als eine einzige Rollentheorie aufzubauen.
Die Parallele zwischen Merton und Dahrendorf ist besonders deutlich bei der Beschreibung der Bezugsgruppen zu erkennen. Die Gesamtheit der Bezugsgruppen an eine Position wird von Merton als der Rollen-Set bezeichnet. Dahrendorf beschreibt dieses Phänomen als Rollensegmente, die sich aus der Gesamt- heit der an eine Person gerichteten Rollenerwartungen, zusam- mensetzen. Bei beiden orientiert sich der Rollenträger am Ver- halten und den Erwartungen anderer, durch die er instruiert, überwacht und sanktioniert wird.
Ferner sind sich die drei Soziologen darüber einig, dass nicht jede einzelne Rolle des Rollenspielers sein gesamtes Verhalten als Träger einer sozialen Position beinhaltet. Jeder hat eine gewisse Freiheit seine Rollen selbst auszugestalten. Dies ist in Mertons und vor allem Dahrendorfs Modell nur in sehr geringem Maße möglich. Schimank bringt dies in seinem Kapitel über das „role making“ zum Ausdruck.
Die sozialen Mechanismen, die dem Rollenträger zur Selbst- erhaltung dienen, sind bei Schimank nur in andere Begriffsbe- stimmungen, wie unter anderem den Inter- und Intra-Rolle-Kon- flikten, gefasst. Sie bestehen, wenn der Rollenhandelnde sich in einer Situation befindet, in der er widersprüchlichen Erwartungen seitens der Bezugsgruppen ausgesetzt ist, oder ihm etwas fehlt, was seine Rollenausführung unmöglich macht. Vergleichbar mit Merton bleiben dem Rollenträger hierbei -wie oben beschrieben- verschiedene Möglichkeiten, Probleme zu bewältigen.
Abschließend ist zu sagen, dass Merton, Dahrendorf und Schimank wichtige soziologische Wissenschaftler sind, die bedeutende Theorien entwickelt haben auf die die heutige Analyse der Gesellschaft zurückgreifen und aufbauen kann.
Literaturverzeichnis:
Dahrendorf, Ralf 1958: Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 10, Heft 2, S.188-208, Teil 2 in Heft 3, gleicher Jg., S. 345-350
Merton, Robert K. 1973: Der Rollen-Set. Probleme der soziologischen Theorie, in: Hartmann, Heinz (Hrsg.): Moderne amerikanische Soziologie, Stuttgart: Enke, S.316-333
Schimank, Uwe 2000: Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie, Weinheim, München. Juventa, Kap.3: Homo Sociologicus: Normorientiertes Handeln, S.37-69
Weber, Max 1972[1921]: Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl., Tübingen: JCB Mohr
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Das zentrale Thema des Textes ist die Auseinandersetzung mit sozialen Strukturen, insbesondere dem Rollen-Set, und den Mechanismen, die Konflikte innerhalb dieser Rollen reduzieren. Der Text basiert auf Robert K. Mertons Aufsatz „Der Rollen-Set: Probleme der soziologischen Theorie“ und bezieht sich auf die Rollentheorie von Ralph Linton sowie auf das Modell des Homo Sociologicus von Ralf Dahrendorf.
Was sind die zentralen Begriffe, die im Text definiert werden?
Die zentralen Begriffe, die im Text definiert werden, sind: Position, Status, Rolle und Rollen-Set. Der Text erklärt, wie diese Begriffe in Bezug zueinander stehen und wie sie die soziale Struktur prägen.
Was ist das Rollen-Set und wie unterscheidet es sich von der Rollen-Ausstattung?
Das Rollen-Set ist die Kombination von Rollenbeziehungen, in die eine Person aufgrund ihres Status verwickelt ist. Die Rollen-Ausstattung umfasst alle Rollen, die mit allen verschiedenen Positionen einer Person zusammenhängen, während das Rollen-Set sich nur auf die Rollen bezieht, die zu einem einzigen Status gehören.
Welche Problematik ergibt sich innerhalb des Rollen-Set?
Die Problematik innerhalb des Rollen-Set besteht darin, dass verschiedene Mitglieder des Rollen-Sets unterschiedliche und sogar gegensätzliche Verhaltenserwartungen an den Statusinhaber haben können, was zu Konflikten führt. Der Statusinhaber muss versuchen, diese unterschiedlichen Ansprüche zu koordinieren.
Welche sozialen Mechanismen helfen, Konfliktsituationen im Rollen-Set abzuschwächen?
Der Text beschreibt sechs soziale Mechanismen, die Konfliktsituationen im Rollen-Set abschwächen:
- Relative Bedeutsamkeit verschiedener Positionen
- Machtunterschiede zwischen den Personen in einem Rollen-Set
- Abschirmung des Rollen-Handelns gegenüber der Beobachtung durch Mitglieder des Rollen-Set
- Übersehbarkeit widersprüchlicher Forderungen seitens der Mitglieder eines Rollen-Set
- Gegenseitige soziale Unterstützung zwischen den Statusinhabern
- Beschränkung des Rollen-Set
Was ist das Modell des Homo Sociologicus und welche Rolle spielen Position und Rolle darin?
Das Modell des Homo Sociologicus beschreibt den Menschen als ein von sozialen Normen und Rollenerwartungen geprägtes Wesen. Position und Rolle sind zentrale Begriffe in diesem Modell, da sie die Grundlage für die soziologische Analyse der Gesellschaft bilden.
Was sind „role-taking“ und „role-making“ im Kontext des Homo Sociologicus?
„Role-taking“ beschreibt eine Situation, in der der Rollenträger normative Erwartungssicherheit hat und sich an vorgegebenen Rollenerwartungen orientiert. „Role-making“ bezieht sich auf Situationen, in denen der Rollenträger kreative und situative Bewältigung von Komplikationen erfordert, da keine absolute normative Erwartungssicherheit besteht.
Welche Arten von Konflikten kann ein Positionsinhaber bei der Ausführung seiner Rollen haben?
Ein Positionsinhaber kann verschiedene Arten von Konflikten erleben: Intra-Rollenkonflikte (widersprüchliche Ansprüche von Bezugsgruppen an eine Rolle), Inter-Rollenkonflikte (Widersprüchlichkeit zwischen Verhaltenserwartungen an unterschiedliche Rollen), defizitäres Rollenwissen (Mangel an Wissen zur Rollenausfüllung), Ressourcenmangel (fehlende Mittel zur Rollenausübung) und Person-Rolle-Konflikte (Unvereinbarkeit der Rollenerwartungen mit persönlichen Bedürfnissen).
Welche Wissenschaftler werden im Text bezüglich ihrer Theorien über soziale Rollen behandelt?
Im Text werden die Theorien von Robert K. Merton, Ralph Linton, Ralf Dahrendorf, Emil Durkheim, Talcott Parsons, Max Weber und Uwe Schimank behandelt.
- Quote paper
- Nina Nick (Author), 2000, Der Rollen-Set und das Modell des Homo Sociologicus: Definitionen, Konflikte, Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105591