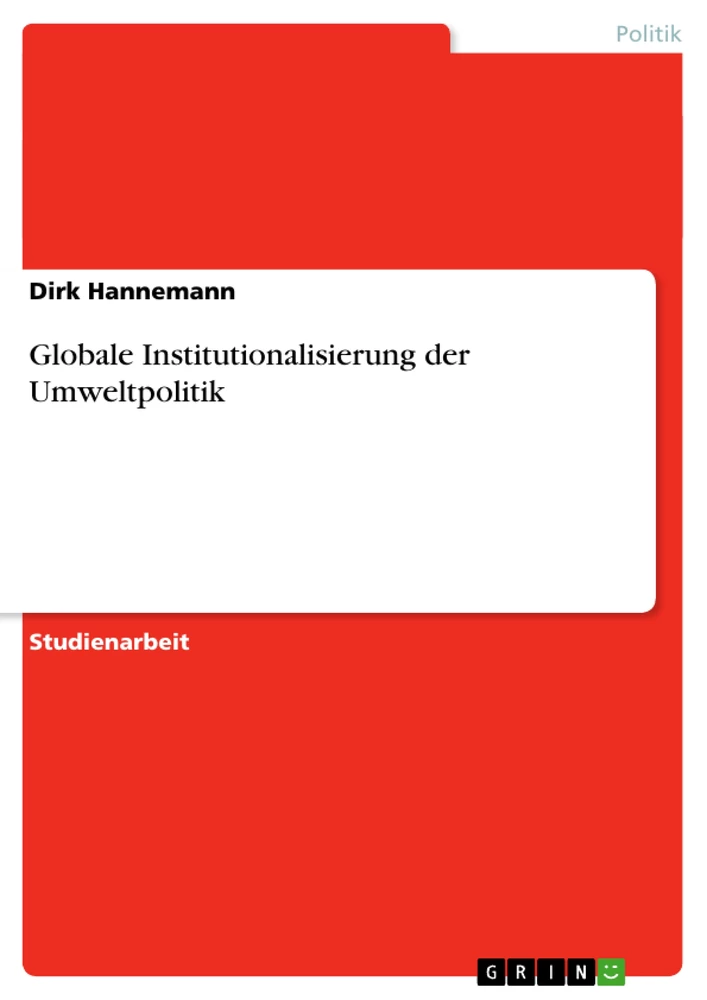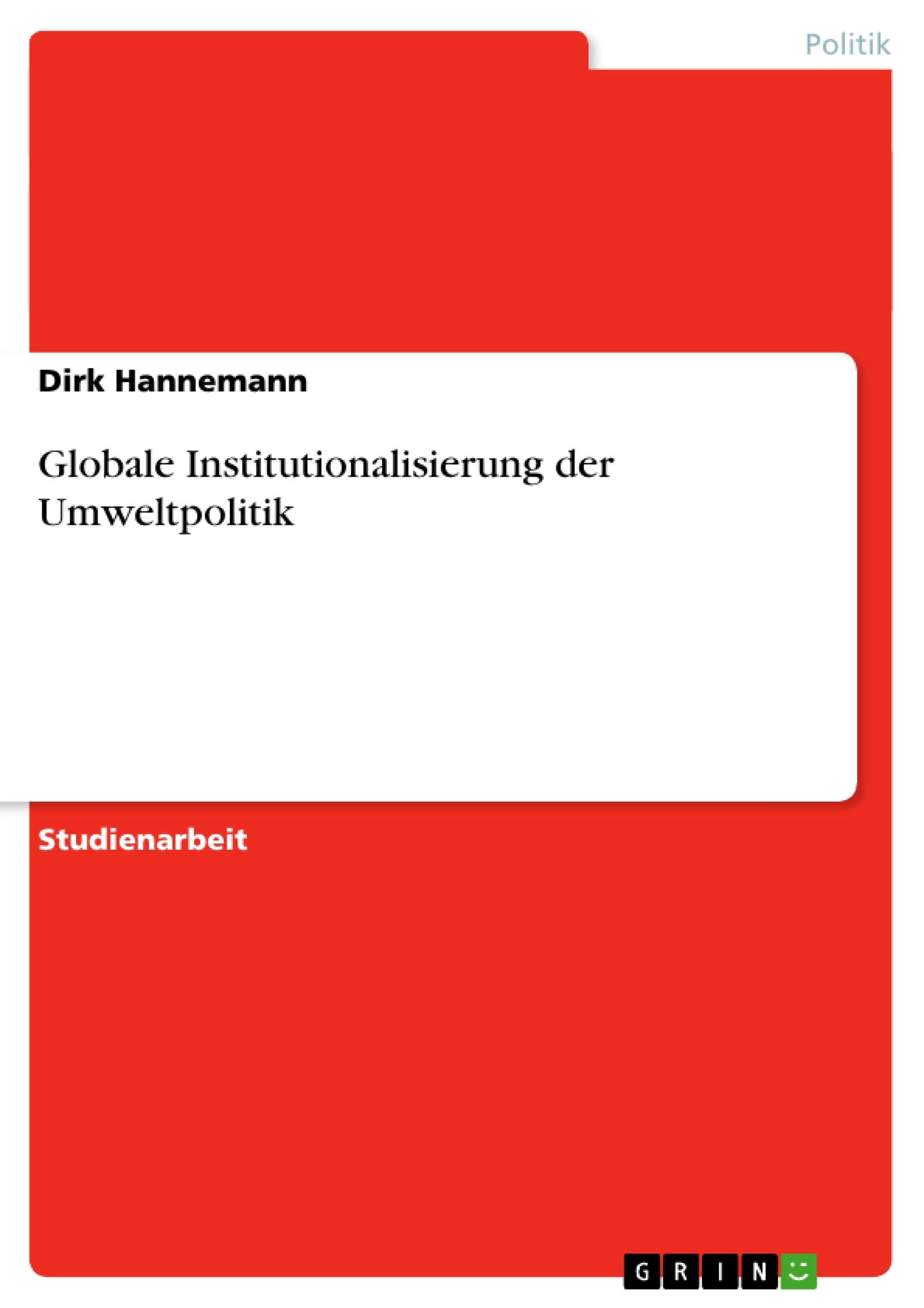Umweltpolitik hat eine globale Dimension, da Phänomene wie die Erderwärmung die ganze Welt betreffen. Dieses Politikfeld ist deshalb besonders geeignet, sich über internationale Organisationen Gedanken zu machen, die globale Probleme auch auf einer globalen Ebene bearbeiten. Dies ist der Gedanke von Ansätzen Globaler Strukturpolitik (Global Governance). Die Autoren Udo Ernst Simonis und Frank Biermann haben den Vorschlag gemacht, bei den Vereinten Nationen eine Weltumweltorganisation zu errichten. Ein solches Modell wird in diesem Artikel dargestellt und mit seinen Kritikern konfrontiert. Aus der Diskussion lassen sich gute Gründe ableiten, Umweltpolitik mit anderen Politikfeldern auf globaler Ebene zu vernetzen, wofür auch die Errichtung eines demokratischen Weltstaates nicht länger als Alternative zum gegenwärtigen System der Nationalstaaten ausgeschlossen werden sollte.
Freie Universität Berlin, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Seminar Dirk Messner: „ Global Governance “ , SoSe 2001 Sitzung Block III am Freitag, den 29.06.2001 „ Handlungsfelder von Global Governance “
Dirk Hannemann: Globale Institutionalisierung der Umweltpolitik
* Wenn Politikwissenschaftler in Folge der Globalisierung eine verstärkte internationale Kooperation von Regierungen einfordern, verweisen sie meist auf zwei Problematiken, die den Handlungsbedarf untermauern sollen: zum einen auf die notwendige Regulierung des globalen Finanzmarktes, dessen Instabilität Gefahren für die Weltwirtschaft birgt, und zum anderen auf die problematische Ökologie, wo es um den weltweiten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen geht. Finanz- wie Umweltpolitik sind also die Politikfelder, die am weitesten die Regelungskompetenz nationalstaatlicher Demokratien überschreiten. Sie deuten auf eine „institutionelle Lücke“ (Narr / Schubert 1994) hin, die heute zwischen (schon) globalen Prozessen und (noch) nationalen Regulierungen klafft. Was läge also näher, als für diese Politikfelder zu versuchen, die vermutete institutionelle Lücke zu schließen und die politische Regulierung von der nationalen auf die globale Ebene zu erweitern? Einen solchen Ansatz vertreten Prof. Dr. Udo Ernst Simonis und Dr. Frank Biermann vom Wissenschaftszentrum Berlin, die konkrete Vorschläge für eine stärkere Institutionalisierung der Weltumweltpolitik präsentieren.
Kurz gefasst halten Biermann / Simonis (1998, 2000) die Herausforderungen in der globalen Umweltpolitik für so hoch, dass sie mit den existierenden Institutionen nicht mehr zu bewältigen sind. Ein Mehr an Effizienz und Koordination bei existierenden Umweltregimen, die seit den 1970er Jahren aus einzelnen Abkommen zu Meeres- oder Bodennutzung oder zum Schutz der Ozonschicht hervorgegangen sind, halten die Autoren zwar für prinzipiell wünschenswert, doch letztlich nicht für ausreichend. Die globale Umweltpolitik brauche ihrer Ansicht nach eine zentrale Organisation, die Initiativen zum Naturschutz auf höchster Ebene bündelt, als eine Art WTO oder ILO der Ökologie. So könne aus vielen einzelnen Programmen eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen entstehen, die sich als „Weltorganisation Umwelt und Entwicklung“ in die Familie von UNDP und UNESCO eingliedert. Existierende Regime würden mit bestehenden, aber schwachen Instituten vereint und systematisch mit der Entwicklungspolitik verzahnt. Die organisatorische Reform stärkt die Problemlösungsfähigkeit und sichert eine Finanzierung aus Steuern und zweckgebundenen Geldern. Die Entscheidungsmodi in der zu gründenden Weltorganisation sollen eine Parität zwischen Nord und Süd ausdrücken.
1 Bedingungen ökologischer Politik
Die Umweltpolitik genießt in den Regierungsgeschäften nicht den Rang der Finanzpolitik. Daran hat auch die Rio-Konferenz von 1992 nicht viel geändert, obwohl sie als ein Meilenstein einer globalen Umweltpolitik gelten kann.
Steuerflucht und Währungsspekulation gelten im Staatsapparat als „harte“ Themen. Dagegen sind ökologische Problematiken wie Klimapolitik und Luftverschmutzung „weich“ und werden in der politischen Agenda tendenziell zugunsten anderer, „dringenderer“ Ziele zurückgestellt, die „akut“ sind. Natürlich (!) ist dies eine falsche Sichtweise - in der Umweltpolitik geht es um mehr.
Aus der Sicht der Politikwissenschaft hat das Anliegen des Naturschutzes also ein grundsätzliches organisatorisches Problem (welches sich auch auf die hier zu besprechenden Ideen einer globalen Institutionalisierung auswirken muss), das mit einem Vermittlungsproblem ökologischer Themen korrespondiert.
- Ökologische Ziele lassen sich schlecht vermitteln, da ihre Problematiken mit naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen dargestellt werden (Grenzwerte, Kausalitäten), die dem Laien wenig transparent erscheinen. Außerdem sind noch viele Felder unerforscht und können nicht mit wissenschaftlicher Exaktheit beschrieben werden. Dieser Unsicherheit steht der Druck zum entschlossenen Handeln gegenüber.
- Trotz (oder wegen) naturwissenschaftlicher Fundierung, sind ökologische Themen nicht gut zu quantifizieren (Bsp. Kosten-Nutzen-Verhältnis) und damit auch schlecht in die Sprache einer ökonomisch dominierten Welt zu übersetzen (Wert der Natur, vgl. als Lösungsansatz die Theorie der Global Public Goods bei Kaul u.a. 1999, Reinicke 1998).
- Ökologie lässt sich nicht nur wegen der schlechten Vermittelbarkeit, sondern auch aus strukturellen Gründen schlecht politisch durchsetzen: Selbst wenn die Vermittlung der Problematik gelingt, sind die Ziele der Umweltpolitik diametral gegen den Status Quo gerichtet. Die globale Reichweite verlangt z.B. einen hohen materiellen Nord-Süd-Ausgleich.
Summa summarum stellt sich für die Ökologie die politische Situation also folgendermaßen dar: relativ schlecht organisierte Initiativen von Naturschützern mit schwacher materieller Basis wollen eine kaum vorhandene weltweite politische Öffentlichkeit mit einer auf wackligen Füßen stehenden Argumentation davon überzeugen, dass die derzeitigen Besitzstände massiv umzuverteilen sind, damit umweltpolitische Ziele verwirklicht werden können, die räumlich und zeitlich den Horizont fast aller Menschen überschreiten .
Die dargestellte schwache Durchsetzbarkeit von umweltpolitischen Zielen muss sich auch auf Versuche einer stärkeren Institutionalisierung auswirken. Fortschritte in diese Richtung sind ja schon in der Finanzpolitik kaum zu verzeichnen, die aber eine gute organisatorische Basis aufweist und in der das Problembewusstsein relativ großund weltweit entwickelt ist. Wie eine globale Institutionalisierung dann gerade in der Umweltpolitik gelingen soll, scheint schleierhaft, wenn man sich allein das Ungleichgewicht zwischen beiden Politikfeldern anhand der beteiligten Akteuren verdeutlicht (auch im Hinblick darauf, dass Umweltpolitik gegen Wirtschaftsinteressen durchgesetzt werden muss): Einerseits multinationale Banken und Unternehmen sowie mächtige Finanzministerien als Interessenvertreter in der Finanzpolitik, andererseits vorwiegend zivilgesellschaftliche Initiativen, schwache politische Organisationen sowie vereinzelte Forschungsstellen im Verbund mit marginalisierten Umweltministerien als Promotoren der Umweltpolitik.
Simonis und Biermann abstrahieren von den hier angesprochenen strukturellen Fragen zu Vermittlung, Interessen und politischer Durchsetzbarkeit völlig, vielleicht bewusst, um ihrem Ansatz keinen utopischen Charakter zu verleihen. Die Autoren richten ihr Augenmerk in einer strikt akteurstheoretischen Perspektive ausschließlich auf Probleme der Institutionalisierung, nicht auf strukturelle Hindernisse. Die Realität als „die böse, böse Welt, wie sie ist“ (Hannemann), erhält wenn nicht explizit, so aber doch implizit durch das Kriterium Praxisnähe in den Ansatz Einzug. Die Frage ist letztlich - im Sinne der Kritik von Brand u.a. (2000) an Global Governance - ob die Fokussierung auf institutionelle Reformen statt auf Perspektiven gesellschaftlicher Veränderung eher zum Ziel führt, indem sie sich auf das vermeintlich Machbare beschränkt, oder ob sie zu kurz greift, weil sie den Kern der Problematik nicht erfasst.
2 Derzeitige Institutionen einer globalen Umweltpolitik
Schon heute befassen sich Organisationen auf globaler Ebene mit Umweltpolitik. Dies sind vor allem drei Organisationen im Umfeld der Vereinten Nationen - UNEP, GEF und CSD - sowie einige Konventionssekretariate, die zur Überwachung spezieller Verträge, etwa zum Ozonschutz, gegründet wurden (vgl. zum folgenden Biermann / Simonis 2000, 169-70). Nach Gehring / Oberthür (2000, 186) konnten Anfang der 90er Jahre bereits weitere 125 multilaterale Umweltregime gezählt werden, deren Sekratiarate relativ unabhängig voneinander arbeiten. Pro Jahr entstehen etwa fünf Umweltregime neu.
UNEP: Zu den etablierten Organisationen gehört vor allem die UNEP (United Nations Environmental Programme), die 1972 gegründet wurde (heutiger Exekutivdirektor Klaus Töpfer). Sie sollte die Aufgabe übernehmen, globale umweltpolitische Maßnahmen in einer Organisation zusammenzufassen. Als jedoch später Verträge zu einzelnen Themen abgeschlossen wurden, gründeten die Vertragspartner zur Regulierung der Vereinbarungen meist eigene Sekretariate, die auf Grund partikularer Interessen nicht in die UNEP eingegliedert sind (Übersicht zu Verträgen Biermann / Simonis1998, 6).
GEF: Zu diesen Sonderorganisationen der UN, auf die die relativ kleine UNEP keine normsetzende oder programmbildende Kraft aufbauen konnte, gehört die zweite große Organisation der globalen Umweltpolitik, die sogenannte Globale Umweltfazilität (GEF). Die GEF ist organisatorisch der Weltbank eingegliedert und hat zur Aufgabe, Zahlungen des Nordens an den Süden zu leisten, die aus zentralen Umweltverträgen hervorgehen, etwa in der Klimapolitik.
CSD: Aus der Rio-Konferenz 1992 entstand die dritte bedeutende Organisation globaler Umweltpolitik, die Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD). Ihr wurde eine Querschnittsfunktion im Themenfeld zugedacht, der sie jedoch nicht gerecht wurde, da sich in ihr Umwelt- und Entwicklungsminister abstimmen, aber keine Vertreter der „harten“ Politikfelder Finanzen, Wirtschaft oder Äußeres.
Biermann und Simonis sehen die internationale Umweltpolitik „von einer erheblichen organisatorischen Zergliederung gekennzeichnet“ (2000, 170). Die Aufgabengebiete der einzelnen Organisationen würden sich teilweise überschneiden und höchstens ad hoc abgestimmt. Teilweise widersprechen sich Vertragsinhalte, wie etwa die Klimapolitik mit den Artenschutzabkommen. So belohne das Kyoto-Protokoll zur Klimarahmenkonvention das Abholzen von (artenreichen) Urwäldern und das anschließende Wiederaufforsten mit (artenarmen, aber schnellwachsenden) Plantagen als klimapolitische Maßnahme. Die institutionelle Zersplitterung wirkt sich also ungünstig auf Umweltpolitik aus.
3 Vorteile einer zentralen Weltumweltorganisation
Mangelnde Koordination der Umweltpolitik ist nur eines von drei Problemen, dass sich mit einer zentralen Organisation, etwa im Range einer UN- Sonderorganisation wie der WTO oder der WHO, lösen ließe. Nach Simonis und Biermann könnte eine zentrale Instanz auch - zweitens - die Finanzierung der globalen Umweltpolitik auf neue Beine zu stellen, so dass eine größere Unabhängigkeit von den Mitgliedsstaaten ermöglicht würde. Auch könnten - drittens - zusammengefasste Verfahren besser gewährleisten, dass die Ziele globaler Umweltpolitik umgesetzt werden (Biermann / Simonis 2000, 169).
Koordination: Biermann und Simonis halten eine zentrale Organisation für das Politikfeld Globale Umweltpolitik für wünschenswert, um die heute relativ isolierten Organisationen zusammenzufassen und ihre Kräfte zu bündeln, wie es etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO für die Gesundheitspolitik vermag. "Wie das Politikfeld Umweltschutz in den siebziger und achtziger Jahren durch die Einführung von eigenständigen Umweltministerien organisatorisch gestärkt wurde, so sollte jetzt auch das globale Politikfeld Umweltschutz durch eine eigenständige Sonderorganisation gestärkt werden, um Partikularinteressen einzelner Programme und Organisationen zu minimieren und Doppelarbeit, Überschneidungen und Inkonsistenzen zu begrenzen. Praktikabel und organisatorisch recht einfach erscheint die Gründung einer eigenständigen UN- Sonderorganisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, eigenem Budget und eigenen Finanzierungsquellen, was insbesondere mit (1) dem Auflösen von UNEP, CSD und GEF, (2) der Integration der größeren Konventionssekretariate und (3) einer neuen Abgrenzung der Aufgaben der bestehenden Organisationen einher gehen müsste." (Biermann / Simonis 2000, 170).
Finanzierung: Entscheidend ist, über welche Kapazitäten eine Organisation verfügen kann. "Capacity building" ist eines der Zauberworte aus der Entwicklungspolitik, das zwar mehr als finanzielle Ausstattung meint - doch letztlich entscheidet sich alles an monetären Fragen. Nach Biermann und Simonis muss es Aufgabe einer globalen Umweltpolitik sein, weltweit - damit aber gerade in den Entwicklungsländern - organisatorische Kapazität aufzubauen, um unweltpolitische Ziele verfolgen zu können, was faktisch Geldtransfer von den Norden in den Süden meint. Gegenwärtig nimmt der Norden in der globalen Umweltpolitik vergleichsweise eine Schrittmacherfunktion ein, während Entwicklungsländer zögerlich gegenüber ökologischen Regulierungen sind, denn die ärmsten Länder können sich im globalen Standortwettbewerb auf einem (agrar-) protektionistischen Weltmarkt Vorteile nur durch Sozial- und Ökodumping sichern. Sie können im nördlich dominierten Weltsystem nur bestehen, indem sie die Gesundheit ihrer Bürger und die intakte Natur ihres Territoriums ruinieren (Rohstoff- und Textilindustrie; Müllimporte) und wehren sich somit aus existentieller Not gegen Mindeststandards, die ihnen diese Vorteile rauben und damit ihre ökonomische Basis zerstören. Das (mitverschuldete) Elend würde den Norden sicher nicht weiter stören, wenn die ökologische Problematik sich nicht gerade dadurch auszeichnete, dass lokales Versagen weltweite Folgewirkungen nach sich zieht. Weil der Norden vom Fehlverhalten des Südens mitbetroffen würde, sind die Industrieländer in der Klima- oder Ozonpolitik an weltweiten Regulierungen interessiert, die Mindeststandards im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens definieren. Damit die Entwicklungsländer kooperieren, werden ihnen Kompensationszahlungen angeboten, damit sie auf ökologisch problematische Industrie verzichten.
Biermann und Simonis betrachten die finanzielle Problematik eher von der technischen Seite: Wie schon bei der Ozon- und Klimapolitik werden die Industrieländer zukünftig auch zur Erhaltung der Artenvielfalt und bei der Bekämpfung von Wüstenbildung erhebliche Zahlungen an den Süden zu leisten haben. Auch und gerade bei marktwirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten wie dem Handel mit Emissionszertifikaten (Staaten können nach Festlegung einer weltweiten Verträglichkeitsgrenze für gefährliche Stoffe von Nichtnutzern Kontingente für Luftverschmutzung ersteigern), sei daher für die finanziellen Aspekte der globalen Umweltpolitik ein stabiler organisatorischer Unterbau nötig, den am besten eine zentrale Organisation auf globaler Ebene bieten könne (Biermann / Simonis 2000, 171). Die bisher für Ausgleichszahlungen eingerichteten Organisationen wie Multilateraler Ozonfonds und GEF, die bisher nur ad hoc kooperierten, könnten darin zusammengefasst werden.
Doch nicht nur die Geldvergabe, auch die Geldeinnahmen für globale Umweltpolitik könnten mit einer zentralen Organisation neu geordnet werden. Die Erfahrung zeigt, dass Zahlungsverpflichtungen von Staaten, die letztlich doch auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen, von der ökonomischen Konjunktur oder politischem Wohlverhalten abhängig gemacht werden. Da allein aus der in Rio verabschiedeten Agenda 21 ein jährlicher Transferbedarf an den Süden von ca. 125 Milliarden US-Dollar jährlich erwachsen (Biermann / Simonis 2000, 172), sollte eine Weltumweltorganisation sichere Geldquellen erschließen. Sie könnte zum Beispiel Begünstigte von neu zu schaffenden Steuern sein, etwa auf den Börsenhandel (Tobin-Steuer) oder auf internationalen Luftverkehr, oder sie könnte von anstehenden Zahlungen aus dem Emissionszertifikatehandel profitieren oder von Umwidmungen aus einem Schuldenerlass.
Umsetzung: Der dritte Vorteil, den sich Biermann und Simonis von einer zentralen Organisation für globale Umweltpolitik erhoffen, liegt in einer besseren Umsetzung und konzeptionellen Fortentwicklung ihrer politischen Ziele. Diese sei vor allem durch eine bessere Wissensbasis und Informationspolitik zu erwarten, die das Problembewusstsein fördert und die Entscheidungsgrundlage verbessert: obwohl schon einige Anstrengungen unternommen wurden, "fehlt das umfassende Koordinieren, Bündeln und entscheidungsorientierte Aufbereiten und Weiterleiten dieses Wissens." (Biermann / Simonis 2000, 174).
4 Ausgestaltung einer zentralen Weltumweltorganisation
Zentral ist natürlich die Frage, wie eine solche Weltumweltorganisation aufgestellt sein muss, um die erreichten Vorteile von Einigkeit, Stabilität und Durchsetzungsfähigkeit nicht wieder zu entwerten durch bürokratische Ineffizienz - als internes Problem - oder durch Instrumentalisierung für Interessen des Status Quo. Dann stünde ihre Rolle als "ehrlicher Makler" für globale Umweltpolitik auf dem Spiel, was ihren Zielen sehr schaden könnte. Bei der Frage, wie eine Weltumweltorganisation konkret ausgestaltet sein könnte, verlegen sich Biermann / Simonis (2000, 175) vor allem auf drei Fragen:
- Abgrenzung des Themenfeldes, vor allem Bestimmung des Verhältnisses von Umwelt und Entwicklung
- Gestaltung der Entscheidungsverfahren im Interessenkonflikt von Nord und Süd
- Integration privater Akteure in öffentliche Politik
Themenfeld: Das Politikfeld des Naturschutzes kann nicht isoliert von der Entwicklungsproblematik gesehen werden. Der Tropenwald beispielsweise wird aus ökonomischer Notwendigkeit abgeholzt - für einen Schutz der Atmosphäre müssen darum auch ökonomisch angepasste Lösungen angeboten werden. Die von Simonis und Biermann vorgeschlagene Organisation heißt darum bewusst "Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung". (Biermann / Simonis 2000, 176). Eine Zusammenlegung von UNEP und des UN Development Programme (UNDP) würde auf den Widerstand der Entwicklungsländer stoßen, da die für die Entwicklungszusammenarbeit geschaffene UNDP auf diese Weise vielleicht für Interessen des Nordens (Mindeststandards-Problematik) instrumentalisiert werden könnte. Aber auch einer reinen Weltumweltorganisation würde der Süden ablehnend gegenüberstehen. Es käme also darauf an, die Interessen der Entwicklungsländer in der Organisation ansprechend zu repräsentieren.
Entscheidungsverfahren: In einer Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung müssten Interessen des Nordens und Südens eine gleichberechtigte Stellung eingeräumt werden. Für Abstimmungsverfahren stehen in seinen extremen Ausprägungen der Modus der UN-Vollversammlung zur Wahl (ein Land, eine Stimme), was den Entwicklungsländern die Macht zuerkennt, oder als anderes Extrem der Modus des Internationalen Währungsfonds (IWF) (ein Dollar, eine Stimme). Ein Ausgleich der Interessen ist am ehesten möglich, wenn Mehrheitsentscheidungen möglich werden, aber jeder Interessengruppe zugleich eine Veto-Position eingeräumt wird. Das heute übliche Konsensverfahren würde eine Großorganisation nur lähmen. Biermann / Simonis (2000, 177) halten die Regelung aus dem Ozonregime und für die GEF für ein erstrebenswertes Modell, in dem Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden, aber sowohl die Gruppe der Industrie- wie auch der Entwicklungsländer mit mindestens einfacher Mehrheit zugestimmt haben muss.
Private Akteure: Die Rolle nichtstaatlicher Akteure nimmt in der globalen Umweltpolitik stetig zu. Sie liefern kostengünstige Forschung, kontrollieren die Regierungen, sind für den Politikbetrieb wie auch für die Öffentlichkeit eine Informationsquelle und koppeln Regierungsvertreter auf Konferenzen an die Wirklichkeit des sozialen Lebens zurück (sinngemäß: Biermann / Simonis 2000, 178). Diese privaten Akteure sollten nicht mehr so stark vom Wohlwollen offizieller Stellen abhängig sein, die sie am Politikprozess beteiligen - oder nicht. Schwierigkeiten bestehen für die globale Umweltpolitik darin, dass die NGOs von Akteuren des Nordens und von wirtschaftsnahen Verbänden dominiert sind.
5 Kritik aus kooperationstheoretischer Sicht
Thomas Gehring und Sebastian Oberthür (2000) kritisieren den Ansatz von Biermann / Simonis (2000) aus spieltheoretischer ("kooperationstheoretischer") Sicht. Ihr Modell einer Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung könne nicht den Nachweis bieten, dass für eine globale Umweltpolitik tatsächlich eine zentrale Organisation nötig sei, die die bestehende Vielfalt der Regime ablöse. Gehring und Oberthür bestreiten schon die Annahme, dass eine Organisation automatisch bestimmte Leistungen besser erfüllen könne als andere weniger feste Institutionalisierungen. Darum müsse dies zuerst in der Theorie, dann an Beispielen gezeigt werden, wo eine zentrale Organisation für globale Umweltpolitik Vorteile bringe. Gehring und Oberthür selbst halten Regime für ausreichend und würden eine Weltumweltorganisation als Rückschritt sehen, die die knappen Ressourcen in der Umweltpolitik für Bürokratismus verschwende. Nach den Erkenntnissen der Kooperationstheorie (die im Gegensatz zur klassischen Spieltheorie nicht auf konfrontativen Situationen ausgeht, wie im Gefangenendilemma) bilden sich Institutionen, wenn Akteure von punktuellen Verhandlungen übergehen in längerfristige Koordinationsmechanismen, weil sie den Nutzen ihrer Kooperation erkannt haben. Die Grenze der Institution zur Organisation ist dann erreicht, wenn der Kooperationsrahmen eine gewisse Autonomie gegenüber seinen Mitglieder gewinnt (Gehring / Oberthür 2000, 190- 91). Legt man dieses Kriterium der Autonomie an, dann gibt es entgegen der Darstellung bei Biermann / Simonis (2000) z.B. bei den Verträgen über Ozonschutz und Walfang durchaus schon Organisationen sehen, da sie Sanktionen gegen ihre Mitglieder verhängen, und nicht mehr nur Regime. So gesehen wäre eine zentrale Organisation vielleicht gar nicht vonnöten. „In jedem Fall wäre es notwendig darzulegen, welche Teilprozesse innerhalb einer umfassenden Organisation besser ‚autonom’ ausgestattet werden können als im Rahmen sektoraler Institutionen.“ (Gehring / Oberthür 2000, 192).
Der Vergleich mit der Welthandelspolitik, die die WTO hervorgebracht hat, sowie zu Gesundheits- und Sozialpolitik, für die weltweit WHO und ILO zuständig sind, ist nach Gehring und Oberthür als Begründung nicht ausreichend. Die Entstehung von WHO und ILO lassen sich aus der Struktur ihres Politikfeldes herleiten, die für die Umweltpolitik nicht vorliegen. Denn weder sind in der Umweltpolitik Tauschgeschäfte wie im Handel möglich (reziproke Senkung der Zölle), noch sinken die Transaktionskosten wie in der Sozialpolitik, da umweltpolitische Themen recht vereinzelt behandelt werden müssen.
Prinzipiell bieten sich nach Gehring / Oberthür drei Arten von Institutionalisierungen an, die sich danach unterscheiden, wie stark das organisatorische Zentrum im Vergleich zu seinen einzelnen Elementen ist. Welches Modell Simonis und Biermann präferieren, bleibt dabei unklar, so dass alle drei Arten hinsichtlich ihrer behaupteten Vorteile Kooperation, Kapazität und Umsetzung (die drei "C"s erfolgreicher Regime: Cooperation, Capacity, Concern building). Die drei Modelle sind das UNO-, das WTO- und das EU-Modell.
- Das UNO-Modell lässt die einzelnen Regime unangetastet. Diese werden aber lose unter einem gemeinsamen Dach versammelt. Dieses Modell ließe sich relativ leicht durchsetzen, hätte aber nur geringe Folgen.
- Das WTO-Modell sieht vor, bestehende Umweltregime miteinander zu verkoppeln, was Synergie-Effekte ermöglicht, aber auch die Komplexität für Verhandlungen erhöht und somit auf Kosten der Flexibilität geht.
- Das EU-Modell schließlich löst bestehende Regime auf und ordnet sie von Grund auf neu. Dieses Modell hätte auf jeden Fall die Grenze von der Institution zur Organisation überschritten, die die Autonomie ihrer Mitglieder einschränkt. Aus diesem Grund erscheint sie unrealistisch, obwohl die Reibungsverluste zwischen den einzelnen umweltpolitischen Feldern minimieren würde.
Hinsichtlich der drei Kriterien Koordination, Kapazität (Finanzen) und Umsetzung könnte eine wirkliche Verbesserung - vor allem bei der Koordination, dem zentralen Argument von Simonis und Biermann -nur im EU-Modell erreicht werden. Dieses sei aber recht hierarchisch. Gehring / Oberthür bevorzugen eine mit Experten besetzte Kommission in den Regimen, die diese Aufgabe ebenso gut übernehmen könne, ohne einen großen Apparat zu erfordern. (Diese Argumentation ist widersprüchlich - was Gehring / Oberthür einem UN- oder WTO-Modell nicht zutrauen, weswegen zur Kooperation ein starkes Modell nötig wäre, soll dann sogar völlig ohne Dachorganisation möglich sein.)
6 Fazit
Wie Simonis und Biermann in einem sehr interessanten und innovativen Ansatz zeigen können, hat entgegen der heute weitverbreiteten Skepsis bezüglich supranationaler Organisationen (vgl. Offe, Scharpf, Grande, Streeck, Kielmannsegg etc. pp. zur EU) die Vergangenheit bewiesen, dass das Staatensystem durchaus zu Fortentwicklungen selbst auf globaler Ebene fähig ist. So wurden die UN-Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO), internationale Gerichtshöfe in Den Haag, Rom und Hamburg (letzteres für Schifffahrt) und die WTO (Welthandel, vorher GATT) ins Leben gerufen. Warum als nächstes nicht eine Weltumweltorganisation?
In diese Richtung bieten Simonis und Biermann wenig Analyse zum problematischen Verhältnis von Ökonomie, Politik und Ökologie, aber viele konkrete institutionelle Vorschläge für eine Überwindung eines organisatorisch zersplitterten Politikfeldes Umweltpolitik, das sich auf den Sprung von der nationalen zur globalen Ebene befindet. Ihre Vorschläge zu Koordination, Finanzierung und Implementation globaler Umweltpolitik sind zwar in eine weichzeichnerische Rhetorik eingebettet, die sich gegen jede Art von Weltregierung absetzt, aber weitreichende Kompetenzen für eine globale Organisation vorsehen. Simonis und Biermann diskutieren sogar eine mögliche Sanktionsmacht der Weltorganisation gegen Vertragsverstöße und eigene Geldquellen, die ihr die große Unabhängigkeit gewährleisten würde. Prinzipiell überzeugt ihr Ansatz schon mit dem Verweis auf die Familie der UN- Organisationen, in denen die Umweltpolitik bisher nicht angemessen repräsentiert ist, aber organisatorische Vorformen in Gestalt von machtlosen Koordinierungsstellen und Finanzinstituten existieren. Nichts scheint naheliegender als die wachsende Bedeutung ökologischer Themen, auch durch die Rio-Konferenz 1992, organisatorisch nachzuvollziehen.
So fruchtbar die Konzentration auf ein institutionelles Modell dann auch sein mag, so sehr rächt sich dann aber die Abstraktion von gesellschaftlichen Realitäten, wenn der geneigte Leser sich Gedanken um die Durchsetzbarkeit macht. Simonis und Biermann - wie auch Gehring und Oberthür - drücken sich um die zentrale Wahrheit und den zentralen Widerspruch der Umweltpolitik:
Eine konsequenteökologische Politik würde weitreichende Veränderungen in Politik und Gesellschaft erfordern. Dem entgegen steht die geringe Durchsetzungsfähigkeit der Umweltpolitik, was strukturell begründbar ist (Kap. 2 ) und die Erfahrung bestätigt.
Davon abstrahieren beide Autorenpaare in ihren Ansätzen weitgehend und verlegen sich auf Modellkonstruktionen, die keinen systematischen Bezug mehr zu der Herausforderungen der Umweltpolitik haben. Um einen solchen Bezug zwischen Organisationsmodell und Politikfeld herzustellen, wäre es nötig, Ziele der ökologischen Wende zu benennen, die Größe der Herausforderung abzuschätzen, Widerstände auszumachen und dann konkret aufzuzeigen, mit welchen institutionellen Innovationen die Widerstände auf dem Weg zum politischen Ziel überwunden werden können. Insoweit Brand u.a. (2000) ein mangelndes gesellschaftstheoretisches Fundament bei Global Governance- Ansätzen kritisieren und eine gewisse Blindheit gegenüber Herrschaftsaspekten attestieren, so ließe sich diese Kritik in gewisser Weise auf die beiden Ansätze zu einer Weltumweltpolitik - bzw, auf das Modell und seine Kritik - übertragen.
Simonis und Biermann deuten einerseits die Wünschbarkeit von Sanktionsmöglichkeiten für internationale Organisationen an und diskutieren ein Recht zur Besteuerung, befürworten zumindest unabhängige Geldquellen für ihre Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung, wehren sich aber andererseits explizit gegen jede Art von Weltstaatlichkeit, auch im Sinne eines nur schwach zentralisierten Föderalismus der Nationalstaaten. Dabei wäre eine Weltorganisation mit unabhängiger Finanzierung, aber ohne Kontrolle auf gleicher globaler Ebene weniger demokratisch legitimiert und sicher weniger durchsetzungsfähig als eine in ein globales Gerüst eingebettetes Umweltministerium in einem Modell globaler Staatlichkeit. Herrschaft im internationalen Raum scheint ohnehin besonders problematisch zu sein - vielleicht lebt auch die Fiktion der Souveränität, dass alle Staaten gleich seien. Folgerichtig plädieren Simonis und Biermann im globalen Kontext gegen Government, was sie als "Hierarchie" und "Herrschaft" deuten und unvorteilhaft mit Staat verbinden, und für Governance, was in den Augen der Autoren ohne Hierarchie zu funktionieren scheint und im herrschafts- und staatsfreien Raum stattfindet (vgl. Biermann / Simonis 2000, 166) zugunsten softer Politikformen: "Wie oben diskutiert, wäre es falsch, umfassende Durchsetzungsmechanismen für eine Weltumweltorganisation zu wünschen oder diese auch nur öffentlich zu fordern. Die organisatorische Reform würde 'im Rohr krepieren' und die Weltumweltpolitik zurückwerfen. Statt 'scharfer Zähne' sollte die Organisation 'weichere' Durchsetzungsmechanismen haben." (Biermann / Simonis 2000, 173).
Ohne viel Interpretation kann man den Autoren ein gestörtes Verhältnis zu Begriffen wie Macht und Herrschaft unterstellen, da es ihnen so schwer fällt, Umweltpolitik als das zu beschreiben, was es ist: ein politischer Kampf um Einfluss. Zu diesem Eindruck könnte man kommen, wenn sie der von ihnen geplanten Organisation in dem obigen Zitat möglichst wenig Macht wünschen. Dabei sind Simonis und Biermann eindeutig selbst als solche kämpfenden Lobbyisten der Umweltpolitik zu sehen, die eine "durchsetzungsfähige" Organisation auf der globalen Ebene errichten wollen, die zwar mit hierarchiearmen Mitteln wie konsenserzeugenden Netzwerken und marktwirtschaftlichen Instrumenten, aber dennoch wirkungsvoll gegen kurzfristige Interessenorientierung in Wirtschaft und Politik das Gegenbild einer ökologisch nachhaltigen Form der Produktion und Konsumtion durchsetzen will, die zugleich die Marginalisierung weiter Teile der Menschheit überwindet. Diese Absicht wird aber nicht als politisch progressiv und gegen den Status Quo gerichtet offen deklamiert, sondern hinter einer Anti-Weltregierungs-Rhetorik versteckt. Dabei wird verharmlost, wie weitreichend das eigene Modell ist. Tragende Elemente des Modells wie die Besteuerung des Weltfinanzmarktes und einer Umwidmung dieser Gelder für die ärmsten Länder werden von Simonis und Biermann als technische Petitesse besprochen. Tatsächlich würde es aber eine enorme Vermögensumverteilung im Weltmaßstab bedeuten in einem System, in dem die meisten Industrieländer nicht einmal die versprochenen 0,7 % des Bruttosozialprodukts in die Entwicklungszusammenarbeit investieren.
Auch Gehring und Oberthür argumentieren hinsichtlich der Machtaspekte sehr widersprüchlich, wie schon angedeutet. Bei der Diskussion geeigneter Organisationsmodelle stellen sie zum Beispiel fest, dass nur ein fester Verband nach Art der Europäischen Union die Durchsetzungskraft habe, um ambitionierte Ziele durchsetzen zu können. Andererseits beschreiben sie die Hoffnung auf eine solche Lösung als "utopisch", da sie "supranational" sei (Gehring / Oberthür 2000, 207). Eine Lösung, die gleichzeitig als nötig, aber auch als "utopisch" bezeichnet wird, sollte zumal bei Organisationstheoretikern Anlass genug sein, sich diesem offensichtlich zentralen Punkt zu widmen. Stattdessen brechen die Autoren an diesem Punkt ab und beschränken sich auf das "realistische".
7 Eigene Perspektiven
Aus der Sicht eines Weltstaatsansatzes (vgl. Yunker 2000, Brauer 1995, Narr/Schubert 1994 für Weltföderalismus, speziell für politische Ökologie vgl. Hempel 1996), wie ich selbst ihn für sehr fruchtbar halte, wird deutlich, dass die Herausforderungen der Ökologie ein zentrales Argument sind, um eine weltweite Staatlichkeit zu institutionalisieren.
- Effizienz: Ein Weltstaat kann die nötigen ökologischen Mindeststandards weltweit durchsetzen, weil er erstens rein technisch über die Mittel verfügt, mit Hilfe von Sanktionen für ihre Einhaltung zu sorgen, und zweitens seine Sanktionsmacht demokratisch legitimiert ist mit der Wahl der Legislative und Exekutive durch alle Menschen, die seine Regelung betreffen (Kongruenzprinzip der Demokratie).
- Solidarische Form: Ein Weltstaat organisiert nötige soziale Kompensationen für benachteiligte Regionen in einer solidarischen Form, die auch dem gleichberechtigten Modus entspricht, nach dem seine politischen Repräsentanten weltweit gewählt werden.
- Finanzierbarkeit: Die durch alle Menschen demokratisch legitimierte Steuerhoheit und die nichtvorhandene Exit-Option für multinationale Konzerne garantiert dem Weltstaat die erforderlichen Mittel
- Ökonomische Angepasstheit: Durch Ausschaltung eines Standortwettbewerbs für alle gemeinschaftsschädigenden oder inhumanen Politikfelder wird ein Strukturwandel befördert, der neue Chancen für ökologisch angepasste Produkte und Verfahren bringt. Die Förderung schwacher Regionen im Sinne eines globalen Keynesianismus schafft zunächst Kaufkraft für einfache Produkte, die den Süd-Süd-Handel befördern und eine selbsttragende Aufwärtsspirale ermöglichen, während langfristig eine insgesamt bessere Integration in den Welthandel für alle Teile der Erde erreicht werden.
Mit einem Wort: Ein Weltstaat könnte durch Ausschaltung des Standortwettbewerbs auf Kosten von Ökologie und Soziales (bei positiver Nutzung anderer marktimmanenter Dynamiken) eine Umweltpolitik auf globaler Ebene nach den Standards implementieren, die dem Stand moderner Politik in westlichen Industriestaaten entspricht. Ein Weltstaatsansatz tut dabei nicht so, als müssten Formen der Politik oberhalb der nationalstaatlichen Ebene neu erfunden werden, sondern überträgt nationalstaatliche Formen politischer Steuerung und demokratischer Teilhabe auf die globale Ebene (mit regionalen und lokalen Abstufungen). Das Problem der Größe wird durch weitestgehendes Empowerment vor allem der lokalen Ebene (Hempel 1996) bewältigt, wobei die jeweils übergeordneten Ebenen unterstützend und entlastend wirken müssen, wo möglich. (Nebenbei gesagt: Das Problem der Größe von 6 Milliarden Menschen gibt es in einem nationalstaatlichen System wie im globalen, da sich die reale Erde in keinem Ansatz verkleinert oder vergrößert. Nur glauben nationale Ansätze, das Problem es ignorieren zu können, dass "da draußen" auch noch Menschen und wahrhaft globale Probleme sind. Das Problem der Größe ist im Weltstaatsansatz entschärft, da durch Kooperation gelöst, nicht etwa verschärft, nur weil sich dem Problem überhaupt gestellt wird.)
So einfach der Grundgedanke eines Weltstaates vielleicht klingt - Standards westlicher Demokratien kulturell angepasst weltweit ausdehnen - so auffällig ist wieder einmal bei Simonis und Biermann, we viele Elemente von Staatlichkeit sie in ihr Modell einer Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung integrieren (Autonomie, Sanktion, Steuern, Wissensmonopol etc.), und wie konsequent die Autoren dies mit einer strikten Rhetorik gegen Staat oberhalb der nationalen Ebene verbinden. Die nationalstaatliche Fixierung der Politikwissenschaft geht einher mit einer Überbewertung globaler Probleme, wenn es um Institutionalisierung geht. Der Ansatz von Biermann und Simonis stellt sich der Problematik aber in sehr sachlicher und anknüpfenswerter Weise.
Literatur
Biermann, Frank (1998): Weltumweltpolitik zwischen Nord und Süd. Die neue Verhandlungsmacht der Entwicklungsländer, Baden-Baden
Biermann, Frank / Udo Ernst Simonis (1998): Plädoyer für eine Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung, Paper FS II 98-406 des Wissenschaftszentrums Berlin
Biermann, Frank / Udo Ernst Simonis (2000): „Institutionelle Reform der Weltumweltpolitik? Zur politischen Debatte einer ‚Weltumweltorganisation’“, S. 163-83 in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen
Brand, Ulrich / Achim Brunnengräber / Lutz Schrader / Christian Stock / Peter Wahl (1999): Global Governance. Alternative zur neoliberalen Globalisierung?, Münster
Brauer, Maja (1995): Weltföderation, Frankfurt/M
Commission on Global Governance (1995): Our Global Neighbourhood, Oxford
Gehring, Thomas / Sebastian Oberthür (2000): „Was bringt eine Weltumweltorganisation? Kooperationstheoretische Anmerkungen zur institutionellen Neuordnung der internationalen Umweltpolitik“, S. 185-211 in: Zeitschrift für internationale Beziehungen
Hauchler, Ingomar / Dirk Messner / Franz Nuscheler (Hg.) (1999): Globale Trends 2000, Frankfurt/M
Hempel, Lamont C. (1996): Environmental Governance. The Global Challenge, Washington
Kaul, Inge / Isabelle Grunberg / Marc A. Stern (1999): Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century, New York / Oxford
Messner, Dirk / Franz Nuscheler (1996): „Global Governance. Organisationselemente und Säulen einer Weltordnungspolitik“, S.12-36 in: dies. (Hg.): Weltkonferenzen und Weltberichte. Ein Wegweiser durch die internationale Diskussion, Bonn
Messner, Dirk / Franz Nuscheler (1999): „Strukturen und Trends der Weltpolitik: Neue Turbulenzen und anarchische Tendenzen“, S. 371-398 in: Hauchler u.a. 1999
Narr, Wolf-Dieter / Alexander Schubert (1994): Weltökonomie. Misere der Politik, Suhrkamp
Reinicke, Wolfgang (1998): Global Public Policy, Governing without Governance, Washington
Simonis, Udo Ernst (1998): „Institutionen der künftigen Weltumweltpolitik“, S.300- 32 in: Dirk Messner (Hg.): Die Zukunft des Staates und der Politik, Bonn
Simonis, Udo Ernst (Hg.) (1996):Weltumweltpolitik. Grundriss und Bausteine eines neuen Politikfeldes, Berlin
Simonis, Udo Ernst (1996a): „Prävention oder Katastrophe?“ S. 13-36 in: ders. (Hg.) (1996)
Simonis, Udo Ernst (1996b): „Klimaprotokoll - Zu den Verteilungsproblemen der Weltumweltpolitik“, S.37-61 in: ders. (Hg.) (1996)
Simonis, Udo Ernst (1996c): „Steuern, Joint Implementation, Zertifikate - Zum Instrumentarium der Weltumweltpolitik“, S. 102-118 in: ders. (Hg.) (1996)
Yunker, James A. (2000): "Rethinking World Government: a new approach", S. 3-33 in: International Journal on World Peace, Vol.17, No. 1 March 2000
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung - Globale Umweltfragen (2000): Jahresgutachten 2000, Berlin
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Globale Institutionalisierung der Umweltpolitik" von Dirk Hannemann?
Der Text befasst sich mit der Frage, ob und wie eine stärkere Institutionalisierung der Weltumweltpolitik erreicht werden kann. Er analysiert die Herausforderungen der globalen Umweltpolitik, die derzeitigen Institutionen und die potenziellen Vorteile einer zentralen Weltumweltorganisation.
Welche Probleme in der Umweltpolitik werden im Text angesprochen?
Der Text nennt mehrere Probleme, darunter mangelnde Koordination zwischen bestehenden Umweltorganisationen, unzureichende Finanzierung der globalen Umweltpolitik und Schwierigkeiten bei der Umsetzung politischer Ziele.
Welche Organisationen befassen sich derzeit mit globaler Umweltpolitik?
Der Text nennt vor allem drei Organisationen im Umfeld der Vereinten Nationen: UNEP (United Nations Environment Programme), GEF (Globale Umweltfazilität) und CSD (Kommission für nachhaltige Entwicklung), sowie Konventionssekretariate für spezifische Umweltverträge.
Welche Vorteile würde eine zentrale Weltumweltorganisation bringen?
Laut Simonis und Biermann könnte eine zentrale Organisation die Koordination verbessern, die Finanzierung stabilisieren und die Umsetzung globaler Umweltziele erleichtern.
Welche Kritik wird am Ansatz von Simonis und Biermann geübt?
Gehring und Oberthür kritisieren, dass Simonis und Biermann nicht ausreichend nachweisen, dass eine zentrale Organisation tatsächlich notwendig ist und Vorteile gegenüber bestehenden Regimen bietet. Sie argumentieren, dass bestehende Regime ausreichend sein könnten und eine Weltumweltorganisation Ressourcen für Bürokratismus verschwenden würde.
Welche Modelle der Institutionalisierung werden diskutiert?
Gehring und Oberthür diskutieren drei Modelle: das UNO-Modell (lose Sammlung von Regimen unter einem Dach), das WTO-Modell (Verkopplung bestehender Regime) und das EU-Modell (vollständige Neuordnung und Auflösung bestehender Regime).
Wie wird das Verhältnis von Umwelt und Entwicklung im Text behandelt?
Der Text betont, dass Umweltpolitik nicht isoliert von der Entwicklungsproblematik betrachtet werden kann. Die vorgeschlagene Weltorganisation soll daher "Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung" heißen.
Welche Rolle spielen private Akteure in der globalen Umweltpolitik?
Der Text erkennt die zunehmende Rolle nichtstaatlicher Akteure (NGOs) in der globalen Umweltpolitik an und betont, dass sie nicht zu stark vom Wohlwollen offizieller Stellen abhängig sein sollten.
Welche Entscheidungsverfahren werden für eine Weltumweltorganisation vorgeschlagen?
Biermann und Simonis schlagen vor, dass Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden sollten, wobei sowohl die Gruppe der Industrie- als auch der Entwicklungsländer mit mindestens einfacher Mehrheit zustimmen muss.
Welche Literatur wird im Text zitiert?
Der Text zitiert eine Reihe von Werken, darunter Arbeiten von Frank Biermann, Udo Ernst Simonis, Thomas Gehring, Sebastian Oberthür und anderen Forschern im Bereich der globalen Umweltpolitik.
Welche eigenen Perspektiven werden abschließend zur Thematik angeführt?
Ausgehend von einem Weltstaatsansatz wird argumentiert, dass die Herausforderungen der Ökologie ein zentrales Argument für die Institutionalisierung einer weltweiten Staatlichkeit sind, was Effizienz, Solidarität, Finanzierbarkeit und ökonomische Angepasstheit ermöglicht.
- Quote paper
- Dirk Hannemann (Author), 2001, Globale Institutionalisierung der Umweltpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105542