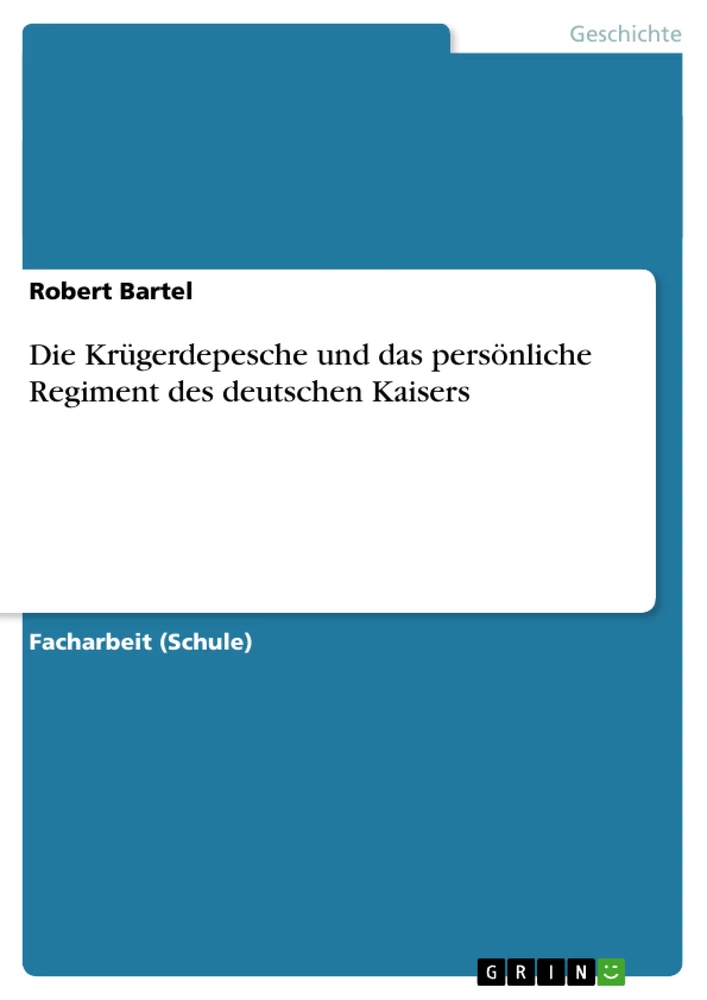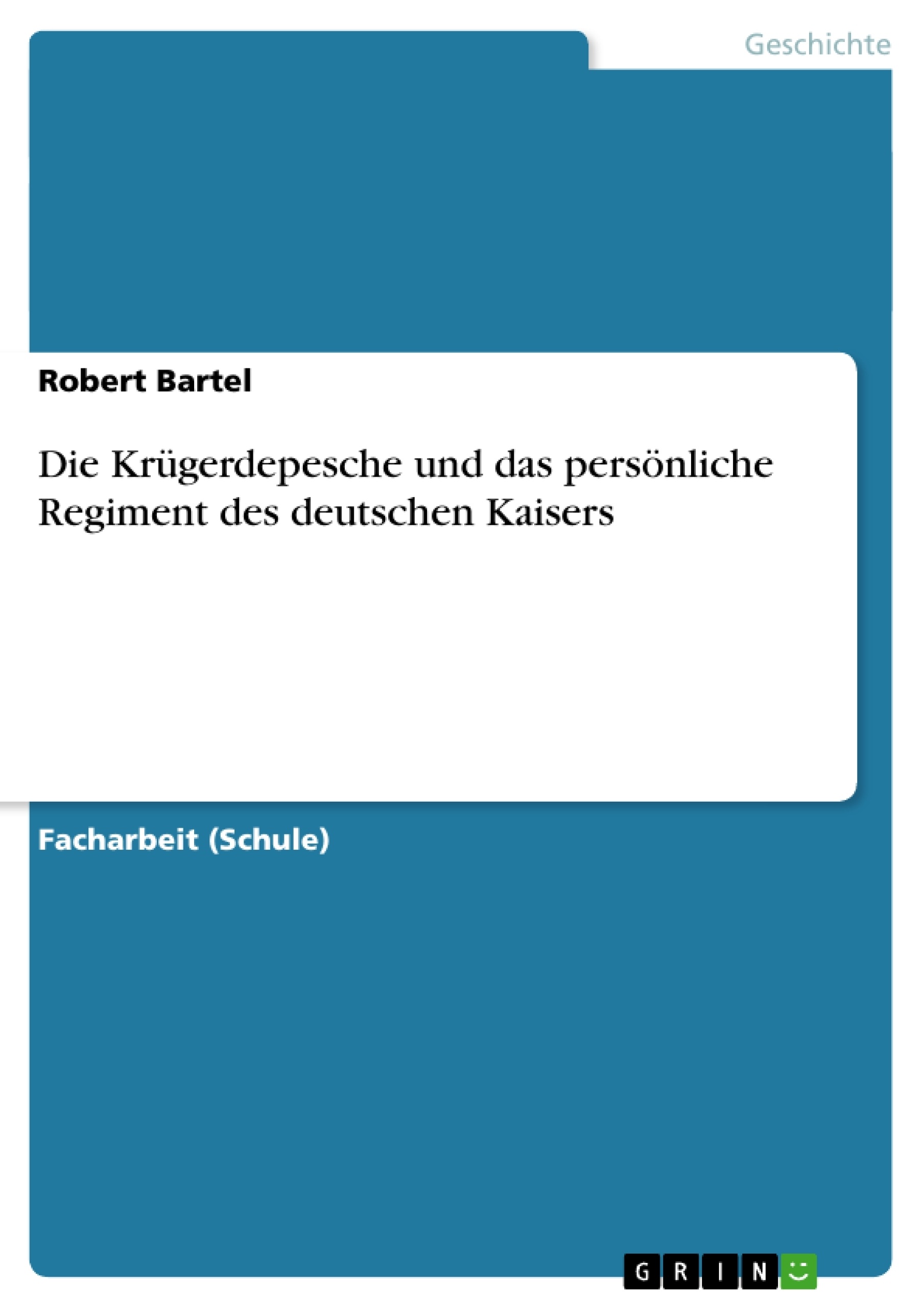Inhalt
Deckblatt
Schülererklärung
Einverständniserklärung
1. Einleitung
1.1 Schwerpunktsetzung meiner Facharbeit
2. Das persönliche Regiment
- kurze Biographie Kaiser Wilhelms II
- Annäherung an den Charakter Kaiser Wilhelms II
- der Neue Kurs
- das persönliche Regiment Kaiser Wilhelms II
3. Die Krügerdepesche
3.1 Kurze Historie zur Burenrepublik Transvaal
3.2 Die deutsch - burischen Beziehungen
3.3 Die deutsch - englischen Beziehungen
3.4 Der Jameson - Raid am 29. Dezember
3.5 Die Entsendung der Krügerdepesche sowie Gründe für ihre Entsendung
3.6 Bürgerliche und politische Reaktionen in Deutschland und England 14 auf die Krügerdepesche
3.7 Schlußbetrachtung: Die Krügerdepesche - Ein Beispiel wilhelminischer Politik ?
4. Anhang
4.1 Literaturverzeichnis
4.2 Behandelte Quelle
1.Einleitung
1.1 Schwerpunktsetzung meiner Facharbeit
Das Thema meiner Facharbeit lautet „ Die Krügerdepesche und das persönliche Regiment des deutschen Kaisers“. Ich werde den Schwerpunkt meiner Arbeit daher auf die Krügerdepesche aus dem Jahre 1896 legen, wie es zu ihr gekommen ist und welche Konsequenzen aus ihr entstanden sind. Das zweite wichtige Augenmerk gilt dem persönlichen Regiment Kaiser Wilhelms II., welches unmittelbar mit der Krügerdepesche verknüpft ist. Beginnen werde ich mit dem persönlichen Regiment, da es einen guten Einstieg in den Prozeß des Verstehens der Beweggründe für die anschließend behandelte Krügerdepesche gibt. Das Limit von 15 Seiten werde ich gemäß oben genannter Schwerpunktsetzung zu einem Drittel für das persönliche Regiment und zu zwei Dritteln für die Krügerdepesche aufwenden. Als Abschluß der Arbeit werde ich eine Schlußbetrachtung formulieren, die das Thema beurteilt sowie eine persönliche Beurteilung meiner Arbeit enthält.
2. Das persönliche Regiment
Kurze Biographie Kaiser Wilhelms II. und Annäherung an den Charakter Kaiser Wilhelms II.
Am 27. Januar 1859 wird Friedrich Wilhelm Victor Albert als erstes Kind des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, später Kaiser Friedrich III., und seiner Frau Viktoria, Princess Royal of England, im Kronprinzenpalais in Berlin geboren.1Friedrich Wilhelm wird von dem Kalvinisten Georg Hinzpeter erzogen. Von 1874 - 1877 besucht er das Gymnasium in Kassel - Wilhelmshöhe. Im Jahre 1877 nimmt er das Studium der Rechts - und Staatswissenschaften in Bonn auf. 1881 heiratet Friedrich Wilhelm Prinzessin Auguste Viktoria von Schleswig- Holstein - Sonderburg - Augustenburg. Aus der Ehe gehen sieben Kinder hervor. Als am 9. März 1888 sein Großvater Kaiser Wilhelm I. stirbt und ebenfalls kurz danach sein Vater, Kaiser Friedrich III., wird der Kronprinz Friedrich Wilhelm als Wilhelm II. Deutscher Kaiser und König von Preußen. Als er den Thron besteigt, waren die meisten Deutschen begeistert von Wilhelms Elan und Offenheit für neue Ideen. Ihm wurde eine Vielfalt von Interessen nachgesagt, ebenso ein nahezu unübertrefflicher persönlicher Charme.2Wilhelm war [Zitat] „ eine blendende Persönlichkeit, die faszinierend auf jeden wirkte, der ihm gegenübertrat.[...] Er konnte sich mit Geschäftsleuten, Archäologen, Vorsitzenden von Männergesangsvereinen, Direktoren von Dampferlinien, mit Theaterproduzenten und Kultusministern über deren Fachgebiete unterhalten und dabei lebendiges Interesse und eine beeindruckende Fülle von Kenntnissen an den Tag legen.“[Zitat Ende].3Seine gute, wenn auch nicht sehr tiefgehende Allgemeinbildung, seine rasche Auffassungsgabe, eine überdurchschnittliche rednerische Begabung und seine Fähigkeit, andere Menschen durch simple Liebenswürdigkeit zu gewinnen, wurden ihm sehr positiv angerechnet. Bei der Betrachtung seines Charakters fielen mir jedoch überwiegend negative Aspekte auf. Neben der autokratischen Veranlagung, die sich während der Regierungszeit immer stärker ausbildete, war Wilhelm II. gekennzeichnet durch Unlust zu gründlicher Arbeit, sogar als arbeitsscheu in Bezug auf Büroarbeit. Er zog es vor, sein Amt an der „frischen Luft“ auszuüben, auf unzähligen Festansprachen, Reisen durch sein Land sowie nach England, auf Denkmalseröffnungen oder Jagdexpeditionen. Jene Reisen und Ausflüge lassen sich mit seiner starken Ichbezogenheit verknüpfen. Sein Mangel an Ausdauer in der Verfolgung gesteckter Ziele macht nur eine Ausnahme in dem später zum Durchbruch gelangten Streben nach einer großen Kriegsflotte ( hierbei ist zu erwähnen, daß Wilhelm in dieser Angelegenheit eine starke Stütze in Admiral von Tirpitz hatte ).4Das Interesse, welches er stets vorgab, unterstützt von seinem Faktenwissen, erwies sich als reines Imponiergehabe. Daneben herrscht bei Wilhelm ein Mangel an Selbstdisziplin vor, verbunden mit der Freude an nicht lange überlegten, aber hochtönenden Worten. Ebenso groß wie die Freude an hochtönenden Worten ist seine Freude am übertriebenen militärischen Wesen, das sich in seinem Kleidungsstil und in der ganzen Art des Auftretens niederschlägt. Schon als Zwölfjähriger sah Friedrich Wilhelm vom Balkon aus, wie Wilhelm I. mit seinen Söhnen nach dem Sieg über Frankreich in Berlin „Unter den Linden“ eingezogen war.5Aus solchen Eindrücken entwickelte sich seine Begeisterung für das Soldatentum: Wilhelm versucht, trotz seiner Behinderung ( sein linker Arm war von Geburt an fast unbrauchbar ) schwere Kavalleriepferde zu reiten und führt in taktischen Übungen Truppenteile. Dabei zeigt sich sein strategisches Unverständnis und seine fehlende Kriegserfahrung, was jedoch Wilhelms Freude hieran keinen Abbruch tat, wiederum sehr zum Ärger der Militärs.6Hierdurch entsteht im europäischen Ausland das Bild eines [Zitat] „nach kriegerischen Lorbeeren strebenden Herrschers“7, während Wilhelms wirklicher Grundzug friedliebend war. Er wollte Deutschlands Macht zwar steigern, jedoch auf friedlichem Wege. Dabei war er, so Haselmayr, derart von romantischen Vorstellungen beherrscht, daß Politiker und Regierungsangehörige zeitweilig Zweifel an Wilhelms Geisteszustand hatten.8
Zur Veranschaulichung von Wilhelms Unlust zur Arbeit und seiner Vergnügungssucht möchte ich eine Quelle einbringen, die eine seiner Kreuzfahrten kurz beschreibt, die der Kaiser einmal jährlich mit seiner Yacht in nördlichen Gewässern machte. Wie auch sein Vorfahr König Friedrich Wilhelm I. wählte Wilhelm II. als Begleiter gute Freunde aus, mit denen er an Bord [Zitat] „endlose Diskussionen über ebenso phantastische wie nutzlose Themen führte [zu führen]“.9Die Quelle stellt einen Reisebericht dar, der von Alfred Kiderlen - Wächter aus Bergen verfaßt wurde und an seinen Freund Holstein im Außenministerium gerichtet war.
Quelle:
„...möchte ich für Sie persönlich noch einmal kurz meine Reiseeindrücke zusammenfassen. Leider sind sie in gewisser Beziehung nicht eben günstige: bei S.M. [Seiner Majestät] hat entschieden die autokratische Idee seit vorigem Jahre erheblich zugenommen. Das sic volo sic jubeo macht sich im Großen und Kleinen geltend. Und dabei - ganz unter uns gesagt - kein ernstes Prüfen und Abwägen der Verhältnisse, sondern das Sichhineinreden in eine Anschauung; wer dafür ist, wird dann als Autorität zitiert, wer anderer Ansicht ist, „läßt sich was weismachen“ Für Sie will ich aber doch noch eine kurze Erzählung beifügen, die ein Streiflicht auf Allerhöchste Ideen wirft: S.M. läßt sich einen Vollbart stehen, was zu den interessanteren Gesprächsthemata an Bord gehört: „Nun sind die Maler lackiert.“ „Die Stempel für die Zehn - und Zwanzigmarkstücke müssen geändert werden“, „man wird die Stücke ohne Bart sammeln.“ „Ja“, und dabei wurde auf den Tisch gehauen, „mit so einem Bart kann man auf den Tisch schlagen, daß die Minister nur so umfallen vor Schreck und auf dem Bauche liegen“!!! Kommentar überflüssig.“10
Ende der Quelle
Wie Alfred Kiderlen - Wächter hier anschaulich beschreibt, schien Wilhelm sehr viel Gefallen an solcher Art Reisen zu finden, die ebenfalls gut geeignet sind, um Wilhelms Lebenseinstellung und seinen Charakter zu veranschaulichen. Wilhelm hätte bis zu seinem Tod dieses Leben fortführen können.11Er war kein Mann, der als krisengeprüft, eventuell sogar mit Erfahrung auf dem Schlachtfeld auftreten konnte; vielleicht zog er allein schon deswegen das „leichte“ Leben dem politischen vor. Mir scheint, daß Wilhelm sein Defizit in Sachen Politik bewußt war, was eventuell ein Grund sein könnte, weshalb er, wie später noch beschrieben, in politischen Angelegenheiten schließlich seinen Ministern Recht gab, sich ihnen fügte. Man kann nicht sagen, daß er sich, seinem Defizit bewußt, auf Dinge beschränkte, die er gut konnte, sei es Einweihung eines neuen Denkmals oder eine Festtagsansprache - also reine Ausübung der Symbolfunktion des Kaisers - er versuchte schon, seine Politik durchzusetzen. Dieses Thema wird ebenfalls später ausführlicher beschrieben.
Jene Kreuzfahrten dauerten meistens sehr lange, deswegen stellte das Außenministerium Beamte ab, die Wilhelm im Falle einer plötzlichen Krise beraten sollten. Während diesen Kreuzfahrten nahm sich der Kaiser ebenfalls Zeit, neue politische Strategien zu entwickeln, deren sofortige Durchsetzung er nach seiner Wiederankunft forderte. Daß dabei eventuelle Absprachen mit Parteien beeinträchtigt wurden oder politische Arbeiten der Minister von Monaten zerstört wurden, kümmerte Wilhelm nicht.12
Neuer Kurs und persönliches Regiment Wilhelms II.
Der Neue Kurs, eingeleitet durch die Abdankung Fürst Otto von Bismarcks, kennzeichnet unter anderem die Regierungszeit Kaiser Wilhelms II. Wilhelm traute es sich zu, ohne Kanzler auszukommen, da er aber verfassungsmäßig („Kanzlerverantwortlichkeit“) an einen Reichskanzler gebunden war , entschied er sich für einen Soldaten, von dem er den gleichen militärischen Befehlsgehorsam im zivilen Amt erwartete.13Es handelte sich um Graf von Georg Leo Caprivi, der den Rang eines Generals innehatte. Caprivi war von Bismarck als [Zitat]„besonders geeignet zum preußischen Ministerpräsidenten“14bezeichnet worden, allerdings dachte Bismarck an einen Ministerpräsidenten an seiner Seite, ohne ihm die Leitung der Außenpolitik anzuvertrauen.
Außenpolitisch sah der neue Kurs eine Abkehr von Rußland und Hinwendung zu England vor; der Rückversicherungsvertrag mit Rußland, den Bismarck noch geschlossen hatte, wurde nicht erneuert. Deutschland schloß mit England den Helgoland - Sansibar Vertrag ab, in dem Deutschland England das Protektorat über die Insel Sansibar und deren Nebeninseln einräumte. Des weiteren trat Deutschland das Sultanat Witu und den deutschen Teil der Somaliküste an England ab. Im Gegenzug trat England die Insel Helgoland an Deutschland ab und gewährte für Deutsch - Südwestafrika den Zugang zum Sambesi, den sogenannten „Caprivi - Zipfel“. Die Grenze zwischen Togo und der britischen Goldküste wurde reguliert und England der abgabenfreie Durchzug durch Deutsch - Ostafrika gewährt.15Das Ende des neuen Kurses zeichnete sich 1894 ab, als Reichskanzler Caprivi aus dem Amt schied.16
Wilhelm II. faßte das Kaisertum von Anfang an als Symbol der Nation und Reichsmonarchie von Gottes Gnaden auf.17Wie schon erwähnt, waren die meisten Deutschen begeistert von der Person Wilhelms II. Fehrenbach umschreibt dies in ihrem Buch unter anderem wie folgt: „Wilhelm II. erfüllte ein Begehren der Zeit, als er es unternahm, dem Kaisertum in seiner Person eine glanz- und ausschlaggebende Stellung im Reich und in der Welt zu schaffen.“.18 Daß der Kaiser einen Machtanspruch im deutschen Kaiserreich hatte, war in der Verfassung nicht festgehalten, jedoch setzte sie dem Machtanspruch auch keine eindeutigen Grenzen. Die Berechtigung für das persönliche Regiment lag in der gefühlsmäßigen Geltung der Kaiseridee. Sie war in einem Kaiser als glänzende Persönlichkeit schlicht besser verkörpert als in einem farblosen konstitutionellem Herrscher.19So machte Wilhelm auch keinen Unterschied mehr zwischen dem Kaiser als nationalem Symbol und dem Kaiser als unbeschränktem Führungsorgan des Reiches. Elisabeth Fehrenbach ist jedoch der Überzeugung, daß das persönliche Regiment bloße Fiktion sei.20Es erschöpft sich auf gelegentliche Eingriffe in die Arbeit der Minister, die dies als schwere Belastung für dieselbige ansahen. Im Ernstfall hatte der Kaiser stets nachgegeben, so auch geschehen bei der Übersendung der Krügerdepesche statt einer Entsendung von zwei Seebataillonen nach Transvaal, wie der Kaiser es zunächst vorsah.21Ebenfalls wie Fehrenbach ist Haselmayr der Ansicht, der Kaiser führe kein persönliches Regiment, dazu sind die mit der Außenpolitik betrauten Personen zu selbstständige Naturen,22doch liegt das Übergewicht der Außenpolitik beim Kaiser, da dieser in der Lage ist, den Kanzler allein zu bestimmen.23Um ein persönliches Regiment durchsetzen zu können, bedurfte es Wilhelm eines schwachen Kanzlers, den er in Fürst Chlodwig zu Hohenlohe - Schillingsfürst fand und diesen 1894 zum Kanzler machte. Der fünfundsiebzigjährige Herr, den Wilhelm liebevoll wie respektlos „Onkel Chlodwig“ nannte, würde Wilhelms Meinung nach bei der Erledigung der Geschäfte nicht stören.24
Isabel V. Hull schreibt in ihrem Buch von vier verschiedenen Deutungen des Begriffs „Persönliches Regiment“.25Die erste, populärste Deutung stammt vom Kaiser selbst, der sein Königtum „von Gottes Gnaden“ auffaßte, es sei nur einer „Herr im Reich, keinen anderen dulde ich“ und „suprema lex regis voluntas“[oberstes Gesetz ist der Wille des Königs].26In dieser Deutung bedeutet „Persönliches Regiment“ eigentlich nur die gelegentliche oder unerwartete Einmischung des Kaisers aufgrund von Gefühlswallungen, unkontrollierten Emotionen, die den ruhigen Gang der Politik störten.27Die zweite Deutung hängt eng mit der ersten zusammen. Sie prangert den Freiraum an, den die Verfassung dem Kaiser gebietet. Der Reichstagsabgeordnete Wiemer bezeichnete dies sogar als Form des Absolutismus.28Es sei [Zitat] „ein gefährliches Zeichen für Deutschlands politische Zurückgebliebenheit“29[Zitat Ende], das sich nur durch die Umformung des Kaisers zu einer reinen Symbolfigur des Reiches beseitigen lasse; des weiteren müßten die Minister dem Reichstag und nicht dem Kaiser verantwortlich gemacht werden.30
Die dritte Deutung befürwortete den „Quasi - Absolutismus“31und damit einen energischen Kaiser, der die instabile Einheit nach innen verkörpern sollte und nach außen den Aufstieg zur Weltmacht steuerte.32Auch Kaisergegner wie Maximilian Harden hatten nur Einwände gegen Mittel und Wege der kaiserlichen Politik, jedoch nicht gegen ihre Ziele:[Zitat] „Von ihm [dem Kaiser] sind alle wichtigen politischen Entscheidungen der letzten zwölf Jahre ausgegangen.[...] Seine Ziele waren fast ausnahmslos richtig erkannt, seine Mittel und Wege nicht glücklich gewählt“33[Zitat Ende].
Die vierte Deutung teilt sich in drei nicht - kaiserliche Interpretationen des „Persönlichen Regiments“: Die erste ist eine zeitgenössische Beschreibung der damaligen Regierungsrealität, ein Mißerfolg, verursacht durch kaiserliches Eingreifen . Zweitens: Eine eher historisch - politische Erklärung, die das „Persönliche Regiment“ als „Quasi - Absolutismus“ auffaßt. Drittens: Das persönliche Regiment als Hoffnung, durch neue Möglichkeiten damalige Probleme zu lösen. Diese Hoffnung scheiterte leider an der Unfähigkeit des Kaisers.34
Am Ende des Kapitels kommt Isabel V. Hull zu dem Schluß, daß das persönliche Regiment real existierte und nicht wie von Elisabeth Fehrenbach beschrieben, eine bloße Fiktion war.35
3. Die Krügerdepesche
3.1 Kurze Historie zur Burenrepublik Transvaal
Transvaal, heute eine Provinz im Nordosten der Republik Südafrika mit der Hauptstadt Pretoria, umfaßt die Gebiete Nord- und Osttransvaal. Die Hauptstadt von Nordtransvaal ist Pietersburg, die von Osttransvaal Nelspruit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Gebiet von den sogenannten Buren besiedelt, welche Nachkommen der deutschen und niederländischen Siedler waren. Sie gründeten kleine Staaten, die 1858 zur Südafrikanischen Republik zusammengeschlossen wurden. Von 1877 bis 1881 war das Gebiet von den Briten annektiert, bis es im Jahre 1884 als selbstständig anerkannt wurde. Im Jahre 1883 wurde Paul Krüger Staatspräsident. 1886 wurde im Gebiet von Witwatersrand eine große Goldmenge entdeckt, die den Zustrom vieler Briten nach sich zog. Die Briten waren bald darauf gegenüber den Buren in der Überzahl und forderten eine Beteiligung an der Regierung, bis es 1895 zum Jameson - Raid kam.36
3.2 Die deutsch - burischen Beziehungen
Wie später noch ausführlicher beschrieben, war die deutsche Industrie in Transvaal stark vertreten, aufgrund der Gold - und Diamantvorkommen war die deutsche Regierung an der Erhaltung der damaligen Situation ( unabhängige Republik Transvaal ) interessiert. England betrachtete Transvaal seiner Einflußsphäre gehörig37und hegte Interessen an der Republik. Die imperialistischen Strebungen Englands in Afrika richten sich auf den Ausbau einer Nord - Süd Achse, während sich die Deutschen eher auf eine Ost - West Achse konzentrierten.38 Das Deutsche Reich beginnt, Auswanderungen nach Südafrika zu fördern. In Johannesburg siedeln sich etwa 15 000 Deutsche an, die bald wichtige Führungspositionen in Politik und Wirtschaft der Burenrepublik einnehmen.39Die Südafrikastrategie des Deutschen Reiches stützt sich jetzt stark auf die „Deutschtumspflege“, die auch der Alldeutsche Verband propagiert.40Gegründet im Jahre 1891 aufgrund des angeblich für Deutschland nachteiligen Helgoland - Sansibar Vertrags, steht der Verband für eine expansive Außen-, Flotten- und Kolonialpolitik. Der Alldeutsche Verband gibt vor, überparteilich zu sein, steht in Wirklichkeit aber unter rechtsradikalem Einfluß mit der Forderung nach einem „großgermanischen Mitteleuropa“.41Nach der Krügerdepesche verbessern sich die deutsch - burischen Beziehungen, Staatspräsident Krüger verläßt sich auf die Deutschen im Jahr 1899, als die Buren den in Transvaal lebenden Briten das Eingeständnis politischer Rechte verweigern.
3.3 Die deutsch - englischen Beziehungen
Das deutsch - englische Verhältnis stellt beispielsweise neben dem deutsch - französischem oder deutsch - russischem Verhältnis einen Sonderfall dar, denn es wurde durch fast alle Probleme, die es in der Welt gab, in irgend einer Weise berührt. Als das deutsche Reich begann, in der Welt als Kolonial- und Handelsmacht aufzutreten, brachte dies eine Spannung in die deutsch - englischen Beziehungen. Die Deutschen begannen, sich für typisch englische Geschäfte zu interessieren, die nun einmal der globale Warenhandel und Kolonialpolitik waren. Zumal wurde der Handel für die Deutschen wichtiger und war fähig, mit dem englischen wettzueifern.42Der Aufstieg Deutschlands in Kommerz und in der Wirtschaft löste in England Unbehagen aus. Die deutschen Kolonialinteressen kreuzten sich oft mit denen Englands, was das Verhältnis ebenfalls negativ beeinflußte. Beispiele dafür waren Ostasien, Samoa, Kongo, Marokko, Persien, Türkei und Südafrika.43
Ebenso wurde das deutsch - englische Verhältnis stark durch Deutschlands Flottenpolitik belastet. In der Mitte der neunziger Jahre begann Deutschland, seine Hochseeflotte massiv aufzurüsten, um mit England auf See konkurrieren zu können. Dabei beschränkte sich Deutschland nicht auf Verteidigungseinheiten, die die Überseebesitztümer beschützen sollten, sondern baute auch Angriffseinheiten.44Das deutsche Flottenprogramm war von Anfang an gegen England gerichtet, es gab sogar eine ausgearbeitete Strategie, die Deutschland verfolgen wollte: Die Bedrohung seitens der deutschen Flotte gegenüber der englischen Seemacht sollte so groß sein, daß England im Falle eines Krieges Flottenverbände aus aller Welt zurückrufen mußte, um es mit der deutschen Flotte aufnehmen zu können.45Es liegt auf der Hand, daß solche Planungen den Engländern anhand der schnell ansteigenden Tonnage der deutschen Flotte nicht vorenthalten werden konnten und die Engländer sich zu Recht bedroht fühlten. Weiterhin ist klar, daß England langsam, aber sicher das Vertrauen zu Deutschland verlor. England beobachtete mit Sorge den deutschen Werdegang. Das Vertrauen zum „Englandfreund“ Kaiser Wilhelm II. verflog spätestens mit Entsendung der Krügerdepesche 1896.
3.4 Der Jameson - Raid am 29. Dezember 1895
Am 29. Dezember 1895 fiel Dr. Leander Starr Jameson, ein britischer Arzt und Leiter einer Handelsgesellschaft (Chartered Company), mit einer Truppe von ca. 500 Mann in die Burenrepublik Transvaal ein, um einen Aufstand zu unterstützen, der von Ausländern und Briten angezettelt worden war. Ziel des Aufstands war es, Transvaal in eine von Cecil Rhodes angestrebte südafrikanische Union einzugliedern und so das goldreiche Land für England zu gewinnen.46Cecil Rhodes, Ministerpräsident der Kapkolonie, hatte die von Jameson befehligte Truppe privat finanziert. Der Überfall scheiterte völlig. Vier Tage nach Beginn des Unternehmens, am 2. Januar 1896, wurde Jameson mit seiner Truppe von den Buren festgenommen sowie der Aufstand in Johannesburg niedergeschlagen. Die führenden Männer des Aufstands wurden ebenfalls überführt und festgenommen. In England wußte man von dem geplanten Überfall, mißbilligte ihn aber von Anfang an. Lord Salisbury, englischer Ministerpräsident, und Josef Chamberlain, englischer Kolonialminister, waren von einem Gelingen des Unternehmens nicht überzeugt. Cecil Rhodes gab nach dem Scheitern des Überfalls sofort seinen Rücktritt als Ministerpräsident bekannt.47Ich vermute, daß Cecil Rhodes, der bereits mit 19 Jahren ein beträchtliches Vermögen durch Diamantengeschäfte gemacht hatte,48nicht nur im nationalen Interesse von England handelte, als er Jameson finanziell unterstützte, sondern auch in seinem eigenen Interesse. Rhodes Lebenstraum war es, die führenden Diamantminen von Südafrika fusionieren zu lassen. 1888 gründete er die De Beers Consolidated Diamond Mines. Hierdurch war praktisch die gesamte Diamantproduktion von Kimberley (in Kimberley wurden 1870 Diamantfelder entdeckt) monopolisiert. Er teilte diesen Traum mit Alfred Beit, einem deutschen Bankier und Diamantenhändler, der 1875 nach Afrika gegangen war und zu einem der mächtigsten Minenbesitzer wurde. Alfred Beit war ebenfalls an der Finanzierung Jamesons beteiligt.49
Also war Jamesons Ziel, die Burenregierung in Transvaal zu stürzen und Transvaal so in eine südafrikanische Union einzugliedern, sehr im Sinne von Rhodes, der mittlerweile eine weitere Gesellschaft, die British South Africa Company „Chartered“ gegründet (1889) hatte50. 1889 hatte Rhodes einen Freibrief für die Gründung dieser von der britischen Regierung erhalten, um die Entwicklung in diesem Gebiet voranzutreiben.51
3.5 Die Entsendung der Krügerdepesche sowie Gründe für ihre Entsendung
Friedrich Haselmayr bezeichnet die Krügerdepesche als [Zitat] „einen der weltpolitisch bedeutsamsten Vorgänge der Ära des Flottenkaisers“52[Zitat Ende]. Derart erbost über den englischen Überfall, äußerte Wilhelm II. die Absicht, Transvaal unter deutsches Protektorat zu stellen und die Marineinfanterie (zwei Seebataillone) zu entsenden. Ebenfalls sollte der bisherige (1893 - 1895) Gouverneur von Deutsch - Ostafrika, Oberst Schele, zur Erkundung der für die Buren notwendige Hilfe entsandt werden.53Gegen diesen Plan wehrten sich jedoch Staatssekretär Marschall und Reichskanzler Hohenlohe erfolgreich, da sie befürchteten, daß diese Maßnahmen den Krieg mit England herbeiführen könnten.54Jameson war zu diesem Zeitpunkt schon festgenommen und der Aufstand niedergeschlagen, deswegen ließ sich der Kaiser zur Entsendung eines Telegramms bewegen, wenn auch nur ungern. Die wesentlichen Bestandteile des Telegramms sollten die Darlegung des deutschen Standpunkts zur Transvaalfrage und die Gratulation zur Abwehr von Jameson sein.55Es wurde von Kolonialdirektor Kayser entworfen und von Marschall in einem Punkt abgeändert. Hier der entsendete Wortlaut:
„Ich spreche Ihnen Meinen aufrichtigen Glückwunsch aus, daß es Ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit Ihrem Volke gelungen ist, in eigener Tatkraft gegenüber den bewaffneten Scharen, welche als Friedensstörer in Ihr Land eingebrochen sind, den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren. Wilhelm I.R.“56
Das Telegramm trug die Unterschrift des Kaisers, des Kolonialdirektors Mayer und des Staatssekretärs Marschall, wodurch es verfassungsgemäß zum Staatsakt wurde, für den der Reichskanzler und der Staatssekretär die Verantwortung trugen.57
Daß es in Transvaal große Gold- und Diamantvorkommen gab, lieferte nicht den einzigen Grund für die deutsche Reaktion. Die Republik Transvaal war enger mit dem deutschen Kaiserreich verbunden als andere ausländische Gebiete. Das Whisky - und Dynamitmonopol war fest in deutscher Hand, ebenso kontrollierten Deutsche die Nationalbank, beherrschten die Wasserversorgung und importierten Eisen, Stahl, Chemikalien, Maschinen und Werkzeuge. Deutsche Unternehmen wie Krupp, Siemens und Halske, Goerz, Lippert und die Deutsche Bank hatten Filialen in Transvaal. Zwanzig Prozent des gesamten im Lande investierten ausländischen Kapitals war in deutschem Besitz.58Daher war es der deutschen Regierung nicht gleichgültig, was mit Transvaal geschah, und der von Jameson versuchte Umsturz des Staatspräsidenten Krüger berührte ganz klar deutsche Auslandsangelegenheiten.
Des weiteren ist zu erwähnen, daß der Kaiser selbst bei Aufnahme der Nachricht vom Überfall Jamesons höchst gereizt war, da er am 1. Januar 1896 eine Diskussion mit dem Kriegsminister Bronsart von Schellendorf über das Militärgerichtsbarkeitsgesetz geführt hatte.59Im Laufe dieser Diskussion hatte Wilhelm den Minister aufs Schwerste beleidigt; später entschuldigte er sich vor Zeugen für seine Beleidigung.60Der Kriegsminister von Schellendorf äußerte gegenüber Reichskanzler Hohenlohe Besorgnis für Wilhelms Geisteszustand und für die nahe Zukunft.61Wilhelms äußerst heftige Reaktion auf die Nachricht des Überfalls ist vermutlich mit diesem Ereignis verknüpft.
3.6 Bürgerliche und politische Reaktionen in England und Deutschland auf die
Krügerdepesche sowie Verschlechterung der deutsch - englischen Beziehungen Die Reaktionen, die in England und Deutschland hervorgerufen wurden, bildeten einen totalen Gegensatz. Während in Deutschland pure Begeisterung und Zustimmung für die Krügerdepesche herrschte, brach in England größte Erregung aus. Das englische Volk reagierte mit schärfster Ablehnung und Wut. Deutsche Angestellte in England wurden entlassen, die Schaufenster deutscher Geschäfte wurden zertrümmert und deutsche sowie holländische Marinesoldaten verspottet.62Die englische Presse beschuldigte Deutschland, feindselige Absichten gegen England zu schüren, und nur auf eine passende Gelegenheit gewartet zu haben, diese öffentlich zu zeigen.63Die Krügerdepesche wurde in England als Einmischung in private Angelegenheiten gesehen und bestätigte den Engländern die Mutmaßung von einem Komplott der deutschen Regierung und Staatspräsidenten Krüger gegen die Engländer.64
Die englische Regierung hingegen blieb gelassen, dennoch ordnete sie die Bildung eines fliegenden Geschwaders bestehend aus sechs Kriegsschiffen an. Dieses sollte für Sonderaufgaben zur ständigen Verfügung stehen.65Zur Entspannung der Lage trug ein Antwortbrief Kaiser Wilhelms auf einen Brief der Königin Viktoria bei, in dem sie sich zur Krügerdepesche äußerte.66Kaiser Wilhelm schrieb gemeinsam mit Reichskanzler Hohenlohe am 8. Januar 1896, daß sich sein Telegramm nur gegen die Rebellen gerichtet hätte, die nicht im Willen der Königin gehandelt hätten. Niemals war dieses Telegramm als feindseliger Akt gegen England gemeint gewesen; des weiteren habe ihn die englische Presse total mißverstanden.67
Eine schwerwiegende Folge der Krügerdepesche war, daß die Engländer die Unzulänglichkeit ihrer Politik der „splendid isolation“ [glänzenden Isolierung] erkannten und bei ihnen das Bedürfnis erweckte, Freunde, wenn nicht gar Alliierte zu finden.68So kam die englische Regierung den Vereinigten Staaten von Amerika in der Angelegenheit der Grenzfrage von Venezuela und Britisch - Guayana weit entgegen. Die Verhandlungen dauerten zwar sehr lange, aber als am 3. Oktober 1899 der Vertrag über die Grenzfrage unterschrieben wurde, bedeutete dies das Ende der mehr als hundert Jahre dauernden Spannungen zwischen England und USA.69Daher war dies eine schwerwiegende Folge für Deutschland, die sich 18 Jahre später, bei Kriegseintritt der USA in den 1. Weltkrieg, zeigte.
In Deutschland herrschte, wie schon erwähnt, eine Hochstimmung wie lange nicht zuvor. Die Freude, daß Jamesons Einfall gescheitert war und Transvaal seine Unabhängigkeit behaupten konnte, verführte das deutsche Volk geradezu in einen ungeahnten Freudentaumel. Daneben näherte sich der 25. Jahrestag der Reichsgründung (Januar 1896), was die nationale Hochstimmung zusätzlich beflügelte. Wilhelm nutzte diese Situation und hoffte, im Reichstag Zustimmung zu einer beträchtlichen Kreuzerverstärkung der Flotte zu finden.70Ebenfalls zu der deutschen Sicht der Situation habe ich als Quelle ein Privattelegramm Holsteins (Außenministerium) an den deutschen Botschafter Hatzfeldt in London (siehe Anhang Seite 19) ausgewählt . Holstein scheint sehr interessiert daran zu sein, daß für alle Nationen, besonders für England, Deutschlands Ziel, nämlich Erhaltung des Status quo in Transvaal, ersichtlich wird. Er betont im vierten Satz, daß nur Hatzfeldt als deutscher Botschafter in London Informationen über Transvaal bekommen habe. Also sollte auf keinen Fall der Anschein erweckt werden, Deutschland suche Hilfe außerhalb. Das Telegramm macht auf mich einen Eindruck, als sei es geschrieben worden, um weitere außenpolitische Schäden zu vermeiden. Deutschlands Interesse in dieser Angelegenheit ist jetzt gestillt ( vgl. zweiter Satz: „Der Status quo scheint jetzt gewahrt zu sein“71). Nun will Holstein die Angelegenheit für beendet sehen, in seinem Privattelegramm an Hatzfeldt bezeichnet er die Depesche als „kleinen diplomatischen Erfolg für Deutschland“ und als „kleine politische Lektion für England“.72Diplomatischer Erfolg für Deutschland, weil das Volk auf die Depesche äußerst positiv reagierte und England Deutschlands Interessen klarer wurden. Politische Lektion für England, weil Deutschland sich klar gegen die englische Kolonialpolitik aussprach und ebenfalls gegen die Mittel, die England benutzt, um diese Politik zu realisieren, auch wenn die englische Regierung nicht mit dem Vorgehen Jamesons in Südafrika einverstanden war. Dies scheint mir jedoch in diesem Privattelegramm in den Hintergrund gerückt zu sein, da Holstein von einer politischen Lektion für England spricht und damit den Anschein erweckt, als meine er ganz England. Überhaupt scheint es, daß die Tatsache jener Ablehnung des Überfalls seitens der englischen Regierung in Deutschland nicht sehr ernst genommen wurde, schon gar nicht vom deutschen Volk. Der Übeltäter war England, Engländer waren es, die Krüger stürzen wollten und Engländer waren es, die den Aufstand in Johannesburg anzettelten. Der Antwortbrief von Kaiser Wilhelm II. an die Königin Viktoria stellte zwar klar, wie die Depesche gemeint war, jedoch schienen sich die englischen Bürger persönlich beleidigt zu fühlen, ebenso wie die Deutschen „Engländer“ und nicht Jameson und Rhodes für den Überfall verantwortlich machten.
3.7 Schlußbetrachtung: Die Krügerdepesche - Ein Beispiel wilhelminischer Politik ?
Die Krügerdepesche als Beispiel für jene Politik anzuführen, die zur Zeit Wilhelms II. von Deutschland betrieben wurde, ist sicherlich nicht falsch. Denn sie verdeutlicht, personifiziert geradezu die wilhelminische Außenpolitik. Wilhelm II., der in meinen Augen eher aus persönlichen Gründen gehandelt hat (unkontrollierte Empörung über die Engländer), faßte sofort kühne Pläne, um auf diesen hinterhältigen Überfall Jamesons zu reagieren. Eine Flottenentsendung, die Idee, Transvaal unter deutsches Protektorat zu stellen, spiegeln Wilhelms Charakter nahezu perfekt wider. Mit einer völlig überzogenen wie unüberlegten Reaktion will er den Engländern und dem Rest der Welt beweisen, daß das deutsche Kaiserreich so nicht mit sich umspringen läßt. Seine Minister Reichskanzler Hohenlohe und Staatssekretär Marschall fürchteten bei Umsetzung dieser gewagten Ideen den Krieg mit England, auf den Deutschland 1896 nur hätte schlecht reagieren können. Wilhelms Idee, einen Krieg gegen England zu führen, der in seinen Augen auf [Zitat Craig] „wundersame Weise nicht auf das Meer übergreifen oder die europäische Situation berühren würde“73[Zitat Ende] war natürlich eine vollkommen absurde, die durch den Vorschlag des Telegramms ja erfolgreich abgewendet wurde. Wilhelm ging nur ungern auf diesen Vorschlag ein, was meiner Meinung nach bedeutet, daß es ihm in erster Linie darum ging, seiner Wut und Empörung Ausdruck zu verleihen. Keinesfalls war seine ursprüngliche Idee einem nüchternen und rationalen Gedankengang entsprungen, sondern, wie schon gesagt, einer völlig unkontrollierten Emotion. Als ich in verschiedenen Büchern über Wilhelms Reaktion auf den Überfall las, erinnerte er mich, mag es auch ein wenig lächerlich klingen, kurzzeitig an ein kleines Kind, welches aus spontaner Wut einen unschuldigen Gegenstand zerstört. Insofern ist die Krügerdepesche ein gutes Beispiel für die Politik unter Wilhelm II., da sie erstens Deutschlands wachsende koloniale Interessen zeigt und zweitens als Beispiel für das persönliche (Nicht-)Regiment des Kaisers gesehen werden kann, da dieser zwar eine Reaktion Deutschlands auslöste, wie aber in Abschnitt 2 „Das persönliche Regiment - Neuer Kurs und persönliches Regiment Wilhelms II.“ beschrieben, im Ernstfall zurücksteckte (Telegramm statt Flottenentsendung) und sich seinen Ministern fügte.
Ich denke, in meiner Arbeit werden die von mir in Abschnitt 1.1 genannten Schwerpunkte ausführlich genug behandelt, um auch einer über dieses spezielle Thema uninformierten Person einen Einblick in die damaligen Verhältnisse und Geschehnisse zu gewähren.
4. Anhang
4.1 Literaturverzeichnis
1. Babing, Alfred und Bräuer, Hans - Dieter: Fanal am Kap; Verlag der Nation Berlin, Berlin 1982
2. Behnen, Michael (Hrsg.): Quellen der deutschen Außenpolitik im Zeitalter des
Imperialismus 1890 - 1911; Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1977 3. Craig, Gordon A.: Deutsche Geschichte 1866 - 1945 Vom Norddeutschen Bund bis zum Ende des Dritten Reiches: Verlag C.H. Beck München, München 1980 4. Fehrenbach, Elisabeth: Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871 - 1918; R. Oldenbourg München - Wien 1969, München 1969
5. Gebhardt, Bruno: Handbuch der deutschen Geschichte, Band 16: Born, Karl Erich: Von der Reichsgründung bis zum ersten Weltkrieg; Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 1975
6. Haselmayr, Friedrich: Ein Jahrzehnt wechselvoller kaiserlicher Politik 1890 - 1899; Verlag F. Bruckmann München, München 1961
7. Hull, Isabel V.: Persönliches Regiment; erschienen in: Schriften des Historischen
Kollegs, Kolloquien 17, Röhl, John C.G. (Hrsg.): „Der Ort Kaiser Wilhelms II. in der deutschen Geschichte“; R. Oldenbourg Verlag München, München 1991 8. Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts; Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main, 1958
9. Ripper, Werner (Hrsg.) : Themenhefte Weltgeschichte im Aufriß: Politik und Theorie
des Imperialismus; Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1977
10. Stürmer, Michael: Das ruhelose Reich Deutschland 1866 - 1918;Severin und Siedler, Berlin 1983
11. Wächter, Emil: Der Prestigegedanke in der deutschen Politik von 1890 bis 1914; Graphische Werkstätten H.R. Sauerländer und Co., Aarau 1941
[...]
1Vgl. Anhang.: Biographie Wilhelm II., 1859 - 1941 (www.dhm.de)
2Craig, Gordon A. Deutsche Geschichte 1866 - 1945 S. 205f
3Craig, Zitat S.206 oben
4Haselmayr, Friedrich: Ein Jahrzehnt wechselvoller kaiserlicher Politik; S. 14
5Craig, S. 208
6 ebenda
7Haselmayr, S. 14
8ebenda
9Craig S. 207 oben
10 ebenda (Zitat aus: Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins, III, S. 343)
11Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, S. 496
12Craig, S. 207
13Haselmayr, S.13
14 Haselmayr, S. 13
15Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte, Band 16: Karl Erich Born: Von der Reichsgründung bis zum ersten Weltkrieg, S.191
16Fehrenbach, Elisabeth: Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871 - 1918, S.96/97
17Fehrenbach, S. 89
18ebenda
19ebenda
20Fehrenbach, S. 95
21Haselmayr, S. 233
22Haselmayr, S. 14
23 ebenda
24Stürmer, Michael: Das ruhelose Reich 1866 - 1918: S. 277
25Hull, Isabel V.: “Persönliches Regiment, S. 3
26Hull, S. 3- 4
27ebenda
28ebenda
29Hull, S. 5
30ebenda
31Hull, S. 5
32ebenda
33 in: Fehrenbach, S. 97, aus: Harden, Maximilian: Die Feinde des Kaisers, Zukunft 40 (1902), S. 340
34Hull, S. 5 - 6
35Hull, S. 6
36Microsoft Encarta 97 Enzyklopädie, Stichwort Transvaal
37Craig, S. 223
38 Babing, Alfred und Bräuer, Hans - Dieter: Fanal am Kap, S. 117
39Babing und Bräuer, S. 127
40ebenda
41Ripper, Werner (Hrsg.) Themenhefte Weltgeschichte im Aufriß, Politik und Theorie des Imperialismus, S. 84
42Wächter, Emil: Der Prestigegedanke in der deutschen Politik von 1890 bis 1914, S.217
43Wächter, S.218
44 Wächter, S. 244
45Craig, S. 274
46Haselmayr, S. 229
47ebenda
48 Microsoft Encarta 97, Stichwort Rhodes, Cecil John
49Microsoft Encarta 97, Stichwort Beit, Sir Alfred
50Microsoft Encarta 97, Stichwort Rhodes
51ebenda
52Haselmayr, S. 229 unten
53Haselmayr, S. 233
54ebenda
55ebenda
56 ebenda
57ebenda
58Craig, S. 222
59Craig, S.223
60Haselmayr, S.233
61 ebenda
62Haselmayr, S.234
63Craig, S.224
64Craig, S.223
65Haselmayr, S. 234
66Haselmayr, S.235
67ebenda
68Haselmayr, S.236
69 Haselmayr, S. 236
70Haselmayr, S.239
71Behnen, Michael: Quellen der deutschen Außenpolitik im Zeitalter des Imperialismus 1890 - 1911, S. 145
72 ebenda
Häufig gestellte Fragen zur „Die Krügerdepesche und das persönliche Regiment des deutschen Kaisers“-Text
Was ist das Hauptthema dieser Facharbeit?
Die Facharbeit befasst sich mit der Krügerdepesche von 1896 und dem persönlichen Regiment Kaiser Wilhelms II., insbesondere im Kontext der deutschen Außenpolitik und der deutsch-englischen Beziehungen.
Was ist das persönliche Regiment Kaiser Wilhelms II.?
Das persönliche Regiment bezieht sich auf den Versuch Kaiser Wilhelms II., die Regierungspolitik stärker persönlich zu beeinflussen. Die Arbeit untersucht, inwieweit dies tatsächlich realisiert wurde und welche Auswirkungen es hatte.
Was ist die Krügerdepesche?
Die Krügerdepesche war ein Telegramm von Kaiser Wilhelm II. an Paul Krüger, den Präsidenten der Südafrikanischen Republik (Transvaal), nach dem gescheiterten Jameson-Raid. Sie beglückwünschte Krüger zur Abwehr der Invasoren ohne fremde Hilfe.
Warum war die Krügerdepesche umstritten?
Die Krügerdepesche wurde in England als Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet und trug zur Verschlechterung der deutsch-englischen Beziehungen bei. Sie wurde als Zeichen deutscher Feindseligkeit gegenüber England interpretiert.
Welche Faktoren führten zur Entsendung der Krügerdepesche?
Die Entsendung der Depesche wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die deutsche wirtschaftliche Präsenz in Transvaal, Kaiser Wilhelms persönliche Empörung über den Jameson-Raid und das Bedürfnis, Deutschlands Position in Südafrika zu verteidigen.
Was waren die Folgen der Krügerdepesche?
Die Folgen der Krügerdepesche umfassten eine Verschlechterung der deutsch-englischen Beziehungen, eine Stärkung des Nationalgefühls in Deutschland und die Erkenntnis Englands über die Notwendigkeit, Verbündete zu suchen.
Welche Rolle spielte Deutschland in Transvaal?
Deutschland hatte erhebliche wirtschaftliche Interessen in Transvaal, insbesondere in den Bereichen Gold- und Diamantenabbau. Deutsche Unternehmen kontrollierten wichtige Sektoren wie die Nationalbank, die Wasserversorgung und den Import von Eisen, Stahl und Maschinen.
Wie waren die deutsch-englischen Beziehungen zu dieser Zeit?
Die deutsch-englischen Beziehungen waren durch zunehmenden Wettbewerb in den Bereichen Handel, Kolonialpolitik und Flottenrüstung angespannt. Die Krügerdepesche verschärfte diese Spannungen weiter.
Was war der Jameson-Raid?
Der Jameson-Raid war ein gescheiterter Einfall einer Truppe unter der Führung von Dr. Leander Starr Jameson in die Burenrepublik Transvaal im Dezember 1895. Ziel war es, einen Aufstand von Ausländern und Briten zu unterstützen und Transvaal in eine südafrikanische Union einzugliedern.
Wer war Cecil Rhodes und welche Rolle spielte er beim Jameson-Raid?
Cecil Rhodes war der Premierminister der Kapkolonie und ein prominenter Geschäftsmann. Er unterstützte und finanzierte den Jameson-Raid mit dem Ziel, Transvaal unter britische Kontrolle zu bringen.
War Kaiser Wilhelm II. ein Friedensstifter oder Kriegstreiber?
Laut der Quelle war Kaiser Wilhelm II. im Grunde friedliebend, wollte aber Deutschlands Macht auf friedlichem Wege steigern. Allerdings wurden seine romantischen Vorstellungen und sein unüberlegtes Handeln von Politikern und Regierungsangehörigen kritisiert.
Inwieweit beeinflusste Kaiser Wilhelm II. die deutsche Politik?
Die Facharbeit diskutiert unterschiedliche Sichtweisen auf das persönliche Regiment Wilhelms II. Einige sehen es als Fiktion, andere als Realität. Es wird argumentiert, dass der Kaiser zwar gelegentlich in die Arbeit der Minister eingriff, im Ernstfall aber oft nachgab.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, darunter Bücher, Artikel, Briefe und Telegramme. Zu den zitierten Autoren gehören unter anderem Craig, Fehrenbach, Haselmayr und Hull.
Gibt es eine persönliche Beurteilung der Arbeit?
Ja, am Ende der Arbeit wird eine persönliche Beurteilung formuliert, die das Thema beurteilt sowie eine persönliche Einschätzung der Arbeit enthält.
- Quote paper
- Robert Bartel (Author), 2001, Die Krügerdepesche und das persönliche Regiment des deutschen Kaisers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105496