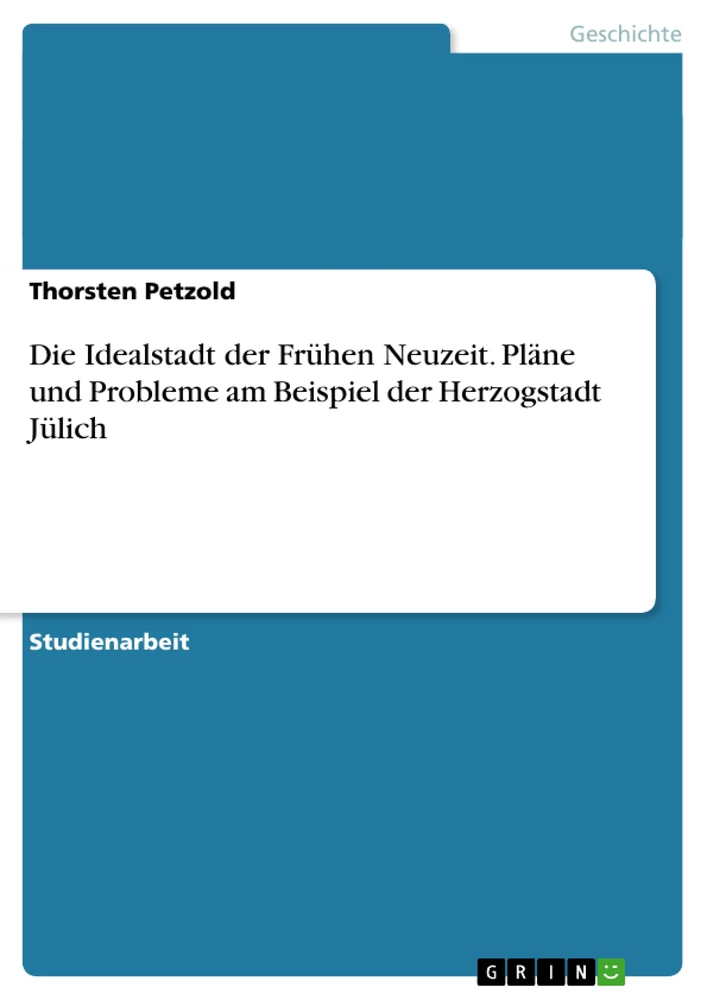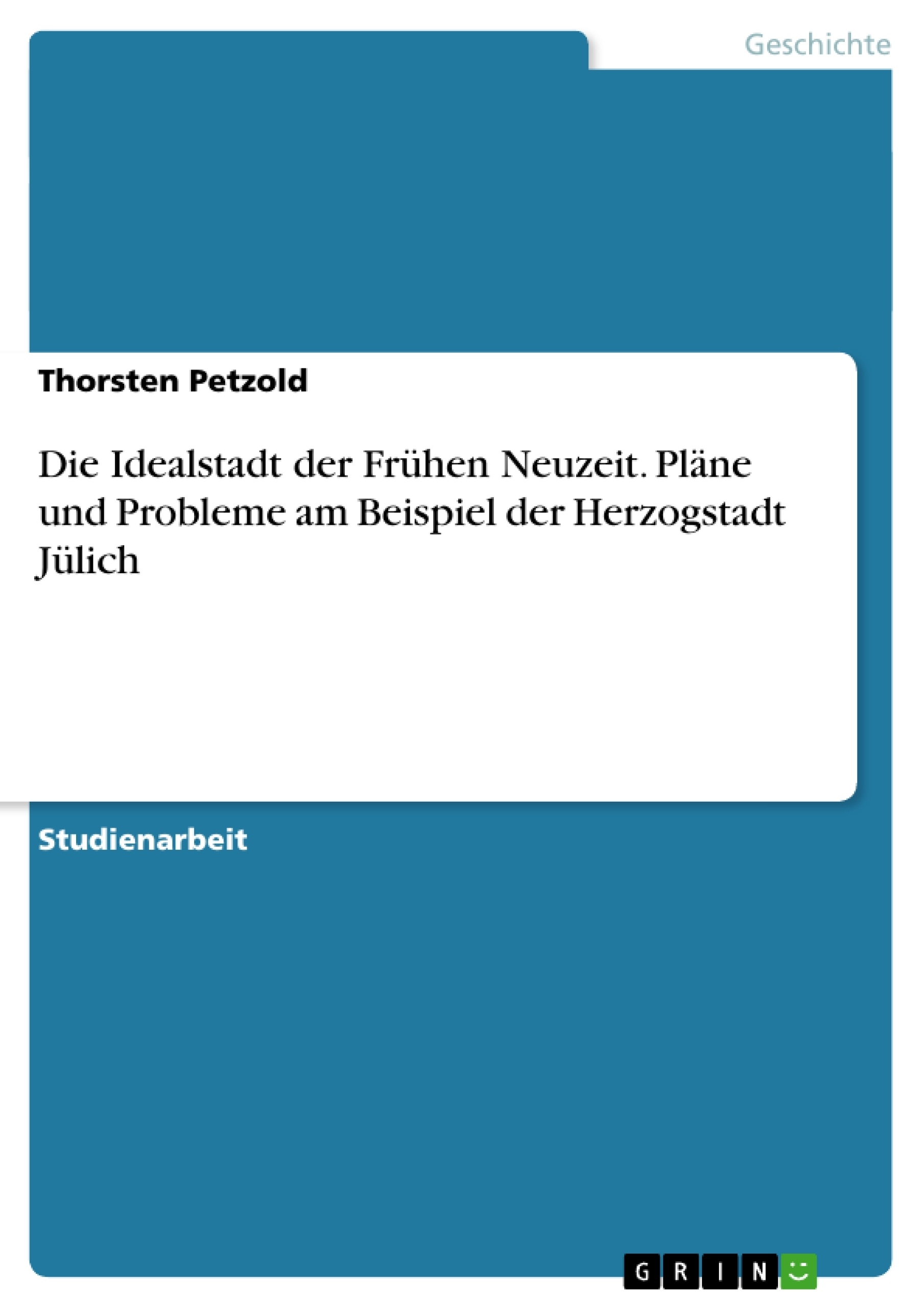Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Ideale der Renaissance auf die rohe Realität von Krieg und Zerstörung treffen – eine Welt, in der der Traum von der perfekten Stadt auf dem Reißbrett entworfen, aber durch topografische Zwänge und militärische Notwendigkeiten auf eine harte Probe gestellt wird. Diese fesselnde Abhandlung entführt Sie in das Jülich des 16. Jahrhunderts, einer Zeit des Umbruchs und der architektonischen Innovation, als Herzog Wilhelm V. und der italienische Baumeister Alessandro Pasqualini gemeinsam versuchten, eine Idealstadt zu erschaffen, die sowohl schön als auch uneinnehmbar sein sollte. Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte der Herzogstadt Jülich, einer der ersten im Geiste der Renaissance neu geplanten Stadtanlagen, deren strategische Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte sowohl ihren Aufstieg als auch ihre fast vollständige Zerstörung besiegelte. Entdecken Sie die Ursprünge und philosophischen Grundlagen des Konzepts der Idealstadt, von den antiken Schriften Vitruvs bis zu den Utopien der Renaissance-Denker, und erleben Sie, wie diese abstrakten Ideen in den Festungsbauten und Stadtanlagen der Frühen Neuzeit Gestalt annahmen. Folgen Sie dem Werdegang Alessandro Pasqualinis, einem der bedeutendsten Architekten seiner Zeit, und erfahren Sie, wie er versuchte, in Jülich ein Meisterwerk der Stadtbaukunst zu schaffen, das den Ansprüchen einer Idealstadt gerecht werden sollte. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen und Kompromisse, die bei der Umsetzung solch ehrgeiziger Pläne in die Realität entstanden, und erkennen Sie, warum die Idealstadt Jülich bis heute ein faszinierendes Beispiel für die Verbindung von Utopie und Wirklichkeit ist. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet nicht nur die architektonischen Besonderheiten Jülichs, sondern auch die politischen, sozialen und militärischen Kräfte, die das Stadtbild prägten. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Stadtplanung, Architekturgeschichte und die Ideale der Renaissance interessieren. Erforschen Sie die Geschichte einer Stadt, die zwischen Traum und Realität ihren eigenen Weg suchte, und entdecken Sie die bleibenden Spuren, die Alessandro Pasqualini in Jülich hinterließ. Diese spannende Reise in die Vergangenheit enthüllt, wie Idealstadtkonzepte bis heute nachwirken und die moderne urbane Baukunst beeinflussen, und lädt dazu ein, die komplexen Zusammenhänge zwischen Macht, Ästhetik und städtischem Leben neu zu denken.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Pasqualini in Jülich
2.1 Die Idealstadt
2.2 Die Geschichte der Herzogstadt Jülich
2.3 Leben und Werk des Alessandro Pasqualini
2.4 Die Jülicher Idealstadtanlage des Alessandro Pasqualini
3. Resümee
Abbildungen
Anhang: Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Herzogstadt Jülich war eine der ersten im Geiste der Renaissance neu geplanten Stadtanlagen. Die strategisch wichtige geographische Lage war dabei entscheidender Gesichtspunkt beim Auf- und Ausbau der frühneuzeitlichen fortifikatorischen Anlagen, aber letztendlich auch der Grund für deren Zerstörung knapp 400 Jahre später.
Den endgültigen Exitus erhielt die frühneuzeitliche Stadtstruktur am 16. November 1944. Der schwerste von 17 Luftangriffen amerikanischer Verbände und darauf folgender Artilleriebeschuss zerstörte die Innenstadt zu 100%, die gesamte Stadt zu 97 %. Jülich erlang in der Weltpresse traurige Berühmtheit als das „deutsche Coventry“1. So endete eine glanzvolle Geschichte, die ebenfalls mit einer Katastrophe begann. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai 1547 kam es zum sogenannten „Jülicher Stadtbrand“, der weite Teile der Stadt verwüstete2. Diese „Chance“ nutzten Herzog Wilhelm V. und sein Baumeister Alessandro Pasqualini, um Jülich nach den modernsten Erkenntnissen der Stadtbaukunst ihrer Zeit zu planen und errichten. Ziel dieser Hausarbeit ist es, einen Einblick in die Vorstellungen einer renaissance-geprägten Idealstadt zu geben und die Probleme der Umsetzung in die Praxis am Beispiel der Herzogstadt Jülich zu Zeiten des Architekten Alessandro Pasqualini zu erläutern.
Auch wenn in einzelnen Punkten noch Unwissenheit herrscht (wie z.B. über das Leben Pasqualinis vor 1532), so kann doch festgestellt werden, dass die akribische Arbeit diverser Autoren und Institutionen eine hervorragende Betrachtungsweise der Jülicher Stadtgeschichte ermöglicht. Der Begriff der Idealstadt findet sich in den einschlägigen Werken ebenfalls immer wieder unterschiedlich interpretiert. Hier soll ein Versuch unternommen werden, diesen unter den Bedürfnissen der Frühen Neuzeit zu betrachten. Daher werden zunächst die drei wichtigsten Begriffe dieser Arbeit in ihrer Singularität betrachtet, bevor diese dann zusammengefügt werden.
2. Pasqualini in Jülich
2.1 Die Idealstadt
Ihre Ursprungsidee hatte die Idealstadt schon bei Vitruv, der unter Cäsar und Augustus dem Heeresstab angehörte3 . Seinen „Zehn Bücher über Architektur4“ umfassen als vermutlich erstes und auf jeden Fall als einzig erhaltenes Werk5die Gesamtheit der Architektur des Altertums. Allerdings gab es damals kaum praktische Umsetzungen seiner Ideen. Diese erfolgten erstmals während der italienischen Renaissance Mitte des 15. Jahrhunderts, als durch den aufkommenden Humanismus diverse Gedanken der Antike wiederbelebt wurden. Auch die diesbezüglichen Schriften des Aristoteles und Platon, welche allerdings immer von einer Kombination der baulichen Planung mit einem Verfassungsentwurf einhergingen, wurden wieder beachtet. Um die Probleme bei der Konzeption einer Idealstadt erläutern zu können, benötigen wir zunächst eine Begriffsdefinition. Schon dieser Schritt erweist sich bei einem Blick in die Fachliteratur als nicht evident. Hier werden mehrere Erklärungen getroffen, die auch eine Spiegelung der jeweiligen Epoche, in der die Aussage getroffen wurde, darstellt. Werfen wir zunächst einen Blick auf Alberti: „Das Ideal einer Stadt und ihre Aufgabe nach der Meinung der Philosophen können wir darin erblicken, dass hier die Einwohner ein friedliches, möglichst sorgloses und von Beunruhigung freies Leben führen6“. Zunächst muss natürlich die Frage gestellt werden, ob der Ausdruck „das Ideal einer Stadt“ als Synonym für den Begriff der „Idealstadt“ der Frühen Neuzeit angesehen werden kann. Ein weitere interessanter Aspekt in dieser Aussage ist, dass er „die Meinung der Philosophen“ als Grad der Definition zu Grunde legt. Schon hier ist also dargelegt, dass die Idealstadt nicht nur eine ausschließlich architektonisch geprägte Sinndeutung beinhalten kann. Nach Jan Holl7 ergibt sich aus dem Ursprung der griechischen staatsphilosophischen Modelle des Aristoteles und Platon geradezu eine „philosophische Notwendigkeit“ bei der Konzeption der Idealstadt, da der Politiker als Philosoph der Antike die Aufgabe hatte, den besten Staat (hier nun die beste Stadt) zu planen. Auch einige Philosophen8 der Frühen Neuzeit entwarfen eine Idealstadt, wobei hier die geometrischen Formen insbesondere beim Festungsbau im Vordergrund standen. Holl behauptet, die „Rationalität werde immer konsequenter als instrumentale verstanden und dem Ideal mos geometricus unterstellt9“. Dem stimme ich zu und glaube, dass der Pragmatismus der Frühen Neuzeit die philosophischen Aspekte zwar weiter berücksichtigte, aber nicht mehr die Triebfeder des Handels war. Statt dessen rückten ästhetische Aspekte, die von der Kunstrichtung der Renaissance beeinflusst waren, in den Vordergrund. Insofern hat sich tatsächlich das oben beschriebene „Ideal einer Stadt“ zu einer „Idealstadt“ entwickelt, doch sind Bedeutung und Sinn verändert. Dies wird vor allem deutlich, wenn man berücksichtigt, das Idealstädte in der Praxis zumeist in Festungsbauten realisiert wurden, wo es schon auf Grund der fortifikatorischen Ansprüche auf eine geometrische Anlage der Bauten ankam. So kommt Georg Münter zu Recht auf seine stadtbaugeschichtliche Definition10: „Idealstadt bezeichnet eine vorgestellte Stadt, die in idealer Weise und gleichsam mathematisch-exakter , gesetzmäßiger Form die materiellen und ideellen Wünsche erfüllen soll, die eine bestimmte Zeit mit der Anlage einer Stadt verbindet“. Doch die wohl dem Gedanken der Frühen Neuzeit am nächsten kommende Definition findet sich im Lexikon der Kunst11: „ Idealstadt ist eine gestalthaft vorgestellte (oder gelegentlich gebaute), lange Zeit durch betonte Regelmäßigkeit gekennzeichnete Stadt, die in idealer Weise die materiellen und ideellen (einschließlich der ästhetischen) Anforderungen erfüllen soll, welche auf Grund der jeweiligen Produktivkräfte eine bestimmte Gesellschaft an die Stadt stellt“. Aus diesen Aussagen wird deutlich, wie sehr die „Vorstellungen“ bei der Planung einer Idealstadt eine Rolle spielen. Die Idealstadt wird als Utopie gesehen.
Thomas Morus hat 1516 mit seinem Werk „Utopia“ die literarische Gattung der Utopie eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein nicht wirklich existierendes, sondern nur erdachtes Land bzw. Gebiet, in dem ein gesellschaftlicher Idealzustand herrscht. Utopien sind also Wünsche, Träume, geistige Experimente, die gemäß dem Charakter ihrer Irrealität nichts kosten12. Was passiert also, wenn die Utopie Wirklichkeit werden sollte? Die Idealstadt tatsächlich existieren würde? Kruft nennt die Idealstadt den „paradoxen Realisierungsversuch einer Utopie13“. Tatsächlich aber geht es meines Erachtens um die Annäherung der Idealstadt an die Utopie. Sicherlich kann dieser Zustand der idealen Gesellschaft niemals erreicht werden, doch ist eine Annäherung durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder Ziel und Antriebsfeder diverser Philosophen und Architekten gewesen. Und ihren praktischen Ursprung fand sie in der Frühen Neuzeit.
Im folgenden beschäftige ich mich mit der Problematik der praktischen Umsetzung anhand der Herzogstadt Jülich. Diese eignet sich hervorragend zur Anschauung, da hier die meistgebräuchlichste Verquickung der frühen Neuzeit zwischen Festungsstadt und Idealstadt teilweise realisiert werden konnte und auch typische Schwierigkeiten bei der Umgestaltung einer bereits vorhandenen Stadt auftraten. Allerdings gab es im europäischen Raum auch einige Stadtneugründungen unter den Ansichten einer Idealstadt, wie z.B. Pienza und Sabbioneta14, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen wird.
2.2 Die Geschichte der Herzogstadt Jülich
Die Gründung von Jülich erfolgte vermutlich zur Zeit des Julius Cäsar, der zwischen 53 und 51 v. Chr. die im heutigen Rheinland als Nachfolger der Kelten ansässigen Eburonen vernichtete15. Alföldy vermutet, dass die massenhafte Bürgerrechtsverleihung unter den julischen Kaisern, besonders unter Augustus, und die damit um sich greifende Verbreitung des Juliernamens der Anlass der Namensgebung war16. Ein erstes verlässliches Datum mit der Nennung der Stadt als „Juliacum“ erfolgte im Jahr 356 durch Ammianus Marcelinus17. Die römische Herrschaft endete 460 durch das Vordringen der Franken nach Westen18. Vom 5. bis ins 9. Jahrhundert hatte Jülich eine zentralörtliche Bedeutung als Hauptort eines fränkisch- ripuarischen Gaues. Das von den Römern übernommene Kastell wird (wohl mit einer später erbauten Burg) Amtssitz der „Grafen im Jülich-Gau“19. 881 wird Jülich von den Normannen zerstört20. Im Jahre 927 erfolgt die erstmalige urkundliche Erwähnung als „Feste“. Seit dem 10.Jh. steht Jülich unter der Herrschaft der Kölner Erzbischöfe, während die Grafen von Jülich als deren Vögte wirkten21. Das der Name Jülich auf das römische Kaiserhaus der Julier zurückzuführen ist, behauptet als erster Widukind, Mönch des Klosters Corvey und Autor der sächsischen Geschichte, im 10 Jahrhundert22. Nochmals wurde Jülich im Jahre 1114 zerstört, diesmal durch Heinrich V., der sich auf dem Zug gegen Köln befand23. 1214 erfolgte noch eine Eroberung durch Friedrich II.24, ehe 1234 Wilhelm IV. Jülich zur Stadt erhob. Allerdings erfolgte die erste urkundliche Erwähnung als Stadt erst 123825.
Der Bau einer Stadtmauer ist erstmals im Jahr 1324 erwähnt26. 1336 erfolgt die Erhebung zur Markgrafschaft. Graf Wilhelm V. von Jülich wird von Kaiser Ludwig IV. zum Markgrafen ernannt und damit in den Reichsfürstenstand erhoben. 1356 erfolgt dann Erhebung der Markgrafschaft Jülich zum Herzogtum. Markgraf Wilhelm von Jülich erhält von Kaiser Karl IV. die erbliche Herzogswürde und wird fortan als Herzog Wilhelm I. von Jülich gezählt27. Durch einen Stadtbrand im Jahr 1473 wird das Rathaus zerstört und mit ihm die meisten Schriftquellen und Urkunden der damaligen Zeit28. Mit dem Tod des Herzog Johann II. von Kleve entsteht 1521 eine Personalunion der Herzogtümer Jülich-Berg-Kleve, die durch Hochzeit seines Nachfolgers Johann III. noch auf die Territorien Jülich-Berg- Ravensberg und Kleve-Mark-Ravenstein ausgeweitet wird29. Ab 1539 regiert dann bis 1592 Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg, der auch den Spitznamen „Wilhelm der Reiche“ trug. 1533 hatte Jülich etwa 1.300 Einwohner. Ab 1538 kam es zu verstärkten kriegerischen als auch diplomatischen Auseinandersetzungen, die das gesamte Jahrhundert und darüber hinaus anhalten sollten30. Jülich war auf Grund seiner zentralen Lage in das Mächtekalkül österreichischer, französischer, niederländischer und spanischer Interessenkonflikte geraten, die sich aus den Herausbildung der Territorialstaaten ergaben. Aus diesem Grunde musste die Stadt geschützt werden, was zum Ausbau zur Festungsstadt im Rahmen idealstadtkonzeptioneller Ideen führte. Zu diesem Zweck erschien nun der italienische Architekt Alessandro Pasqualini, welcher sich durch Festungsbauten in den Niederlanden schon einen Namen gemacht hatte.
2.3 Leben und Werk des Alessandro Pasqualini
Alessandro Pasqualini wurde am 05.05.1493 in Bologna geboren. Über seinen Lebenslauf bis 1532 können nur Vermutungen angestellt werden. Büren/Perse31halten eine künstlerische Ausbildung in der Dombauschule von St. Peter, aber auch im Umfeld von Bologna-Florenz für möglich. Um 1530 siedelte Pasqualini in die Niederlande, vermutlich im Gefolge Kaiser Karl V., dessen Kaiserkrönung in Bologna erfolgte32. Die erste urkundliche Erwähnung Pasqualinis erfolgte am 05.08.1532 in IJsselstein33. 1534 war er am Umbau des Königssaales und Logierzimmers Kaiser Karl V. in Schloss Grave beteiligt, 1539 am Ausbau von Schloss Buren34. 1542 war er für die Anfertigung eines Holzmodells für eine Bastion in ´s-Hertogenbosch verantwortlich und im September 1543 entwarf er einen Plan zum Umbau der Befestigung von Kampen an der Nordfront. Im Februar und März 1545 nahm er Befestigungsverbesserungen an den Stadtmauern von Amsterdam vor. Aus dem gleichen Jahr stammt sein Entwurf eines Schlossfestungs- Prototyps, welcher allerdings wohl nicht mit dem für das Schloss Jülich übereinstimmt35. Sein erster belegter Aufenthalt in Jülich fand in der Zeit um den Stadtbrand statt36. Am 15.04.1549 erhält er die Bestallungsurkunde zum Landesbaumeister37. In der Zwischenzeit hatte er Pläne für das Schloss und die Zitadelle entworfen, auf die später intensiver eingegangen wird. Im Mai 1552 besichtigt er die Kölner Stadtbefestigung und entwickelt Pläne zu deren Ausbesserung zwischen Bayenturm und Severinstor, welche bis 1554 andauerten38. Bis zu seinem Tod 1559 in Bielefeld war er in diverse Projekte eingebunden, die ihn als bedeutendesten Architekten seiner Zeit am Niederrhein erscheinen lassen.
2.4 Die Jülicher Idealstadtanlage des Alessandro Pasqualini
Wie aus der Jülicher Stadtgeschichte ersichtlich ist, waren Krieg und Zerstörung ihr ständiger Begleiter. So auch in der Zeit, in der Alessandro Pasqualini für Herzog Wilhelm V. tätig war. Es galt also, einen dem Herrscher adäquaten Repräsentationsbau zu entwerfen und diesen möglichst effektiv zu schützen. So kam es zur Planung eines Schlosses, dass in einer Zitadelle gelegen durch diese geschützt werden sollte. Gleichzeitig galt es, die nach dem Stadtbrand vom 26. Mai 1547 notwendig gewordene Neuordnung des mittelalterlichen Straßennetzes durchzuführen und somit den gesamten Stadtgrundriss den militärtechnischen Maximen anzupassen.
Als Ideal der Stadtbefestigungen der Frühen Neuzeit wurden sogenannten „Regelpolygone“ angesehen. Hierbei handelt es sich um Stadtgrundrisse auf der Basis eines Viereck, Fünfeck, Sechseck usw. Wie in Abbildung 1 zur ersehen ist, wurde die Zitadelle mit dem Schloss NEBEN der eigentlichen Stadt errichtet. Wie kam es dazu und kann man trotzdem noch von einer typischen Idealsstadt sprechen? Ziel der pasqualinischen Planung war es ganz offenbar, einen Verteidigungswall um die mittelalterlichen Mauern zu ziehen. Dies war bei bestehenden Städten durchaus üblich, hatte es doch den Vorteil, dass die Stadt bei den erfahrungsgemäß sehr langwierigen Bauzeiten weiterhin verteidigungsbereit blieb. Somit ist das erste Problem bei der Realisierung einer Idealstadt schon beschrieben: Insofern keine völlige Neugründung erfolgt, muss auf den existierenden Grundriss und seine Bevölkerung Rücksicht genommen werden. Trotzdem wäre es theoretisch möglich gewesen, ein Regelpolygon um die alten Stadtmauern zu errichten. Warum ist dies nicht erfolgt? Im Falle der Herzogstadt Jülich waren dies topographische Gründe, weil an der Westseite wegen der Lage der Stadt hart an der Abbruchkante zur feuchten Ruraue der notwendige Raum fehlte39. Dies zeigt, das auf Grund der massiven Befestigungsanlagen erhebliche Raumerweiterungen der Stadt notwendig sind, die nicht immer mit den örtlichen Gegebenheiten vereinbar sind, was ein weiterer Grund für die schwierige Ausführung der Idealsstadtpläne aufzeigt. Lange Zeit wurde daher auch darüber diskutiert, ob die Stadtanlage Jülichs überhaupt den Ansprüchen einer Idealstadt der Renaissance gerecht wird. Lau meint hierzu, dass diese nur unvollkommen verwirklicht werden konnten40, während Neumann allenfalls einen indirekten Rückgriff auf italienische Vorstellungen sieht41. Die Lösung brachte Eberhardt 1978. Er zeigte auf, dass die Stadtbefestigung von Jülich auf einer Kombination von geometrischen Grundfiguren erbaut wurde. So schreibt Eberhardt: „Das dem Plan von Jülich zugrunde gelegte Fünfeck ist als oblonge, zweiseitig symmetrische Figur konzipiert, die sich zwar nicht, wie die „normalen“ Regelpolygone, auf einen Kreis als Ausgangsfigur zurückführen lässt, wohl aber auf eine Konfiguration zweier durchmessergleiches Kreise, deren Abstand untereinander von Mittelpunkt zu Mittelpunkt dem Radius entspricht“42(s. Abbildung 3). Auch die geplante und dann allerdings lediglich in Teilen erbaute Zitadelle entsprach voll und ganz den Idealplänen der Renaissance43. Größere Probleme gab es jedoch bei der Verwirklichung der Pläne für das Residenzschloss. Für die Baumeister der Renaissance war eine symmetrische Fassadenbildung auf der Basis mathematischer Gesetzmäßigkeiten Grundlage der architektonischen Gestaltung. Meistens erfolgte hier eine spiegelgleiche Anordnung der Räume rechts und links der Mitte. Bei dem Bau des Residenzschlosses wurde dagegen überaus deutlich verstoßen. So ist z.B. die Kapelle als Mittelrisalit ca. 3,40 m von der Mitte entfernt. Auch sind südllich der Kapelle fünf Fensterachsen ausgebildet, während sich auf der nördlichen Seite sieben finden44. Der Grund dafür ist das neben dem Nordturm eingefügte Treppenhaus45, welches eine spiegelsymmetrische Anordnung unmöglich macht. Allerdings belegt Eberhardt auch, dass Pasqualini aus dieser Not heraus eine sogenannte „Drehsymmetrie“ gefunden hat, die im Palastbau Italiens ohne Gegenbeispiel ist46.
3. Resümee
Die Idealstadt in ihrer absoluten Vollkommenheit wird Utopie bleiben. Zu viele Faktoren sind zu berücksichtigen, die sich teilweise gegeneinander ausschließen. Die Idealstadt der Frühen Neuzeit jedoch ist der Ausdruck eines Wunsches, die vollkommene Organisation wenigstens unter fortifikatorisch-funktionalen Aspekten und ästhetisch-formalen Gestaltungsmaximen herzustellen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass eine gewisse Regelhaftigkeit zwar Bestandteil einer Idealstadt ist, doch nicht jede Stadt, die regelhaft gebaut ist, als Idealstadt angesehen werden kann. Wie anhand der Herzogstadt Jülich belegt ist, konnte diese Regelhaftigkeit aus unterschiedlichen Gründen nicht immer hundertprozentig in die Praxis umgesetzt werden. Trotzdem bleibt aus meiner Sicht das Idealstadtkonzept unter den o.g. Aspekten bzw. Gestaltungsmaximen eine Variante, die zurecht weit über die Frühe Neuzeit hinaus ihre Anhänger gefunden hat. Unter modernen Gesichtspunkten wäre allerdings eine andere Diskussion zu führen, wie sie ja auch z.B. Kruft in seinem genannten Werk aufgreift. Das diese Diskussion auch heute noch geführt wird, zeigt die elementare Bedeutung dieses Themas an. Die Entwicklung aus den mehr oder weniger unkoordinierten Ansiedlungen des Mittelalters hin zu einer strukturgeprägten Stadt heutiger Zeit wäre ohne den Fortschritt und die Erfahrungen der Frühen Neuzeit nicht in diesem Rahmen möglich gewesen. Vielmehr kann die Idealstadt der Renaissance in den o.g. Punkten als „Urknall“ der modernen urbanen Baukunst gesehen werden. Mit dieser Aussage sind ihr aber auch die Grenzen gesetzt, da ihre zivilisatorischen Auswirkungen in Bezug auf das Leben der Bürger in der Stadt nur als sekundär angesehen werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine Kunstrichtung der jeweiligen Epoche, die auf Grund der militärischen Erfordernisse in der Frühen Neuzeit auf fruchtbaren Boden fiel und dort stark prosperieren konnte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Schlos vnd Statt Gülch (=Jülich). Illuminierte Federzeichnung, sine nota
(Nicolaus Vrischlein = Niklas Fischlein, gest. 1608, ?), ohne Datum (vor 1580), Blattformat: 48,8 x 33,7 cm, aus: Planstädte der Neuzeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Katalog zur Ausstellung im Karlsruher Schloß 1990, S. 69
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Historische Festungsstadt Jülich im modernen Luftbild von 1988, aus: Planstädte der Neuzeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Katalog zur Ausstellung im Karlsruher Schloß 1990, S. 69
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Idealplan der Stadtbefestigung, aus: Eberhardt, Jürgen Jülich-
Idealstadtanlage der Renaissance, Landeskonservator Rheinland, Arbeitsheft 25, hrsg. vom Rheinland Verlag, Köln 1978, S. 32
Quellen- und Literaturverzeichnis
Alberti, Leon Battista;Zehn Bücherüber die Baukunst, hrsg. vom Heller-Verlag, Wien & Leipzig 1912
Alföldy G.,Ein neuer Matronenstein aus Jülich, in: Epigraphische Studien 4, hrsg. vom Lanschaftsverband Rheinland, Köln 1967
Andreae, Johann Valentin;Christianopolis, hrsg. von Köhler & Amelang, Leipzig 1977
Aristoteles;Der Staat der Athener, hrsg. von Peter Dams, Reclam, Stuttgart 1970
Benevolo, Leonardo;Die Stadt in der europäischen Geschichte, hrsg. durch die C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1993
Buck, August;Die Idealstadt der italienischen Renaissance, in: Deutsche Stadtgründungen der Neuzeit, Wolfenbütteler Forschungen, Band 44, S. 17 - 29, hrsg. von Wilhelm Wortmann, Wolfenbüttel 1989
Campanella, Thomas;Der Sonnenstaat, hrsg. vom Akademie-Verlag, Berlin 1955
Coenen U.,Von Juliacum bis Jülich, hrsg. vom Verlag G. Mainz, Aachen, 1989
Dante;Monarchia, hrsg. von Reclam, Stuttgart 1989
Der italienische Architekt Allesandro Pasqualini (1493 - 1559) und die Renaissance amNiederrhein, Tagungshandbuch zum 1. Jülicher Pasqualini-Symposium am 30.Oktober 1993 in Jülich, hrsg. von Günter Bers und Conrad Doose, Jülich 1994
Die italienische Stadt der Renaissance im Spannungsfeld von Utopie und Wirklichkeit, Kolloquium im Deutschen Studienzentrum in Venedig vom 27. - 29. September 1982, hrsg. von August Buck und Bodo Guthmüller, Venedig 1984
Doose, Conrad, Peters S.;Renaissancefestung Jülich, hrsg. vom Förderverein Festung Zitadelle Jülich e.V., Jülich 1997
Eberhardt, Jürgen; Jülich - Idealstadtanlage der Renaissance, Landeskonservator Rheinland, Arbeitsheft 25, hrsg. vom Rheinland Verlag, Köln 1978
Eberhardt, Jürgen;Das Urentwurfsmodell Alessandro Pasqualinis für die Zitadelle Jülich, in:
Italienische Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein, S. 381 - 392, hrsg. von Conrad Doose, Jülich 1998
Egli, Ernst;Geschichte des Städtebaus, Dritter Band - Die neue Zeit, hrsg. vom Eugen Rentsch Verlag, Zürich 1967
Franck-Oberaspach, Karl, Renard, Edmund;Die Kunstdenkmäler des Kreises Jülich, in: Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Band 8, , Verlag L. Schwann, Düsseldorf, 1902
Gerteis, Klaus; Die deutschen Städte in der Frühen Neuzeit: Zur Vorgeschichte der „bürgerlichen Welt“, hrsg. von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 1986
Holl, Jann;Die historischen Bedingungen der philosophischen Planstadtentwürfe in der Frühen Neuzeit, in: Planstädte der Neuzeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, S. 9 - 30, Katalog zur Ausstellung im Karlsruher Schloß 1990
Italienische Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein: Stadtanlagen - Zivilbauten - Wehranlagen, Tagungshandbuch zum 2. Jülicher Pasqualini-Symposium vom 18. bis 21 Juni 1998 in Jülich, hrsg. von Conrad Doose, Jülich 1998
Jansen, Michael;Idealstädte, in: Italienische Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein, S. 27 - 47, hrsg. von Conrad Doose, Jülich 1998
Kluckert, Ehrenfried; Auf dem Weg zur Idealstadt: Humanistische Stadtplanung imSüdwesten Deutschlands, hrsg. von Klett-Cotta, Stuttgart 1998
Kruft, Hanno-Walter;Städte in Utopia : die Idealstadt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zwischen Staatsutopie und Wirklichkeit, hrsg. durch die C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1989
Lau, Friedrich; Jülichsche Städte, aus der Reihe: Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der Rheinischen Städte, Band II, hrsg. vom Hanstein Verlag, Bonn 1932
Lexikon der Kunst, hrsg. von Ludger Alscher, Leipzig 1971
Morus, Thomas;Utopia, hrsg. von Jürgen Teller, Reclam, Leipzig 1974
Münter, Georg; Idealstädte. Ihre Geschichte vom 15.- 17. Jahrhundert, hrsg. vom Henschelverlag, Berlin 1957
Neumann, Hartwig;Die Zitadelle Jülich - Ein Gang durch die Geschichte, hrsg. vom Heimatverlag J. Fischer KG, Jülich 1971
von Padua, Marsilius;Defensor pacis, in: Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter, Reihe A, hrsg. von Ernst Engelberg und Horst Kusch, Rütten & Loening, Berlin 1956
Platon;Timaios und Kritias, hrsg. von Otto Apelt, Meiner-Verlag, Hamburg 1988
Stoob, Heinz;Die Stadt - Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter, hrsg. von Heinz Stoob, Böhlau Verlag, Köln 1979
Vitruv (Marcus Vitruvius Pollio); Zehn Bücher über Architektur, hrsg. von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 1991
[...]
1Coenen U., S. 114
2Doose C., S. 16
3Vitruv, S. 2
4Originaltitel: “de architectura”
5wiederentdeckt 1416 in Sankt Gallen von Poggio; aus: Stoob, H.,Die Stadt, S. 197
6Alberti, L., S. 10
7Holl, J., S. 9
8z.B. Dante, von Padua, Andreae, Morus und Campanella
9Holl, j., S. 17
10Münter, G., S. 7
11Lexikon der Kunst, S. 361
12Kruft, H., S. 9
13Kruft, H. S. 10
14Jansen, M., S. 43 f.
15Coenen, U., S. 7
16Alföldy, G., S. 19
17Doose, C., Peters S., S. 70
18Coenen, U., S. 22
19Doose, C., Peters S., S. 70
20Franck-Oberaspach, K., Renard E., S. 121
21Coenen, U., S. 23
22Doose, C., Peters S., S. 70
23Franck-Oberaspach, K., Renard E., S. 121
24Franck-Oberaspach, K., Renard E., S. 121
25Doose, C., Peters S., S. 70
26Lau, F., S. 77
27Doose, C., Peters S., S. 70
28Lau, F., S. 18 - 20
29Neumann, H., S. 75
30Doose, C., Peters S., S. 11
31v. Büren, G./Perse, M., S. 154
32Allerdings sind auch andere Theorien denkbar; vgl. Bernhardt, M./Perse, M. S. 472 ff.
33v. Büren, G./Perse, M., S. 154 f.
34v. Büren, G./Perse, M., S. 155 f.
35Bernhardt, M./Perse, M. S. 476 - 480
36Beleg ist hier ein Treffen mit dem Ziegelmeister im Mai 1545; Stadtrechnung Jülich 1546/47 ALP I, D6
37v. Büren, G./Perse, M., S. 160
38v. Büren, G./Perse, M., S. 161 f.
39Eberhardt, J., S. 23
40Lau, F., S. 27 f.
41Neumann, H., S. 124 ff.
42Eberhardt, J., S. 58
43Eberhardt, J., S. 35
44Eberhardt, J., Urentwurfsmodell, S 381
45Eberhardt, J., Urentwurfsmodell, S 382
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Arbeit über Pasqualini in Jülich?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Idealstadt der Renaissance und der Umsetzung der dazugehörigen Vorstellungen am Beispiel der Herzogstadt Jülich zur Zeit des Architekten Alessandro Pasqualini. Sie beleuchtet die Geschichte Jülichs, das Leben und Werk Pasqualinis sowie die spezifische Jülicher Stadtanlage unter dem Aspekt der Idealstadtkonzeption.
Was sind die Hauptpunkte der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Definition der Idealstadt, die Geschichte Jülichs, das Leben und Werk Alessandro Pasqualinis sowie die Jülicher Idealstadtanlage im Detail. Sie diskutiert die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Idealstadtplänen in der Praxis und analysiert die spezifischen Merkmale der Jülicher Anlage.
Was sind die Definitionen und Interpretationen der "Idealstadt"?
Die Idealstadt wird als eine Utopie betrachtet, ein Idealzustand, der durch die Kombination von architektonischer Planung und gesellschaftlichem Ideal entsteht. Verschiedene Philosophen und Architekten haben unterschiedliche Definitionen und Konzepte der Idealstadt entwickelt, die von geometrischen Formen im Festungsbau bis hin zu friedlichen und sorgenfreien Lebensbedingungen reichen.
Was ist die historische Bedeutung der Herzogstadt Jülich?
Jülich war eine der ersten im Geiste der Renaissance neu geplanten Stadtanlagen und spielte eine wichtige strategische Rolle. Die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, aber ihre Geschichte reicht zurück bis in die Römerzeit. Die Arbeit analysiert, wie Jülich nach einem Stadtbrand im 16. Jahrhundert nach den modernsten Erkenntnissen der Stadtbaukunst neu geplant und errichtet wurde.
Wer war Alessandro Pasqualini?
Alessandro Pasqualini war ein italienischer Architekt, der im 16. Jahrhundert lebte und als Landesbaumeister in Jülich tätig war. Er entwarf Pläne für das Schloss, die Zitadelle und die Neuordnung des mittelalterlichen Straßennetzes. Die Arbeit gibt einen Einblick in sein Leben und Werk, insbesondere seine Tätigkeit in Jülich.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der Realisierung der Idealstadt in Jülich?
Die Umsetzung der Idealstadtpläne in Jülich war mit Schwierigkeiten verbunden, da auf den existierenden Grundriss und die Bevölkerung Rücksicht genommen werden musste. Topographische Gründe und die Notwendigkeit erheblicher Raumerweiterungen erschwerten die Realisierung. Die Arbeit diskutiert, wie Pasqualini diese Herausforderungen meisterte und eine Kombination von geometrischen Grundfiguren für die Stadtbefestigung entwickelte.
Welche Rolle spielte die Zitadelle in Jülich?
Die Zitadelle spielte eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Stadt und des Schlosses. Sie wurde nach den Idealplänen der Renaissance entworfen und diente als Schutz für das Residenzschloss. Die Arbeit analysiert die architektonischen Merkmale der Zitadelle und ihre Bedeutung für die Stadtbefestigung.
Wie wurde die Symmetrie im Residenzschloss realisiert?
Obwohl das Residenzschloss nicht vollständig spiegelsymmetrisch aufgebaut war, fand Pasqualini eine sogenannte "Drehsymmetrie", die im Palastbau Italiens ohne Gegenbeispiel ist. Die Arbeit beleuchtet die architektonischen Besonderheiten des Schlosses und wie Pasqualini die Herausforderungen bei der Gestaltung meisterte.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Idealstadt in ihrer absoluten Vollkommenheit wird Utopie bleiben. Die Idealstadt der Frühen Neuzeit ist der Ausdruck eines Wunsches, die vollkommene Organisation wenigstens unter fortifikatorisch-funktionalen Aspekten und ästhetisch-formalen Gestaltungsmaximen herzustellen. Die Arbeit schließt mit einer Bewertung der Bedeutung des Idealstadtkonzepts und seiner Auswirkungen auf die moderne urbane Baukunst.
- Citar trabajo
- Thorsten Petzold (Autor), 2001, Die Idealstadt der Frühen Neuzeit. Pläne und Probleme am Beispiel der Herzogstadt Jülich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105484