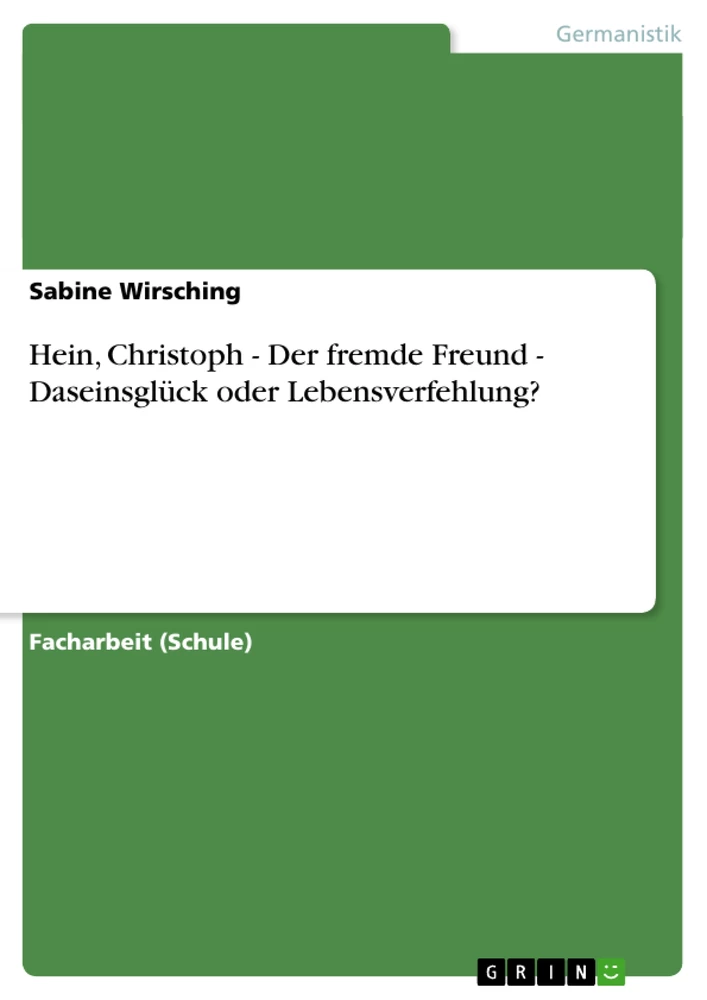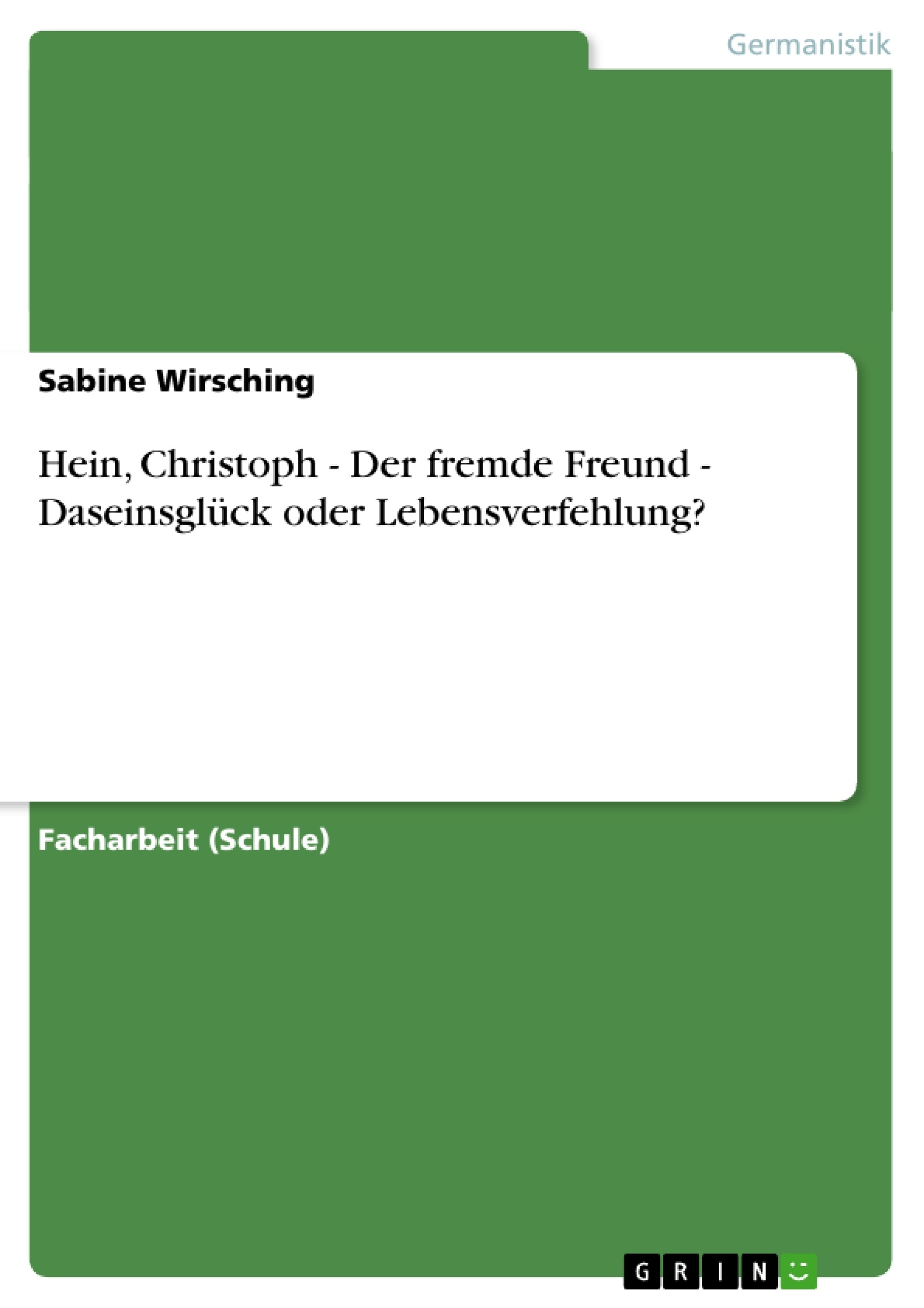Was bedeutet es, in einer Welt der Entfremdung nach Nähe zu suchen? Christoph Heins Novelle „Der fremde Freund – Drachenblut“ wirft einen schonungslosen Blick auf die Gefühlswelt der Ärztin Claudia, eine Frau, die sich hinter einer Fassade der Emotionslosigkeit verschanzt hat, um den Zumutungen des Lebens in der DDR zu entgehen. In einer Gesellschaft, die von Misstrauen und Konformitätsdruck geprägt ist, navigiert Claudia durch Beziehungen, die von Distanz und Oberflächlichkeit gekennzeichnet sind. Ihre Affäre mit Henry, einem Mann, der ebenfalls auf der Suche nach einem authentischen Dasein ist, wird zum Spiegelbild ihrer inneren Zerrissenheit. Kann wahre Intimität in einer Welt der Anpassung existieren, oder ist Claudias selbstgewählte Isolation der Preis für ein Leben ohne Schmerz? Die Novelle erkundet auf beklemmende Weise die Frage nach Daseinsglück und Lebensverfehlung, indem sie die Mechanismen der Verdrängung und die Sehnsucht nach Geborgenheit in einer entfremdeten Gesellschaft offenlegt. Tauchen Sie ein in eine Geschichte über die Suche nach Identität, die Last der Vergangenheit und die schwierige Balance zwischen Anpassung und Selbstverwirklichung. „Der fremde Freund – Drachenblut“ ist ein zeitloses Werk, das die Leser dazu anregt, über die Bedeutung von Beziehungen, dieDefinition von Glück und die Konsequenzen emotionaler Abschottung nachzudenken. Entdecken Sie die subtilen Schattierungen einer Frau, die gelernt hat, ihre Verletzlichkeit zu verbergen, und begeben Sie sich auf eine Reise in die Tiefen der menschlichen Seele, wo die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen. Diese psychologisch feinsinnige Erzählung ist ein Muss für Leser, die sich für Literatur über innere Konflikte, gesellschaftliche Zwänge und die Suche nach einem erfüllten Leben interessieren. Lassen Sie sich von Heins präziser Sprache und der eindringlichen Atmosphäre in eine Welt entführen, in der die Frage nach dem Sinn des Lebens eine existenzielle Bedrohung darstellt. Erleben Sie, wie Claudia mit ihrer Vergangenheit ringt, ihre Beziehungen gestaltet und letztendlich vor der Entscheidung steht, ob sie ihre Schutzmauer aufrechterhalten oder sich der Möglichkeit wahrer Nähe öffnen soll. Ein Roman, der noch lange nach dem Zuklappen des Buches nachwirkt und zum Nachdenken über die eigenen Lebensentscheidungen anregt.
I.Einleitung
1.Aufgabe und Ziel der Facharbeit
Innerhalb der begrenzten Möglichkeiten dieser Facharbeit werde ich mich im Folgenden mit Christoph Heins Novelle „Der fremde Freund - Drachenblut“ beschäftigen. Auf- grund der Aufgabenstellung werde ich hierbei den Schwerpunkt auf die Frage legen, ob es sich bei diesem Prosatext um die Verdeutlichung von Daseinsglück oder Lebensver- fehlung handelt. Dabei werde ich mich im Wesentlichen mit dem Leben und der Ein- stellung Claudias befassen, um am Ende der Arbeit ein Beurteilung abgeben zu können. Bevor ich mich jedoch der Interpretation von „Drachenblut“ zuwende, möchte ich zu- nächst einige Grundlagen in Form einer Inhaltsangabe mit einer kurzen Biographie des Autors und die Definitionen der beiden Hauptbegriffe der Fragestellung geben, um dem Leser den Zugang zum zweiten Abschnitt des Hauptteils zu erleichtern. Bei der Beg- riffsdefinition werde ich mich hauptsächlich auf meine eigene Meinung beziehen, da es sehr schwierig ist, Material darüber zu bekommen. Erklärungen aus dem Lexikon für „Glück“ und „Verfehlung“ erwiesen sich hierbei als unbrauchbar.
Formale Aspekte und deren Wirkung beziehe ich nicht in die Inhaltszusammenfassung ein, da dies meiner Meinung nach bereits einen wichtigen Teil der Interpretation dar- stellt. Anschließend werde ich versuchen, durch die Analyse der Titel der Novelle und den Prolog den Einstieg in die folgende Interpretation zu erleichtern. Bei dieser werde ich mich zunächst mit Claudias Beziehung zu Henry vor und nach seinem Tode be- schäftigen, da dies meiner Meinung nach den zentralen Aspekt des Prosatextes darstellt. Abschließend werde ich die beiden Hauptfiguren so genau wie es der Rahmen der Facharbeit zulässt, charakterisieren, um ihre Einstellung zu Daseinsglück und Lebens- verfehlung in Bezug auf ihr eigenes Leben zu verdeutlichen. Leider ist es aufgrund der begrenzten Länge dieser Facharbeit nicht möglich, die Beziehung Claudias zu Arbeit tiefergehend und Hobby generell in die Analyse mit einzubeziehen, da Henry als zweite Hauptfigur für mich von weitaus größerer Bedeutung ist.
Einige von mir aufgestellte Thesen in Bezug auf die Novelle stimmen mit denen bekannter Kommentatoren überein, so dass ich diese als Bestätigung meiner eigenen Gedanken verwenden werde. Hier werde ich vor allem Rolf Michaelis‘ „Leben ohne zu leben“ und Rüdiger Bernhardts „Für und Wider“ einbeziehen.
Die in der Analyse verwendeten Textzitate habe ich in der alten Rechtschreibung belassen. Änderungen in Bezug auf Grammatik etc. werde ich kennzeichnen. Der Schlussteil meiner Facharbeit wird sich auf die Aufgabenstellung zurückbeziehen, und ich werde versuchen, eine Antwort auf die Frage, ob es sich bei der Novelle „Ein fremder Freund - Drachenblut“ um Literatur zur Verdeutlichung von Daseinsglück oder Lebensverfehlung handelt, zu finden.
II. Hauptteil
1. Grundlagen
1.1. Inhaltsangabe mit Angaben zu Autor und Titelgeschichte
Christoph Hein, Autor der Novelle „Ein fremder Freund - Drachenblut“, wurde am 8. August 1944 in Heinzendorf (Schlesien) geboren und gehört zu den heute bedeutends- ten und bekanntesten DDR-Autoren. Seine Jugend verbrachte er zum Teil in einem Internat in Westberlin, bevor er nach dem Mauerbau bei seiner Familie in Ostdeutsch- land blieb. Obwohl er bereits seit seiner Jugendzeit schreibt, begann er erst nach seinem Philosophie- und Logikstudium (1967 - 71) zunächst als Dramaturg und ab 1979 als freier Schriftsteller die Widersprüche der sozialistischen Regierung herauszustellen oh- ne den Sozialismus dabei abzulehnen. Für seine Arbeit erhielt er 1989 den Lessing-Preis und 1990 den Erich-Fried-Preis.
In seinen Werken (u.a. „Horns Ende“, „Der Tangospieler“) beschäftigt er sich mit der Figur des Intellektuellen und der Frage, ob revolutionäre Gedanken eine andere Zukunft als Erstarrung im System besitzen. Sein zweiter Prosatext „Der fremde Freund“ (westdt. Titel aufgrund des Titelschutzes: „Drachenblut“) verhilft ihm 1982 in der DDR und 1983 in Westdeutschland zum Durchbruch.
Die Novelle handelt vom Dahinleben der gewollt emotionslosen Ärztin Claudia und ihrer Beziehung zu sich selbst und zu den sie umgebenden Menschen. Aus Angst vor tiefer greifenden Problemen und einschneidenden, lebensverändernden Erfahrungen beschränkt sich Claudia auf ein Minimum an Intimität gegenüber ihren Patienten, ihren Eltern und ihren „Freunden“. Auch zu ihrem Liebhaber Henry und ihrer Beziehung zu ihm, von der die Novelle im Rückblick erzählt, bewahrt sie stets Distanz. Für Henry empfindet sie kaum das Gefühl der Sympathie, er ist vielmehr regelmäßiger Bettgenos- se ohne emotionale oder persönliche Ansprüche auf Claudias Innenleben. Als er eines Tages bei einer Kneipenstreiterei erschlagen wird, ist bei Claudia kaum eine Gemütsre- gung festzustellen. Sie fühlt einzig ein wenig Mitleid mit sich selbst, da ihr durch einen Besuch in ihrer Heimatstadt - bei dem auch ein Teil ihrer emotionalen Kälte erklärt wird - klargeworden ist, dass auch sie nicht ganz ohne Liebe leben kann und will. Nach Henrys Tod wappnet sie sich jedoch für den weiteren Kampf gegen den Wunsch nach Geborgenheit, und das Buch endet mit einem kühl-optimistischen „Ich habe es ge- schafft. Mir geht es gut“1 ).
1.2. Definition von„Daseinsglück“und„Lebensverfehlung“
„Daseinsglück“ bedeutet für mich, dass der Mensch mit seiner Existenz zufrieden ist. Jeder Mensch ist auf eine sehr individuelle Art und Weise glücklich, d.h. sein Glück setzt sich aus verschiedenen, individuellen Faktoren zusammen. Diese Faktoren können sich je nach Alter, durch Erfahrung(en) etc. verändern.
Glücklich kann der Mensch sein, wenn er seine Probleme gelöst hat oder kein Problem in seiner Umgebung vorhanden ist. Letzteres ist sehr selten bis unmöglich, jedoch neigt der menschliche Geist zum „Theaterspielen“ vor sich selbst, d.h. er versucht durch das Verdrängen seiner Probleme sein Daseinsglück zu erhalten. Meiner Meinung nach han- delt es sich dann jedoch nicht mehr um krampfhaft erhaltenes Daseinsglück, sondern um „Lebensverfehlung“.
Einerseits lässt sich der Begriff „Lebensverfehlung“ so interpretieren, dass damit das Nicht-Erreichen eines Lebensziels definiert wird. In Bezugnahme auf die Aufgabenstel- lung und die Novelle habe ich jedoch eine andere Umschreibung für dieses Wort gefunden.
Für mich wird damit das „Vorbeileben am Leben“ beschrieben: Für keinen Menschen besteht das Leben nur aus positiven Aspekten. Einen Großteil seiner Existenz verbringt der Mensch mit Leid, Zweifeln an sich und anderen, schmerzhaftem Dazulernen durch Erfahrungen, mit seinen Emotionen und deren Ausleben, und damit, Fehler zu machen. Und doch gehört alles zusammen: Wirkliches Glück ist ohne Unglück nicht möglich. Wer nicht weint, kann nicht lachen, und hassen kann man nur, was man geliebt hat. Insofern gehören Freude und Kummer fest zusammen und zum Leben.
„Lebensverfehlung“ ist für mich daher mit Hoffnungsverlust, Resignation, Traumaufgabe, nicht Nachdenken und Teilnahmslosigkeit zu übersetzen.
2. Interpretation einiger Teilaspekte der Novelle
2.1. Formale Aspekte und ihre Wirkung
Bevor ich auf formale Aspekte in der Gestaltung des Prosatextes eingehe, möchte ich zunächst den Gegensatz zwischen Autor und Erzähler verdeutlichen. Der Autor Chris- toph Hein lässt die Geschichte des „fremden Freundes“ von einer Erzählerin berichten, um die Novelle verfremdet erscheinen zu lassen. Dies dient dazu, den Aspekt der Ent- fremdung der Menschen in der DDR noch deutlicher werden zu lassen. Denn schon durch den Gegensatz zwischen dem männlichen Autor und der weiblichen Erzählerin wird dem Leser keine eindeutige männliche oder weibliche Sicht der Geschehnisse ges- tattet. Der Leser kann sich so kaum in emotionale Nähe zur Handlung begeben, so dass ihm die Abkühlung der gesellschaftlichen bzw. zwischenmenschlichen Beziehungen im DDR-Staat verstärkt schmerzhaft bewusst wird.
Die Novelle „Der fremde Freund - Drachenblut“ wird in Ich-Form von der Hauptperson Claudia erzählt. Der Autor bezweckt, einen Anschein von Nähe zu und eine Art Intimi- tät des Lesers mit der Erzählerin zu schaffen. Die Erzählweise Claudias lässt den Leser zunächst in dem Glauben, es handele sich um eine Innensicht ihrer Erfahrungen. Dies stellt sich spätestens dann als Trugschluss heraus, als Claudia den Leser mit plötzlichen, unvermittelten Gefühlsäußerungen, z.B. „(...) [ich; d.Verf.] sagte ihm [Henry; d.Verf.], daß ich ihn sehr gern habe (...)“2 ), völlig überrascht. Dadurch wird noch deutlicher, dass niemand, auch nicht die vermeintliche Vertrauensperson Leser, in der Lage ist, den Schutzwall der Hauptperson (ihre „Drachenhaut“) zu durchdringen. Der Leser bekommt nur eine Außenansicht des Geschehens, und alles scheinbare Vertrauen streift letztend- lich höchstens die Oberfläche von Claudias Person oder Seele.
Wie Rüdiger Bernhardt bin ich der Meinung, dass die Hauptperson aufgrund der voran- gegangenen Aspekte keine Identifikationsfigur darstellt. Der Leser bleibt daher auf Dis- tanz zu der Figur. Dies wird durch Claudias auktoriales Erzählverhalten noch verstärkt. Durch den Erzählerstandort, der sich zwar in räumlicher Nähe zum Erlebten befindet, aber zeitliche und vor allem emotionale Entfernung vermittelt, bleibt dem Leser der emotionale Einbezug und Zutritt zur inneren Welt Claudias und der Handlung verwehrt. Claudia distanziert sich in ihrer Haltung vom Erlebten, sie verhält sich fast während der ganzen Novelle unbeteiligt, emotionslos, nahezu uninteressiert, als berichte sie die Ge- schichte einer Fremden.
In ihrer Erzählung verwendet sie sowohl indirekte als auch direkte Figurenrede (aller- dings ohne Anführungszeichen), um den Leser bisweilen in die Handlung hineinzuver- setzen, bevor sie ihn mit einem unvermittelten Gefühlseingeständnis oder einer Ent- scheidung wieder in seine ursprüngliche, vom Autor gewollte, distanzierte Teilnahmslosigkeit versetzt.
Ich glaube, behaupten zu können, dass alle formalen Aspekte in Heins Novelle dazu dienen, dem Leser die Handlung und die Figuren zu entziehen, um ihm die Situation der Charaktere unter dem DDR-Regime zu verdeutlichen. Wie Claudia oder auch Henry soll der Leser den gezwungenen Verrat an Freu(n)den und Idealen, und die daraus resultierende Entfremdung der Menschen von ihrem eigenen Leben spüren.
2.2. Titel und Prolog
In der DDR erschien Christoph Heins Novelle 1982 unter dem Titel „Der fremde Freund“. Meiner Meinung nach passt dieser Titel außerordentlich gut zum Inhalt des Textes, da in diesem von der Distanz in der Beziehung zweier Menschen erzählt wird. Er wird dort bereits der Gegensatz deutlich, der sich wie ein Leitmotiv durch die Novel- le zieht und von Rolf Michaelis sehr passend wie folgt zusammengefasst wird: „Freund und doch fremd, fremd und doch Freund“3 ). Für Claudia selbst ist keiner der Begriffe ohne den anderen möglich, denn sie hat nicht den W3 unsch, sich jemandem anzuver- trauen oder den anderen kennenzulernen. Der Titel ist ein erster Hinweis auf Claudias Beziehung zu Henry: Ihr genügt das körperliche Verhältnis, da es sie nicht in Pflichten einbindet. Für sie wird die Beziehung zu einem Menschen und das Ertragen derselben erst durch Distanz möglich.
Dies wird auch im Prolog dargestellt, der ganz eindeutig zu dem Titel in Beziehung gesetzt wird, als Claudia ihren gesichtslosen Begleiter ohne Zögern als einen Bekannten oder einen Freund identifiziert. Sie möchte nicht, dass ihre Freunde ein „Gesicht“, d.h. Sorgen, eine gewachsene Persönlichkeit etc. haben (vgl. 2.3. und 3.1.2.). Für sie genügt der äußere Eindruck, sie hat nicht den Wunsch, den anderen tiefer kennen zu lernen, indem sie ihm durch das Gesicht in die Seele blickt.
Der Prolog stellt laut Claudia nicht nur einen Traum dar, sondern den „Versuch einer Rekonstruktion“4 ). Während des Traumes beschäftigt sie sich zum letzten und einzigen Mal mit ihrer Beziehung zu Henry. Für den Leser bleiben ihre vagen Andeutungen zunächst unverständlich; erst nach der Lektüre der gesamten Novelle stellt er fest, dass ihm an dieser Stelle der einzige, wirkliche Einblick in Claudias Inneres und ihre wirren „Nicht-Gefühlen“ zu ihrem „fremden Freund“ gegeben wird.
Der Titel „Drachenblut“, unter dem das Buch in Westdeutschland erschien, spielt auf mystische Aspekte (Siegfried-Sage) an. Meiner Meinung nach ist dieser Titel eher un- glücklich gewählt, da sich Claudia ihrer eigenen Aussage nach unempfänglich für alles Mystische, Märchenhafte, Nicht-Wissenschaftliche fühlt. Und doch führt sie selbst den Vergleich des Bades in Drachenblut an: „Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos“5 ). Ihre Hülle dient als Schutzwall - einer- seits empfindet Claudia dies als positiv, denn so können ihr weder Vergewaltigung (S. 69/ 70), noch Ohrfeigen (S. 159/ 160) emotional etwas anhaben. Andererseits befürchtet sie, aus Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft in ihrer selbstgewählten Isolation zu ersticken. So wird bereits durch den Titel der Konflikt der Hauptfigur deutlich: Einge- panzert in ihre „Drachenhaut“ ist für Claudia keine Unzufriedenheit möglich, gleichzei- tig lehnt sie jedoch auch ihre selbst gewählte Isolation vom Leben ab.
Der ostdeutsche Titel ist, zusammenfassend gesprochen, passender für das Buch, da er sofort mit dem Prolog korrespondiert, und nicht wie der westdeutsche, eher reißerische Titel erst gegen Ende der Novelle verständlich wird.
2.3. Claudias Beziehung zu Henry
Die Beziehung zu Henry lässt sich aus Claudias Sicht in drei Phasen einteilen.
Die I. Phase beginnt im II. Kapitel mit dem unvermittelten Treffen von Henry und Claudia und endet im III. Kapitel. Während dieses Abschnitts besteht zwischen Claudia und Henry neben dem körperlichen Verhältnis keine emotionale Verbindung. Sie sehen als einzige „Brücke“ zwischen sich die gegenseitige Befriedigung sexueller Bedürfnis- se. Claudia gibt dem Leser gegenüber ein sehr offenes Eingeständnis dieser Fremdheit („... ich sagte, daß er mir sehr fremd sei. Er wollte wissen, warum ich das sage, aber ich gab ihm keine Erklärungen.“6 )). Sie geben sich keine Erklärungen - Kommunikation tritt an Wichtigkeit weit hinter den Geschlechtsverkehr zurück -, vielmehr ist Claudia ein bisschen stolz auf die Ungewöhnlichkeit der freiwillig erzwungenen Distanz und die Verantwortungslosigkeit gegenüber dem anderen. Beide fühlen sich nicht als Hälfte eines Ganzen, und jeder bleibt in seiner Haut für sich, da zumindest Claudia nicht den Wunsch verspürt, sich durch grenzenloses Vertrauen völlig zu offenbaren.
Henry und Claudia sind in dieser Phase zufrieden, weil keiner dem anderen Pflichten auferlegt.
Die II. Phase ist von Seiten Claudias von Unzufriedenheit geprägt. Sie beginnt im IV. Kapitel als Claudia feststellt, dass Henry ohne Ankündigung verreist ist. Offensichtlich beginnt sie, an ihm zu hängen, so dass sie zum ersten Mal während ihrer Erzählung wirkliches „Leben“ (Liebe und Liebeskummer, vgl. 1.2.) streift. Sie ist jedoch über sich selbst verärgert, da sie durch ihr Einsamkeitsgefühl ihre selbst getroffene Vereinbarung der Distanz bricht. Auch Henry wird bei seiner Rückkehr von ihr durch ihre Vorwürfe über seine unangekündigte Abreise enttäuscht. Als sie ihm spontan ihre Zuneigung be- kundet, warnt er sie vor emotionaler Liebe zu ihm, denn er benötigt (benutzt) sie ledig- lich, um seine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. In dieser II. Phase wird also durch ihre eigenen aufkeimenden Emotionen ein innerer Angriff auf Claudias „Dra- chenhaut“ geführt. Claudia fühlt sich durch ihre Sehnsucht beengt und sie versucht, ihre Gefühle unerkannt herauszulassen (Lachanfall unmittelbar vor der Vergewaltigung). Aber auch Henry beginnt unfreiwillig, seine Rücksichtslosigkeit gegenüber Claudia abzubauen. Dies wird deutlich, als er Claudia nach dem Beinah-Autounfall eine Ohrfei- ge gibt: Er ist verärgert über sich, da er eine Sekunde zu lang an ihre Angst vor zu schnellem Fahren dachte und dadurch unaufmerksam wurde. Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass die II. Phase das Bröckeln der gegenseitigen Distanz und damit einen neuen Abschnitt der Beziehung markiert. Claudia und Henry haben beide das Be- dürfnis, sich gegenseitig weh zu tun, um ihre Unabhängigkeit zu betonen.
Die III. Phase beginnt im VII. Kapitel und markiert den letzten Abschnitt der Bezie- hung. Sie wird im XII. Kapitel der Novelle fortgesetzt und mit dem Tod Henrys been- det. Aus dem Neuen ist für beide „Partner“ Gewohnheit geworden. Die regelmäßigen Treffen sollen für Claudia die Sicherheit bieten, die sie von Henry verlangt, als sie ihn bittet, sie nicht mehr mit unangemeldeten Besuchen etc. zu überraschen. Daher ist sie anders als in der I. Phase angekündigt, inzwischen mit dieser Art von Normalität zufrie- den. In ihrer Beziehung selbst haben sich Henry und Claudia wieder auf ihr sexuelles Verhältnis rückbezogen. Jeder weiß, dass der andere Probleme hat, ist aber nicht weiter an den genauen Umständen interessiert. Trotz ihrer innerlichen Ängste sind sie zufrie- den oder wollen zumindest so erscheinen. Ihr persönlichstes Gespräch besteht aus ei- nem Ritual, bei dem alles vorgegeben ist: „W7 ie geht es dir?“ - „Gut“7 ). Damit führen die beiden das in 1.2. beschriebene „Glückstheater“ der Lebensverfehlung auf. Aber die Perspektivlosigkeit der Beziehung und ihre Interesselosigkeit in Bezug auf eine gemein- same Beziehung ist von beiden gewollt - sie leben zusammen in ihrer kleinen, heilen Welt und vielleicht wollen sie sich damit eine Entschädigung für ihre Kindheit verschaffen. Denn von Claudia wissen wir um ihre zerstörte Illusion des Erwachsenwerdens (vgl. 3.1.1.), Henry deutet an einer Stelle unangenehme Kindheitserlebnisse an. Henry und Claudia führen ein Theaterstück voll teilnahmslosen Glückes auf - obwohl sie beide wissen, dass ihre „Insel“ schon längst voller Schwierigkeiten steckt. Beide versteifen sich jedoch auf ihr Nichtwissen-wollen.
2.4. Tod Henrys und Claudias Bewältigung seines Todes
Ebenso, wie sich die Beziehung zwischen Henry und Claudia in drei Teile gliedern lässt, ist es möglich, die Zeit nach Henrys Tod ebenfalls in drei Phasen zu unterteilen. In der I. Phase ist Claudia benommen - sie selbst gibt dem Leser eine Beschreibung ihres verwirrten Zustandes, als ihre Nachbarin ihr von Henrys Tod berichtet. Aber ihr „Emotionsschutzwall“ hält den Verlust Henrys aus, auch wenn sich zunächst Risse im Panzer zeigen: Claudia hat das Bedürfnis, einen Entschluss zu fassen, aber nicht nur der Leser bleibt über das Motiv und das Thema dieses Entschlusses im Unklaren. Auch Claudia ist ratlos, sie stellt erstmals wirklich erschrocken fest, dass ihr Henry bis auf Name und Körper völlig unbekannt ist. Ein wenig fühlt sie sich schuldig, meint ihm mit dem Beerdigungsbesuch die letzte Ehre erweisen und die Vertrautheit zeigen zu müs- sen, die sie mit dem Toten niemals hatte. Nach der Beerdigung versucht sie, sich per- sönlich an Henry zu erinnern, da ihr die Beerdigung keine Beruhigung gegeben hatt. Doch der Versuch bleibt erfolglos. Schließlich reagiert Claudia auf ihre vertraute und normale Art: Sie verdrängt Henry aus ihrem Leben, indem sie das Nachdenken über ihre Beziehung und alles Ihnbetreffende einfach aufgibt. Dies fällt ihr relativ leicht, da Hen- ry (sein Versprechen haltend) nicht überraschend stirbt. Claudia ist in diesem Punkt jedoch über sich selbst erstaunt, da sie seinen Tod weder geahnt noch befürchtet hat. Es lässt sich formulieren, dass Henrys Tod gewissermaßen in Claudias Augen die logische Fortsetzung der Beziehung ist: Zu der emotionalen Distanz im Leben kommt nun im Tode die räumliche und körperliche Entfernung.
Die II. Phase ist eine Zeit der Umgewöhnung. Claudia trauert nicht um Henry, da sie es als sinnlos empfindet, verspätete Verbundenheit mit dem Toten zu demonstrieren und den Wert ihrer Beziehung dadurch im Nachhinein scheinbar und unaufrichtig zu erhö- hen. Das einzige „Gefühl“, wenn dieser Ausdruck für Claudias Regung angemessen ist, ist reines Selbstmitleid. Trotz ihrer Vereinbarung scheint Claudia etwas wie Anspruch auf Henrys Gegenwart zu erheben, obwohl sie es vor sich selbst nicht zugibt. Sie er- wähnt zwar ihren „schweren, süßlichen Wunsch, geborgen zu sein“8 ), lehnt ihn aber glei9 chzeitig ab. Ihr Sehnsuchtsgefühl ist körperlos, sie vermisst Henry nicht als Person, sondern eher als Zustand. Daher überlegt Claudia zeitweise, ob sie ein Kind adoptieren soll. In „sentimentalen Momenten“ glaubt sie, durch ein Kind ins Leben zurückkehren und ihre Existenz mit Sinn füllen zu können. Sie erkennt jedoch, dass ein Kind ebenso wie Henry nur als Schauspieler in ihrem „Glückstheater“ dienen würde und verwirft daher diesen Gedanken. Sie sieht sich selbst als Kopfmenschen, daher benutzt sie ihren Verstand gegen ihre aufkommenden Gefühle und ihre Einsamkeit, und zwingt sich zu- rück in ihr „Theaterstück“ der „nette[n], sehr normale[n] Frau“9 ). Dies gelingt ihr letzt- endlich - auch allein.
Ein halbes Jahr nach Henrys Beerdigung hat Claudia in der III. Phase wieder ihren an- gestrebten Zustand des scheinbaren Glückes erreicht hat. Sie berichtet, dass sie wieder einen neuen Freund habe und einigermaßen zufrieden sei. Sie hat sich ihre neue - alte - Existenz (wieder) aufgebaut - ein neuer Freund ersetzt Henry und ohne, dass Claudia sich dazu äußert, ahnt der Leser, dass die neue Beziehung der zu Henry in Distanz und Gefühlskälte ähnlich ist. Trotz all dem hat Claudia während des Verhältnisses zu Henry gelernt. Sie tut ihre Liebe zu ihrer Jugendfreundin nicht mehr als Kinderei ab, sondern gibt ehrlich zu, dass sie Katharina und ihre Vertrautheit vermisst. Sie trauert ganz offen ihrer Vergangenheit als sorgloses und impulsives Kind (vgl. 3.1.1.) nach. Sie schätzt ihre Vernunft und ihre „Drachenhaut“, aber gleichzeitig verspürt sie in ihrem Leben nach Henry eine Leere, an der sie zu ersticken droht: „Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In meiner unverletzbaren Hülle werde ich krepieren an Sehnsucht nach Katharina“10 ). Claudia spürt die Widersprüche in ihrer Haltung zum Leben, doch schließlich verdrängt sie diese energisch wie alle anderen Schwierigkeiten mit tristem Alltag von ihrer „Bühne“. Die Novelle endet mit ihrer unglaubwürdigen Aussage: „Meine Haut ist in Ordnung. (...) Alles was ich erreichen konnte, habe ich erreicht. Ich wüßte nichts, was mir fehlt. Ich habe es geschafft. Mir geht es gut“11 ).
3. Charakterisierung der Hauptfiguren
3.1. Claudias Leben und Verhältnis zu sich selbst
3.1.1. Veränderung der Lebenseinstellung
Claudia macht im Laufe ihres Lebens - zum Zeitpunkt der Handlung der Novelle ist sie neununddreißig, bzw. vierzig Jahre alt - mehrere Veränderungen ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebenseinstellung durch.
Ihre Kindheit verbringt sie (bis zu ihrer Aufklärung) als glückliches, kleines Mädchen, zufrieden mit ihrem Leben. Claudia ist damals noch in der Lage, Mitmenschen zu vertrauen und bringt ihrer Jugendfreundin Katharina bedingungslose Liebe entgegen. Sie geht sogar so weit, sich mit dieser bis auf die Gottesvorstellung identifizieren zu wollen. Als kleines Mädchen hegt Claudia die große Hoffnung, ihren Traummann zu finden und ein Leben mit ihrer „großen Liebe“ verbringen zu können.
Mit der brutalen und rücksichtslosen Aufklärung durch ihre Mutter wird diese heile Welt voller Träume zerstört. Claudia verliert ihren Glauben an die Liebe und lehnt da- mit auch Erwachsenwerden und Heiraten ab. Ihr werden ihr Lebensziel und ihr Traum vom emotionalen Daseinsglück genommen. Sie bekommt ein „verquaste[s; d.Verf.] Bild von Sexualität“12 ), das ihr jahrelang keine normale Beziehung zu Männern ermög- licht. In gewissem Maße ist die rein körperliche Beziehung zu Henry (vgl. 2.3.) eine Folge dieser Einstellung: Da Claudia nicht mehr an die Liebe glaubt, ist für sie nur eine rein körperliche Beziehung möglich. Gleichzeitig beginnt sie, ihre Zuneigung und ihr Vertrauen zu ihren Eltern zu verlieren.
Dazu kommt, dass in dieser Phase ihre Freundschaft mit Katharina durch staatliche, öffentliche und schulische Einflüsse so weit untergraben wird bis Claudia ihre Freundin öffentlich beleidigt. Zurück bleibt bei beiden Mädchen unversöhnlicher Hass auf die andere. Danach ist Claudia nicht mehr in der Lage, sich einem anderen Menschen anzuvertrauen, da sie das Gefühl hat, sonst um sich selbst betrogen zu werden. Sie glaubt, dass jedes Vertrauen zu anderen letztendlich zerstört werden und sich nachteilig auswirken müsse. Daher zieht sie zur Zeit der Novellenhandlung für sich den Schluss: „Wahrscheinlich brauche ich keine Freunde“13 ).
Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch Claudias Bild von sich selbst noch in Ordnung. Dies wird erst zerstört, als sie von den Naziverbrechen ihres Onkels erfährt. Von diesem Zeitpunkt an verliert sie stetig an Selbstwertgefühl und klagt sich fortwährend für Verbrechen an, an denen sie keine Schuld trifft. Als ihr ein Mitschüler sagt, dass er sie deshalb für arrogant hält, reagiert Claudia zum ersten Mal in ihrer später typischen Weise: Sie beginnt zu schweigen. Zunächst geschieht dies als „äußeres“ Schweigen, da sie andere nicht durch ihre Problemen stören will. A1 ls dieses System scheinbar Wirkung zeigt, wendet sie das Schweigen auch „innerlich“ an: Sie versteckt ihre Schwierigkeiten auch vor sich selbst, indem sie jegliche Gedanken daran ablehnt.
Claudia geht sogar so weit, diese Verdrängung als die Grundlage der gesamten Zivilisation zu bezeichnen. Dabei bezieht sie ihr eigenes „Lebensprogramm“14 ) auf alle anderen Menschen, denn bei ihr selbst haben sich im Laufe der Jahre so viele Probleme angelagert, dass sie unter ihnen ersticken würde, wenn sie ihnen die Möglichkeiten gäbe. Aber sie schützt sich mit ihrer „Drachenhaut“ sowohl gegen Probleme von außen als auch gegen die Angst, die ihre Probleme von innen aufzubrechen droht. Daraus ergibt sich ihre Lebensanschauung: „Meine Träume können nicht mehr beschädigt werden, meine Ängste nicht mehr gelöscht“15 ). Claudia hat vollkommen resigniert und tarnt dies vor anderen und sich selbst als Maßnahme, um glücklich zu sein .
Erst mit Henry kommt ihr unerwünschtes Verlangen nach Geborgenheit und Glück wieder hoch, das nach seinem Tod in dem Wunsch nach einem Adoptivkind gipfelt. Gewissermaßen hat Henry Claudias letzte „Lebens-Geister“ geweckt, die jahrelang unter der Last von Alltag und Verdrängen verborgen gewesen waren. Und doch ringt Claudia mit diesem Wunsch wie mit einem Gegner. Am Ende der Novelle hat sie ihn besiegt, und sie kann durch neues, inneres Schweigen beruhigt von sich sagen, dass sie es „geschafft“ hat und es ihr wieder gut geht.
3.1.2. Veränderung des Verhältnisses zu Mitmenschen
Innerhalb von Claudias Leben treten zwei wichtige Änderungen in ihrem Verhalten gegenüber ihren Freunden und ihren Eltern ein, die letztendlich Claudias Kälte gegenüber ihren Patienten bewirken.
Als kleines Mädchen bringt Claudia ihren Eltern uneingeschränktes kindliches Vertrauen entgegen. Sie glaubt ihren Eltern alles, was diese ihr als Rat oder Anweisung auf den Weg geben - unabhängig davon, ob es ihre eigene Persönlichkeit einschränkt oder wirklich nützlich ist. So lässt sie sich durch die brutale Aufklärung völlig einschüchtern und vertraut ihren Eltern aufgrund ihrer „Erfahrung“.
Später stellt Claudia jedoch fest, dass ihre Entwicklung regelrecht erdrückt wurde, in- dem sie sich als kleines Mädchen zum „Angstabladeplatz“ ihrer Eltern machen ließ. Sie beginnt zaghaft zu rebellieren. Anders als Jugendliche, die diese Phase in der Pubertät durchleben und mit neuen Wertvorstellungen gegen ihre Eltern revoltieren, straft die Erwachsenen Claudia ihre Eltern mit Liebesentzug. Sie lässt sie nicht an ihrer Arbeit oder ihren Erlebnissen teilhaben, verweigert Besuche und Trost. Sie fühlt sich nicht verantwortlich oder verpflichtet gegenüber ihren Eltern, da diese ihrer Meinung nach ihre Jugend zerstört haben.
Ähnlich verändert sich Claudias Verhältnis zu ihren Freunden. Als kleines Mädchen ist sie in der Lage, ihre Freundin Katharina rückhaltlos zu lieben und ihr alles anzuvertrau- en. Durch den Druck des Staates (ausgeübt durch Eltern, Lehrer und Mitmenschen) wandelt sich dieses Vertrauen zunächst in oberflächliche Freundschaft, bis Claudia Ka- tharina schließlich offen verleugnet. Danach beginnt Claudias Verkapselung. Später ist sie nicht einmal in der Lage, sich für die Situation ihrer Freundin, die regelmäßig ver- gewaltigt wird, zu interessieren. Sie lehnt schon den Gedanken ab, dass sie selbst in der Lage sei, mit Worten oder Handeln zu helfen. Claudia macht sich selbst zur neutralen Beobachterin ihrer Umwelt. Dies wird auch dadurch deutlich, dass sie an einer Zeitung einzig die Annoncen interessieren, weil diese einen verpflichtungslosen Einblick ins Privatleben anderer ermöglichen.
Später bereut Claudia die Trennung von Katharina und ihr Verhalten, jedoch ist sie nicht in der Lage, neue Freundschaften zu knüpfen. Dies zeigt sich, als sie im Urlaub bei Freunden das „schöne Mädchen“ trifft. Claudia macht sich auch bei ihr nicht die Mühe, etwas über ihre Persönlichkeit herauszufinden oder mit ihr ins Gespräch zu kommen. Die reine Existenz der anderen genügt ihr. Auch oberflächliche, emotionslose Nachbarschaftsbekanntschaften werden von Claudia abgelehnt, da diese ihrer Meinung nach nur unnötige Verpflichtungen wie gezwungene, sinnlose Gespräche etc. mit sich führen.
Beide Veränderungen in Claudias Verhältnis führen dazu, dass ein sozialer Beruf der denkbar schlechteste Berufszweig für sie darstellt. Am liebsten würde Claudia ihre Pati- enten ohne persönlichen Kontakt mit Medikamenten versorgen. Sie möchte nur Wir- kungen, aber keine Ursachen beseitigen, da dies ein persönliches Befassen mit dem Menschen hinter der Krankheit bedeuten würde. Claudia möchte jedoch ihr Inneres von fremden Problemen verschonen, da dies sonst ein zwangsweises Nachdenken oder Pa- rallelen ziehen zu ihren eigenen Schwierigkeiten und deren Ursachen nach sich ziehen würde (vgl. 3.1.1.).
3.1.3. Elemente von Claudias Daseinsglück
Claudia strebt in ihrem Leben nicht nach Glück direkt, sondern vielmehr nach Zufrie- denheit und Sorgenfreiheit, was für sie vor allem eine Existenz ohne Nachdenken be- deutet. Dieses Schweigen bezieht sich aus einer Distanz zu sich selbst. Diese Entfer- nung zu ihrer Person liegt wiederum im Verschweigen ihrer Probleme begründet, denn dadurch wird ein „Kennenlernen“ der Person Claudia für alle unmöglich. Dies ist von Claudia beabsichtigt.
Um die Sicherheit ihrer „Drachenhaut“, d.h. ihre Emotionslosigkeit, zu gewährleisten, lehnt Claudia jede Überraschung ab.
Sie benötigt keine Vertrauensbeweise - weder von Freunden noch von Fremden -, da dies für sie ebenfalls ein sich Anvertrauen zur Folge hätte. Für Claudia steht Vertrauen gleichbedeutend mit Selbstverrat, da sie als Kind durch das Vertrauen zu ihren Eltern in ihrer selbstständigen Entwicklung in Bezug auf Sexualität und Freundschaft gehemmt wurde.
Ihr Bedarf nach Liebe erstreckt sich lediglich auf den körperlichen Bereich - ihre Ge- fühls-„Freiheit“ ist für Claudia Lebensphilosophie. Trotz ihrer Versuche, sich von den Vorurteilen ihrer Eltern zu lösen, ist es ihr nicht möglich, einen Mann zu lieben. Also versucht Claudia durch rein körperliche, gewollt „ungewöhnliche“ Verhältnisse zu Männern, wenigstens ihre Verachtung für die Moralvorstellungen ihrer Eltern deutlich zu machen. Ist ihr dieser Weg trotz Emotionsverdrängung (z.B. in ihrer Ehe oder bei ihrer Abtreibung) unangenehm, entzieht sie sich durch Körperflucht der Realität, anstatt das Problem direkt anzugehen.
Ein wichtiges Element ihres gekünstelten Glückes ist für Claudia paradoxerweise ihre eigene „Normalität“. Obwohl sie bei ihrer Beziehung zu Henry auf der Vermeidung von Alltäglichkeit besteht, beruft sie sich bei sich selbst auf ihre eigene Durchschnittlichkeit, sie hält sich für eine „nette, sehr normale Frau“16 ). Dies betont sie immer wieder und klammert sich an diese Vorstellung von Ordnung, wenn Ereignisse wie die Vergewaltigung durch Henry drohen, ihre „Drachenhaut“ zu zerstören.
Zusammenfassen lässt sich Claudias „Glückstheater“ in drei Begriffen: Schweigen, Misstrauen und Befriedigung körperlicher Bedürfnisse.
3.2. Lebenseinstellung und Bedeutung von Daseinsglück für Henry
Anders als Claudia, die längst unter ihrer „Drachenhaut“ resigniert hat, ist Henry immer noch auf der Suche nach dem Lebensglück und dem Sinn seiner Existenz. Schon sein lebenskräftiger Name verdeutlicht seine Lebensanschauung.
Am deutlichsten wird dieser Wunsch nach Er-Leben jedoch in seinem Ausspruch: „Ich lebe, aber wozu. Der ungeheuerliche Witz, daß ich auf der Welt bin, wird doch eine Pointe haben“17 ). Dabei hat er ständig Angst, etwas zu verpassen - Angst am Leben vorbei zu existieren. Er verachtet Menschen, die ihre Existenz mit Warten in Langeweile verbringen. Dies wird deutlich, wenn er mit Claudia über verschiedene Cliquen Jugendlicher spricht, die den beiden im Laufe der Novelle begegnen.
Er versucht, Langeweile bei sich selbst zu vermeiden, daher kommt ihm auch die rela- tiv ungewöhnliche Beziehung mit Claudia sehr recht. Mit ihr kann er seine sexuellen Bedürfnisse ausleben, ohne zu ihnen verpflichtet zu werden. Vermutlich hat er genau wie Claudia nicht das Verlangen nach „All-Täglichkeit“. Dies spiegelt sich auch in dem stummen Abkommen wider, dass Henry und Claudia geschlossen haben: Sie wollen beide den anderen nicht mit eigenen Sorgen belasten oder gezwungenermaßen aufein- ander Rücksicht nehmen. Henry ist seine Freiheit dabei fast noch wichtiger als Claudia, denn er reagiert empfindlich und verärgert, als sie ihn zum Beispiel nach seiner Reise fragt, wo er gewesen sei. Sein „Lebensziel“ besteht nur darin, selbst nicht enttäuscht zu werden und niemand zu enttäuschen (das allerdings ohne sich selbst einzuschränken oder seine Persönlichkeit zu verändern).
Er sucht sein Glück im Augenblick : Was ihm in einem Moment als gut erscheint, ge- nießt er - unabhängig davon, ob es im nächsten Moment ungünstige Auswirkungen hat. Wenn dem so ist, lebt Henry mit den Folgen, ohne sich zu beschweren oder nachträg- lich etwas verändern zu wollen. Er sucht keinen Tiefgang in seinen Handlungen und lässt Analysen anderer nicht zu. Ihm genügt zu wissen, was ihm gefällt, nicht warum. Seine „Lebens-Freude“ zeigt sich jedoch eher in „materiellen“ als in emotionalen Er- lebnissen. Henry sagt dazu über sich selbst, dass ihm Auto fahren sehr viel bedeute, weil er dabei das Leben spüre. Er hat Spaß daran, mit seinem Leben zu spielen, „seine Haut so teuer wie möglich [zu; d.Verf.] verkaufen“18 ). An einer Beziehung zu einer Frau scheint ihm der sexuelle Aspekt am wichtigsten zu sein (wie durch seine häufigen Fra- gen danach deutlich wird), da er ihm ein unmittelbares Fühlen des eigenen Lebens er- möglicht.
Anders als Claudia sucht Henry keine Gründe für sein Verhalten. Claudia lehnt zwar ab, nachzudenken, aber sie schiebt all ihre Ängste und Verhaltensweisen doch auf ihre Kindheitserlebnisse (Aufklärung, Sportunterricht etc.). Henry ist mit dem, was er im Moment ist, zufrieden und versucht für sich das maximale „Er-Lebnis“ herauszuholen. Er sucht nicht nach dem Schuldigen für seine Verhaltensweisen.
Henry benötigt keine Gründe für sein Verhalten, ihm genügen kurzzeitige Momente des Leben-Fühlens.
III. Schlussteil
1. Daseinsglück oder Lebensverfehlung?
Auf die Frage, ob es sich bei Christoph Heins Werk um eine Verdeutlichung von Daseinsglück oder Lebensverfehlung handelt, gibt es keine eindeutige Antwort. Der Autor versucht vielmehr durch den Anschein von Daseinsglück die Verfehlung in Claudias Leben noch schonungsloser aufzudecken.
Claudia stellt sich dem Leser meist so dar, als sei sie mit ihrem Leben zufrieden, aber dieser Eindruck besteht für diesen bestenfalls am Anfang. Schnell findet er heraus, dass auch Claudia selbst mit ihrem Dasein alles andere als glücklich ist. Besonders deutlich wird dies nach Henrys Tod - plötzlich spürt Claudia ihre eigene Verlassenheit, wobei sicher nicht die Abwesenheit von Henry, sondern vielmehr die Abwesenheit jeglichen Lebenssinnes gemeint ist - und in ihrem Wunsch, Katharina wiederzusehen. Claudia mag zwar unter dem Schutz ihrer „Drachenhaut“ scheinbar problemfrei existieren zu können - aber es bleibt bei einer „Existenz“, und diese ist nach der Definition von 1.2. kaum als „Leben“ zu bezeichnen. Der positivste Ausdruck, der sich auf Claudias „Sys- tem“ des Überlebens anwenden lässt, ist „Zufriedenheit“, denn durch ihr inneres und äußeres Schweigen schafft Claudia sich einen trügerischen Seelenfrieden.
So wird in Heins Novelle die traurigste Form der Lebensverfehlung deutlich gemacht: Claudia kennt weder die negativen Seiten des menschlichen Lebens - da sie diese ver- drängt - noch ist ihr wirkliche Freude bekannt. Sie weiß daher nicht, was „Leben“ wirk- lich bedeutet. Sie balanciert stets auf dem schmalen Grad zwischen Verzweiflung über ihre Probleme und Wahnsinn durch die Verdrängung ihrer Schwierigkeiten. Durch die- sen Balanceakt ist sie so in Anspruch genommen, dass sie Möglichkeiten, zum Leben zurückzukehren (Verliebtheit, Beziehungskrisen, Freundschaften etc.) überhaupt nicht wahrnehmen kann - oder könnte, wenn sie wollte. Vielmehr propagiert sie durch ihre Einstellung Daseinsglück durch Lebensverfehlung. Sie glaubt ihr „Leben“ nur dadurch erhalten zu können, indem sie es ablehnt.
Meiner Meinung nach will Christoph Hein den Leser mit seiner Novelle auf diese Haltung aufmerksam machen. Hein möchte ihn davon abhalten, seine Existenz zu einem emotionslosen Theaterstück der Zufriedenheit zu machen, da Hein selbst dieses „Glück“ weder als zufriedenstellend noch als dauerhaft empfindet.
Zusammenfassend glaube ich, dass Heins „Der fremde Freund - Drachenblut“ ein Werk zur Verdeutlichung des Problems „Lebensverfehlung“ anhand scheinbaren Glückes dar- stellt. Indem er darstellt, wie dünn die (Drachen-)Haut unechter Zufriedenheit ist, lässt er den Leser hinter die Fassade von Claudias Schweigen schauen und gemeinsam mit der Hauptfigur entdeckt der Leser die Abgründe aller verdrängten Probleme. Anders als Claudia ist der Leser jedoch nicht in der Lage, diesen Einblick zu ignorieren. Während sie am Ende der Novelle wieder von ihrer Wunschlosigkeit und ihrem „Glück“ über- zeugt ist, bleibt beim Leser das Gefühl einer vollkommen lebensarmen und versäumten Existenz zurück.
Dieses Gefühl kann auch von Henry und seinem Hunger nach Leben kaum verdrängt werden, denn trotz seiner Rolle als zweite Hauptfigur der Novelle bleibt Henrys Dasein nahezu unbedeutend im Vergleich zu Claudias geballter Verdrängung und Lebensver- fehlung.
[...]
1 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 212
2 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 59
3 Baier, Lothar (Hrsg.). Christoph Hein. Texte, Daten, Bilder. Frankfurt a.M. 1990. Daraus: Michaelis, Rolf. Leben ohne zu leben. 1983. S. 145
4 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 7
5 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 209
6 Hein, Christoph. a.a.O. S. 38
7 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 200
8 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 68
9 Hein, Christoph. a.a.O. S. 162
10 Hein, Christoph. a.a.O. S. 209
11 Hein, Christoph. a.a.O. S. 212
12 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 142
13 Hein, Christoph. a.a.O. S.83
14 Baier, Lothar (Hrsg.). Christoph Hein. Texte, Daten, Bilder. Frankfurt a.M. 1990. Daraus: Bernhardt, Rrüdiger. Für und Wider. 1983. S. 142
15 Hein, Cristoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 139
16 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 162
17 Hein, Christoph. Der fremde Freund - Drachenblut. Berlin/ Weimar 1982. S. 30
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Christoph Heins Novelle "Der fremde Freund - Drachenblut"?
Die Novelle "Der fremde Freund - Drachenblut" von Christoph Hein thematisiert das Leben der emotionslosen Ärztin Claudia und ihre Beziehung zu sich selbst und den Menschen um sie herum, insbesondere zu ihrem Liebhaber Henry. Sie bewahrt stets Distanz, um sich vor tiefgreifenden Problemen und lebensverändernden Erfahrungen zu schützen. Die Novelle untersucht, ob Claudias Lebensweise als Daseinsglück oder Lebensverfehlung zu interpretieren ist.
Was bedeutet "Daseinsglück" und "Lebensverfehlung" im Kontext dieser Facharbeit?
"Daseinsglück" wird als Zufriedenheit mit der eigenen Existenz definiert, wobei das Glück aus individuellen Faktoren besteht, die sich im Laufe des Lebens verändern können. "Lebensverfehlung" hingegen beschreibt das "Vorbeileben am Leben", d.h. die Vermeidung von Leid, Zweifeln, Emotionen und Fehlern, die zum Leben dazugehören. Es wird mit Hoffnungsverlust, Resignation, Traumaufgabe, nicht Nachdenken und Teilnahmslosigkeit in Verbindung gebracht.
Welche formalen Aspekte der Novelle werden analysiert und welche Wirkung haben sie?
Die Analyse konzentriert sich auf den Gegensatz zwischen Autor und Erzähler (weibliche Erzählerin), die Ich-Form der Erzählung, das auktoriale Erzählverhalten Claudias sowie die Verwendung von direkter und indirekter Figurenrede. Diese Aspekte dienen dazu, die Entfremdung der Menschen in der DDR zu verdeutlichen und Distanz zwischen Leser und Handlung zu schaffen.
Wie wird der Titel "Der fremde Freund - Drachenblut" interpretiert?
Der Titel "Der fremde Freund" wird als passend für den Inhalt der Novelle betrachtet, da er die Distanz in der Beziehung zwischen Claudia und Henry verdeutlicht. Der Titel "Drachenblut" hingegen wird kritisch gesehen, da er mystische Aspekte anspricht, die Claudia ablehnt. Er verweist jedoch auf Claudias Schutzwall, der sie zwar unverletzlich macht, aber auch von Liebe und Freundschaft isoliert.
Wie entwickelt sich Claudias Beziehung zu Henry im Laufe der Novelle?
Die Beziehung zu Henry wird in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase besteht neben dem körperlichen Verhältnis keine emotionale Verbindung. In der zweiten Phase verspürt Claudia Unzufriedenheit und beginnt, an Henry zu hängen. In der dritten Phase wird die Beziehung zur Gewohnheit, wobei beide Partner in ihrer kleinen, heilen Welt leben, obwohl sie um ihre Probleme wissen.
Wie bewältigt Claudia den Tod von Henry?
Die Zeit nach Henrys Tod wird ebenfalls in drei Phasen unterteilt. Zunächst ist Claudia benommen und verdrängt den Verlust. In der zweiten Phase empfindet sie Selbstmitleid und erwägt kurzzeitig die Adoption eines Kindes. In der dritten Phase hat sie ihren Zustand des scheinbaren Glücks wieder erreicht und eine neue Beziehung begonnen, aber sie verspürt gleichzeitig eine Leere in ihrem Leben.
Wie verändert sich Claudias Lebenseinstellung im Laufe ihres Lebens?
Claudia durchläuft mehrere Veränderungen. Ihre Kindheit verbringt sie als glückliches Mädchen, bis sie durch die Aufklärung ihrer Mutter ihren Glauben an die Liebe verliert. Später erfährt sie von den Naziverbrechen ihres Onkels, was ihr Selbstwertgefühl weiter mindert. Sie entwickelt eine Verdrängungsstrategie, um ihre Probleme zu bewältigen und sich vor Verletzungen zu schützen.
Wie verändert sich Claudias Verhältnis zu ihren Mitmenschen?
Claudia verliert im Laufe ihres Lebens das Vertrauen zu ihren Eltern und Freunden. Sie lässt sich durch die Aufklärung ihrer Mutter einschüchtern und wendet sich von ihrer Freundin Katharina ab. Später ist sie nicht mehr in der Lage, neue Freundschaften zu knüpfen und distanziert sich von ihren Patienten.
Was sind die Elemente von Claudias Daseinsglück?
Claudia strebt nicht nach Glück, sondern nach Zufriedenheit und Sorgenfreiheit, was für sie vor allem eine Existenz ohne Nachdenken bedeutet. Sie lehnt Überraschungen und Vertrauensbeweise ab und beschränkt ihre Bedürfnisse auf den körperlichen Bereich. Paradoxerweise klammert sie sich an ihre eigene "Normalität".
Wie wird Henrys Lebenseinstellung dargestellt?
Henry ist im Gegensatz zu Claudia auf der Suche nach dem Lebensglück und dem Sinn seiner Existenz. Er hat Angst, etwas zu verpassen und verachtet Langeweile. Er sucht sein Glück im Augenblick und genießt das Leben, ohne sich um die Folgen zu kümmern.
Kommt die Facharbeit zu dem Schluss, dass Christoph Heins Werk Daseinsglück oder Lebensverfehlung verdeutlicht?
Es gibt keine eindeutige Antwort. Der Autor versucht, durch den Anschein von Daseinsglück die Verfehlung in Claudias Leben schonungsloser aufzudecken. Hein möchte den Leser davon abhalten, seine Existenz zu einem emotionslosen Theaterstück der Zufriedenheit zu machen.
- Citar trabajo
- Sabine Wirsching (Autor), 2001, Hein, Christoph - Der fremde Freund - Daseinsglück oder Lebensverfehlung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105434