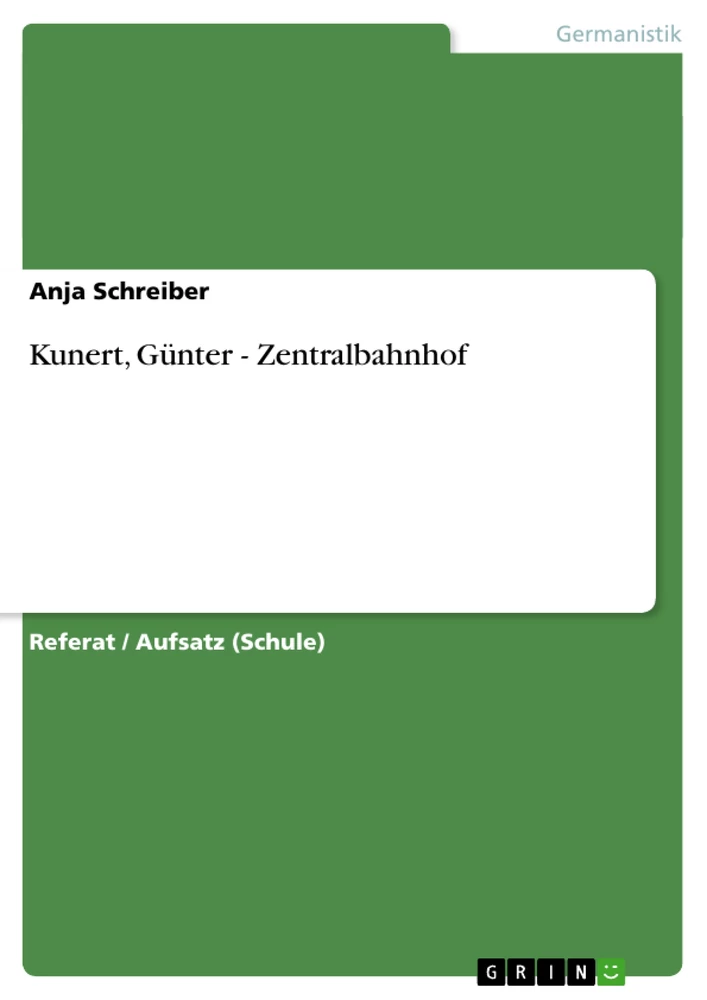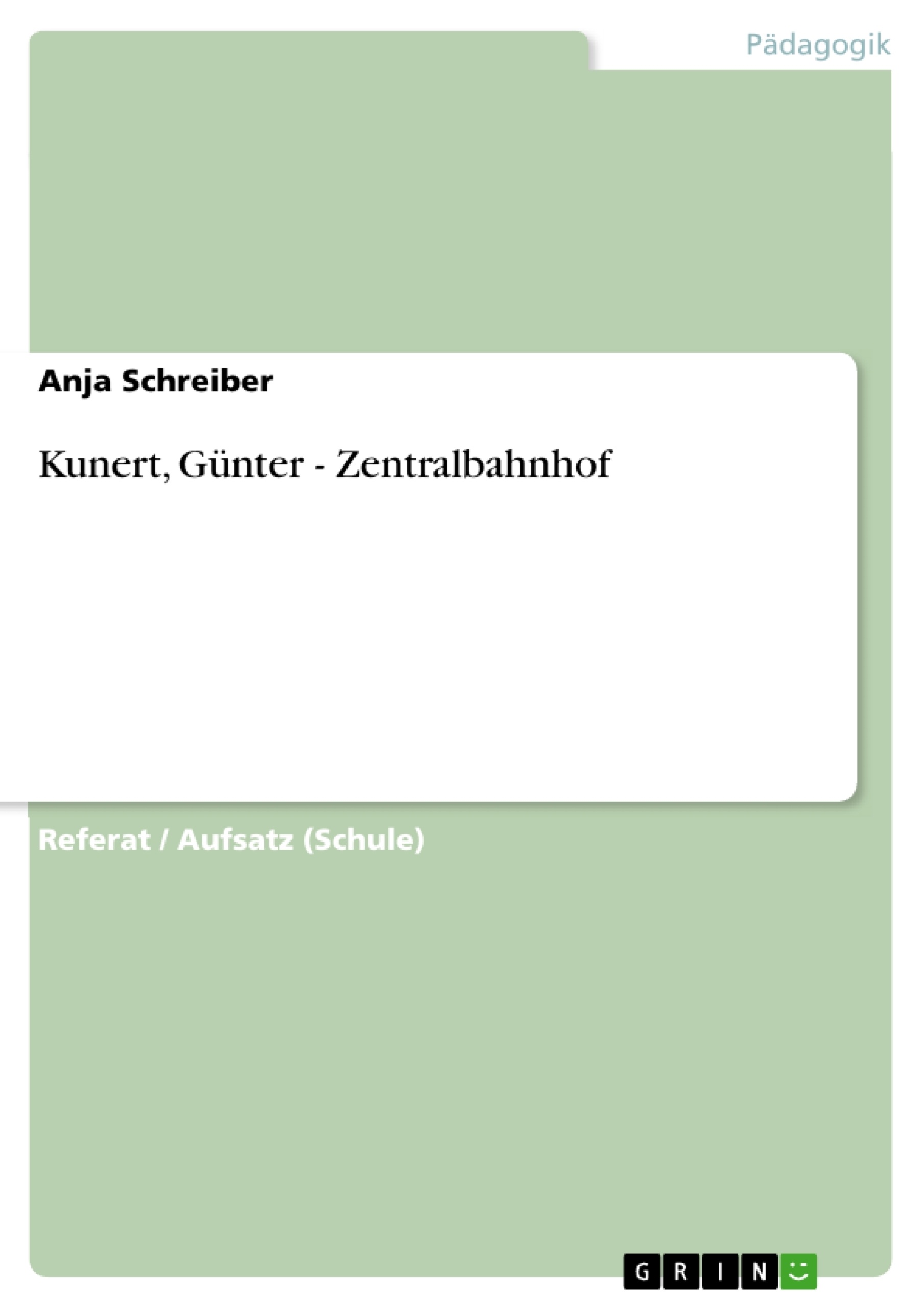Einleitung und Kontext
Zentralbahnhof
ist ein Text von Günter Kunert, geschrieben im Jahr 1972. Kunert wurde 1929 in Berlin (Ost) geboren, wo er bis 1979 lebte. Seither lebt er in der BRD. Typisch für ihn als Schriftsteller ist es, daß er versucht mit pessimistischer Grundstimmung Probleme der Vergangenheit als auch die Gegenwart detailliert und kritisch zu beschreiben.
Auch der Text Zentralbahnhof
schildert ein Problem. Er handelt von einem Jemand
, der ein Schreiben bekommt, in dem deutlich steht, daß er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt am Zentralbahnhof
zu seiner Hinrichtung
einzufinden hat. Er weiß weder ein noch aus. Selbst von seinen Freunden und seinem Rechtsanwalt erntet er nur nichtssagenden Blicke und Anworten. Nach vergeblichem Hoffen und Vertrauen kommt ein harter, fast filmischer Schnitt. Es erscheinen zwei Angestellte, die den Leichnam aus der Bahnhofstoilette ziehen. Man weiß nicht so recht, was passiert ist. Nach einer Hinrichtung scheint es im ersten Moment jedenfalls nicht. Der Text fesselt schnell die Aufmerksamkeit der Leser und Leserinnen. Er wirkt jedoch verstörend, weil ein emotionsloses Lebensende eines Jemands
beschrieben wird. Durch dieses offene Ende wirkt er zudem recht unverständlich, denn man fragt sich: Wie ist der Jemand
gestorben? Der Leser fühlt sich förmlich alleine gelassen mit dieser Frage. Der Text wirkt durch diesen unverhofften und offenen Schluß zudem sehr beunruhigend.
Für die Leser und Leserinnen ist der Text sprachlich betrachtet gut verständlich, weil die Syntax und der Wortschatz auch noch 30 Jahre später immer noch der damaligen Zeit ähnelt. Präzise, beschreibende und nicht zu lange Sätze geben eine Handlung wider, die gut nachvollziehbar ist. Bis zum letzten Absatz, in dem es wie ein Bruch scheint. Thematisch betrachtet haben sicherlich kaum Leser und Leserinnen jemals Erfahrungen mit Einladungen
zu einer Hinrichtung am Zentralbahnhof
gemacht. Dazu ist eine Interpretation nötig um diese beschriebene Situation auf eine andere Situation beziehen zu können. Dennoch schätze ich das Verständnis des Textes eher schwierig ein, weil die Aussage nicht gleich zu erfassen ist.
Genre und Erzählweise
Kunerts Text ordne ich dem epischen Genre zu. Er läßt in seinem Text einen auktorialen Erzähler zu Wort kommen, der über die mitgeteilten Vorgänge reflektiert und sie einordnet. (Z. 43-45) Die Leser und Leserinnen werden an einigen Stellen durch rhetorischen Fragen mit in den Text einbezogen, um sie auf den Text aufmerksam zu machen und um sie zum nachdenken anzuregen, wobei die Leser und Leserinnen die Antwort kennen. (Z. 27-30) Der Erzähler äußert sich zunächst distanziert beschreibend, rückt dann aber immer näher an das Geschehen heran. Dabei behält er jedoch seine recht nüchterne Erzählhaltung bei. (Z. 1-5 und 73-76) Die Erzählweise ist in Form einer Kurzgeschichte: Es gibt einen plötzlichen Einstieg in die Handlung, die gleich damit beginnt, wie der gewisse Jemand
frühstückt und einen Brief findet. Es gibt demnach keine Einleitung und man weiß nicht wieso, wann und von wem der Jemand
den Brief bekommen hat. An einem sonnigen Morgen stößt ein jemand innerhalb seiner Wohnung auf ein amtliches Schreiben. Es liegt auf dem Frühstückstisch neben der Tasse. Wie es dahin kam, ist ungewiß [...]
(Z. 1-5) Weiterhin ist eine einsträngige Handlung vorzufinden, die linear verläuft und in der es nur wenige Personen gibt, wie beispielsweise der Jemand
, Freunde, Angestellte, die den Leichnam entfernen, ein Klingelnder
und andere. Diese wenigen Personen gestalten zudem den einen Handlungsstrang, wobei allerdings der Jemand
im Vordergrund steht. Der Wechsel des Handlungsortes von des Jemands
Wohnung bis zum Zentralbahnhof
ist zeitraffend. Zudem kommt noch ein, wie bereits beschriebenes, offenes Ende hinzu, mit dem der Leser alleine gelassen wird. (Z. 77-85)
Deutungsansätze und Kritik
Kunert geht es in seinem Text sicherlich nicht nur um das Sterben einer anonymen Person, von der im Grunde genommen nichts bekannt ist und sie völlig irrelevant ist. Wie in einer Parabel kann man analoge Aussagen zu Gesellschaftsgruppierungen, mehreren Einzelpersonen oder einen historischen Kontext vermuten. Folgende Deutungsansätze erscheinen mir wichtig:
Das Gefühl der Hilflosigkeit und Angst
Kunert zeigt mit seiner Kurzgeschichte, daß es manchmal im Leben Situationen gibt, in denen man die Welt nicht mehr versteht. Daß man nicht weiß, was mit einem passiert und wie man sich verhalten soll. Genau so geht es auch dem Jemand
. Und aufgrund dieser Unwissenheit seinerseits hofft und vertraut er, denn im Grunde genommen weiß er gar nichts, und genau das bereitet ihm große Angst. (Z. 47) In seinem Kopf herrscht ein innerer Monolog, mit dem er versucht Antworten auf viele Fragen zu finden, doch er ist vollkommen ahnungslos. (Z. 48) Diese Ahnungslosigkeit treibt ihn schon so weit, daß er schon wieder euphorisch wird und sich selbst Mut macht. (Z. 69-76)
Kritik an der Ellbogengesellschaft
Weiterhin schildert der Text das Zusammenspiel von der bürokratischen Aufforderung und das Verhalten des Umfeldes in einer Situation, in der man selbst nicht mehr weiterkommt. Der Jemand
fühlt sich total alleine gelassen, findet nirgends die nötige Aufmerksamkeit und Rat. (Z. 20-22) Jeder denkt an sich in dieser Welt um seinen eigenen Kopf zu retten. Und warum auch sollte man jemanden helfen, der sowieso bald tot ist. (Z. 24-29) Das deutet darauf hin, daß Kunert die bereits entwickelte Ellbogengesellschaft kritisiert und damit ablehnt. Jeder möchte etwas erreichen, egal wie. Und wenn es sogar der Tod sein muß um andere Menschen auszuschalten. Ob es immer der Tod in dem Sinne ist, daß Menschen sterben, bezweifle ich. Aber genauso gut, können Menschen auch zum Beispiel mundtot gemacht werden und das sie keine Chance, für was auch immer, haben.
Mythologisierung des Todes und gesellschaftliche Ignoranz
Mit dem betont nüchternem Ende und quälend ungenauen Darstellung des Sterbens mythologisiert Kunert den Tod: (Z. 77-85) Möglicherweise soll diese Art von Darstellung die Art und Weise der Ellenbogengesellschaft nur noch verdeutlichen. Denn alles geschieht auf einer anonymen Weise und man selber spürt die Ellenbogen erst dann, wenn es schon längst zu spät ist. Und so spürt auch der Jemand
die Ellenbogen. Nämlich in dem Moment, wo er stirbt. Kunert knüpft sicherlich auch an seinen eigenen Erfahrungen vom Alleingelassensein, dem ihn begegneten Unverständnis und dem Tod an. Zum Beispiel lebte Kunert, wie bereits erwähnt, in der DDR. Dort herrschte meiner Meinung nach, auch Unterdrückung. Man hatte sich dem Staat unterzuordnen und sich anzupassen. Wer das nicht tat, spürte die scharfen Kanten und vielleicht auch Ellenbogen des Staates. Aber auch seine Mitmenschen versuchten vielleicht sich immer eine Stufe höherzustellen, und dort wurden mit Sicherheit auch eine Menge Ellenbogen eingesetzt um das zu erreichen, was man wollte. Daß Kunert diese Staatsform ablehnt zeigt, daß er 1979 in die BRD ausreiste.
Bezug zum Nationalsozialismus
Trotzdem läßt der Text noch viele Fragen offen, zum Beispiel warum es sich um einen Bahnhof handelt und vor allem wie der Jemand
gestorben ist. Der Text ruft noch an vielzähligen Stellen Assoziationen mit realexistierten Tötungsmechanismen hervor: Insbesondere Vernichtungslager zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland (1933-1945). Dieser Fakt ist gar nicht so einfach von der Hand zu weisen, denn Kunert lebte auch in der Zeit (*1929). In der Zeit spürte die Bevölkerung auch die Staatsmacht und es sprechen viele Textstellen dafür: Der wichtigste Fakt so scheint es mir, ist der letzte Abschnitt, in dem gesagt wird, daß vom Bahnhof nie ein Zug abgefahren ist, jedoch oft Rauch aufsteigt von angeblichen Zügen (Z. 82-85). Weiterhin wird der Leichnam in die rotziegeligen Tiefen
des Bahnhofs gebracht. Diese beiden Punkte erscheinen eindeutig, daß es sich dabei um ein Vernichtungslager handeln muß und der Bahnhof nur eine Metapher ist, denn wo gibt es einen Bahnhof, von dem Rauch aufsteigt, jedoch nie ein Zug abgefahren ist. Die rotziegeligen Tiefen
stehen metaphorisch für die Öfen, in denen die Leichen verbrannt wurden, denn sie waren im Keller und auch mit roten Ziegeln verkleidet. Daß dieser Fakt indirekt dargelegt ist, steht dafür, daß auch im 3. Reich immer alles verschleiert wurde um es geheimzuhalten. Das Verbrechen geschah möglichst geheim und wurde mit Euphemismen wie Schutzhaft
, Sonderbehandlung
und ähnlichem ummäntelt. Aufgrunddessen hat es Kunert nicht Vernichtungslager, sondern Zentralbahnhof
genannt. Ein Bahnhof ist nämlich ein Ort, an dem alle Fäden, was Personalverkehr betrifft, zusammenlaufen. Daß zudem der Bahnhof auch noch zentral ist, verdeutlicht noch zusätzlich, wie geheimgehalten die ganze Angelegenheit damals wurde und niemand Bescheid wußte.
Weiterhin scheint mir das Hinrichtungsdatum auch nicht rein zufällig gewählt, weil extra mehrmals und auch zusätzlich noch in Klammern das Datum aufgeführt wird: 5. November
. Einerseits soll es einprägsam sein, aber auch eine Assoziation mit dem Novemberpogrom hervorrufen. Eine Vergeltungstat (Tötung am 7. November 1938 des Legationssekretärs der deutschen Botschaft, Ernst vom Rath) führte zu einer Steigerung des Unrechts der Judenverfolgung. Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff Pogrom meist nur für Gewalttaten gegen Juden beziehungsweise für die Judenverfolgung und deren Vernichtung verwendet.
Auch mit dem Brief und demzufolge dem Beginn allen Schicksals des Jemands
beginnt auch die Gewaltsamkeit und die Vernichtung. Ich nehme an, daß dieses Datum ein Indiz dafür sein soll, daß die Geschichte auf die Zeit des Nationalsozialismus zu führen ist, auch wenn es in dem Text der Fünfte und nicht der Neunte November ist, und auch der Jemand
nicht unbedingt ein Jude war.
Eine weitere Frage stellt sich, warum der Autor der Hauptfigur keinen Namen gibt, sondern lediglich Jemand
nennt. In Bezug auf die damalige Zeit, läßt sich auch diese Frage beantworten. Als politischer Gegner, insbesondere Juden, war man einfach nichts wert. Es war egal, wie man hieß und wer man war. Das einzige was zählte, war das man zum Beispiel Jude ist. Es herrschte dadurch absolute Anonymität und die Juden galten nur als Juden und waren mit einem Judenstern gekennzeichnet.
Aber nicht, daß das schon alles wäre, der Text öffnet noch viel mehr Stellen um auf die Zeit des 3. Reiches schließen zu können. Beispielsweise ist das Schreiben auf grauen, lappigem Papier
. Wenn man sich die Bilder aus der damaligen Zeit anschaut, erkennt man dieses Papier sofort wieder und weiß, was der Autor meint. Aber auch das Schreiben an sich läßt weitere Verbindungen herstellen. Denn auch die, die damals in ein Vernichtungslager eingewiesen wurden, bekamen ein Schreiben mit der Aufforderung zu einer bestimmten Zeit sich an einem bestimmten Ort in leichter Kleidung einzufinden. (Z. 7-12)
Die Art und Weise der Hinrichtung ist ebenfalls ähnlich. Damals waren es Pseudobäder
, in dem Text sind es Pseudotoiletten
. (Z. 10- 12) Und ist es wieder nur ein Zufall, daß die gesamte Hinrichtung auf der Toilette 15 Minuten dauert? Auch in den Gaskammern dauerte es etwa 15 Minuten. (Z. 77)
Auch ist davon die Rede, daß der Boden gefegt wird und ständig mit einer Flüssigkeit gesprengt wird. (Z. 62-64) Was im Text so normal erscheint, ist in Wirklichkeit etwas Grausames. Sicherlich werden gerade die letzten Spuren der Leichen entfernt. Und wahrscheinlich läuft auch kein Gepäckträger
über den Zentralbahnhof
, sondern jemand, der die Leichen aus den Pseudotoiletten
entfernt und wegbringt.
Sicherlich könnte man den Text auch auf andere historische Ereignisse beziehen, wie beispielsweise zu Zeiten des Stalinismus auch Menschenmassen in ähnlichen Vernichtungslagern ausgeschaltet wurden. Es liegt jedoch auf der Hand, daß sich Kunert auf die Zeit von 1933-1945 bezieht, weil er 1929 geboren wurde und demnach auch einen Teil der Zeit mitbekommen hat. Besonders im Jugendalter prägen besondere Ereignisse. Dieser Ereignis der Millionen Menschen zu Opfer fielen, war mit Sicherheit auch für Kunert so ein Ereignis. Doch ich bin mir sicher, daß Kunerts eigentliche Intention des Textes nicht einzig und allein darin liegt, die verheerenden, schlimmen und menschenverachtenden Ausmaße des 2. Weltkrieges darzulegen.
Synthese und Fazit
Wie meine Interpretation gezeigt hat, will Kunert darauf hinaus, daß immer alle wegschauen und das eigentlich Wichtige nicht mitbekommen wird, wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Oft wird sich nicht getraut, die Dinge beim Namen zu nennen, weil Menschen von anderen Menschen oder auch vom Staat, wie im 3. Reich, motorisiert werden. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei den Freunden des Jemands
. Es scheint, als wüßten sie Bescheid. (Z. 21f.) Und obwohl Dinge mitten in der Gesellschaft geschehen unternimmt niemand etwas, obwohl es so viele Menschen tangiert und alle sich aufregen. Kunert bezieht es als Lehre darauf, daß man seine Gesellschaft, in der man lebt und alles was in und mit ihr passiert, in einem größeren Blickwinkel betrachtet werden soll und auch auf kleine, aber bedeutende Details achten soll. Oft tragen nämlich genau diese große Konsequenzen. Er hofft, daß sich die Gesellschaft als Zusammenleben und -handeln versteht.
Kunert hat dieses Verständnis am Beispiel des 3. Reiches festgemacht, weile diese Thematik dem Großteil bekannt und auch bekannt sein sollte. Auch zu der Zeit wurden Ellenbogen eingesetzt, was zeigt, daß mein erster Deutungsansatz nicht so abwegig war. Es wurden Ellenbogen vom Staat eingesetzt um bestimmte Gruppierungen auszulöschen und ihren Willen durchzusetzen. Ebenfalls wurden auch untereinander in der Gesellschaft Ellenbogen eingesetzt um sich selber zu schützen; keiner wollte freiwillig sterben.
Demnach scheint die Interpretation zwei Möglichkeiten offen zu lassen. Die erste wäre, die Darstellung des 3. Reiches um das Volk aufmerksam zu machen, um ein zweites ähnliches Verbrechen zu verhindern. Zweitens sollte man mehr auf die Details achten, was nicht zwingend mit Vernichtungslager im Zusammenhang steht, und mehr ein Miteinander und keine Gegeneinander in der Gesellschaft fördern. Damit können die Menschen viel leichter miteinander leben und die Motorisierung von Einzelpersonen fällt ähnlichen Leuten wie Hitler schwerer. Zusammengefaßt macht der Text darauf aufmerksam, daß es eine große Bedeutung für die gesellschaftliche und politische Bewußtseinsbildung gibt.
Inhalt und Form des Textes stehen in einem seltsamen Spannungsverhältnis zueinander und das macht den Text interessant. Inhaltlich geht es um etwas Grausames und Dramatisches, die Darstellungsweise dagegen ist distanziert, rational, emotionslos und strahlt fast Gleichgültigkeit aus. Trotzdem wirkt der Text hart und beunruhigend, und ich glaube, genau das wollte Kunert auch damit erreichen, denn damit schafft er es, die Leute zum Nachdenken zu zwingen. Das und die vielen Assoziationen des Textes lassen vermuten, was Kunert mit dem Text aussagen wollte. Sterben kann man auf mehreren Ebenen: zum Beispiel kann man mundtot gemacht werden. Kunert will, daß der Tod, auf welcher Ebene auch immer, dem öffentlichen Verschweigen nicht zum Opfer fällt, sondern das alles klar auf der Hand liegt und nicht wie im 3. Reich oder in der DDR verschleiert wird. Und das ist nur durch Aktivität möglich.
Wie meine Interpretation gezeigt hat, hat Kunert nur versucht an den realexistierten Tötungsmechanismen, die Tötung auf mehreren Ebenen darzustellen. Diese Art von Tötungsebenen müssen nicht potentiell mit dem Sterben von Menschen gegenüberstehen. Wie bereits gezeigt, geht es Kunert insbesondere um eine Aktivität und Teilnahme, wie auch immer diese aussehen mag, jedes Einzelnen in der Gesellschaft. Denn wenn sich jeder passiv verhält, desinteressiert ist und nichts von dem Leben und dem Geschehen um einen herum mitbekommt, kann man ganz schnell zum Objekt der Politik, Gesellschaft oder ähnlichem werden. Und genau dann wirkt man auch völlig leblos, wenn man nur noch als Objekt fungiert und nicht mehr weiß, was mit einem geschieht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptinhalt und die Aussage von Günter Kunerts
Zentralbahnhof
?Günter Kunerts
Zentralbahnhof
ist eine Kurzgeschichte, die von einemJemand
handelt, der eine Einladung zu seiner Hinrichtung am Zentralbahnhof erhält. Der Text thematisiert die Entfremdung des Einzelnen, die Bürokratie, die Hilflosigkeit in existentiellen Krisen und die Auseinandersetzung mit dem Tod. Eine Interpretation des Textes geht davon aus, dass der Text sich nicht nur auf den Tod einer einzelnen Person bezieht, sondern sich mit gesellschaftlichen Problemen, der Ellbogengesellschaft und der Aufarbeitung der NS-Zeit auseinandersetzt.Welchem Genre ist
Zentralbahnhof
zuzuordnen und welche Erzählweise verwendet Kunert?Der Text ist dem epischen Genre zuzuordnen und wird aus einer auktorialen Erzählperspektive erzählt. Die Erzählweise ist die einer Kurzgeschichte, mit einem plötzlichen Einstieg, einer linearen Handlung, wenigen Personen und einem offenen Ende.
Welche Interpretationsansätze gibt es für den Text
Zentralbahnhof
?Es gibt verschiedene Interpretationsansätze: Der Text kann als Auseinandersetzung mit der Unverständlichkeit und Hilflosigkeit in bestimmten Lebenssituationen gelesen werden, als Kritik an der Ellbogengesellschaft und der fehlenden Solidarität, oder als Allegorie auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. Auch die stalinistische Ära kann als Bezugsrahmen interpretiert werden.
Welche sprachlichen und stilistischen Mittel verwendet Kunert in
Zentralbahnhof
?Kunert verwendet eine präzise, beschreibende Sprache mit nicht zu langen Sätzen. Der Erzählton ist distanziert und nüchtern, was einen Kontrast zu der dramatischen Thematik bildet. Rhetorische Fragen werden eingesetzt, um die Leser zum Nachdenken anzuregen.
Welche Rolle spielt der
Zentralbahnhof
in der Interpretation des Textes?Der
Zentralbahnhof
kann als Metapher für einen Ort der Anonymität, Entfremdung und des Schreckens interpretiert werden. Er erinnert an Vernichtungslager zur Zeit des Nationalsozialismus, in denen Menschen auf anonyme Weise umgebracht wurden.Warum nennt Kunert die Hauptfigur
Jemand
?Die Bezeichnung
Jemand
verdeutlicht die Anonymität und Austauschbarkeit des Einzelnen. In Bezug auf die NS-Zeit symbolisiert es die Entmenschlichung und Entrechtung der Opfer.Welche Bedeutung hat das Datum
5. November
im Text?Das Datum
5. November
könnte eine Anspielung auf den Novemberpogrom von 1938 sein und somit eine Verbindung zur Judenverfolgung im Nationalsozialismus herstellen.Welche Kritik übt Kunert mit dem Text
Zentralbahnhof
?Kunert kritisiert die Gleichgültigkeit und das Wegschauen der Gesellschaft, die Anonymität und Entfremdung des Einzelnen sowie die verheerenden Folgen von Unmenschlichkeit und Gewalt. Er appelliert an die gesellschaftliche und politische Bewußtseinsbildung.
Was bedeutet das offene Ende der Kurzgeschichte?
Das offene Ende zwingt den Leser, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und eigene Interpretationen zu entwickeln. Es unterstreicht die Beunruhigung und die bleibenden Fragen, die der Text aufwirft.
Welche Verbindungen bestehen zu Kunerts Biografie?
Kunerts eigene Erfahrungen mit dem Leben in der DDR, der Unterdrückung und dem Unverständnis spiegeln sich möglicherweise in dem Text wider. Auch die Auseinandersetzung mit dem Tod und der NS-Zeit sind prägende Elemente in seinem Werk.