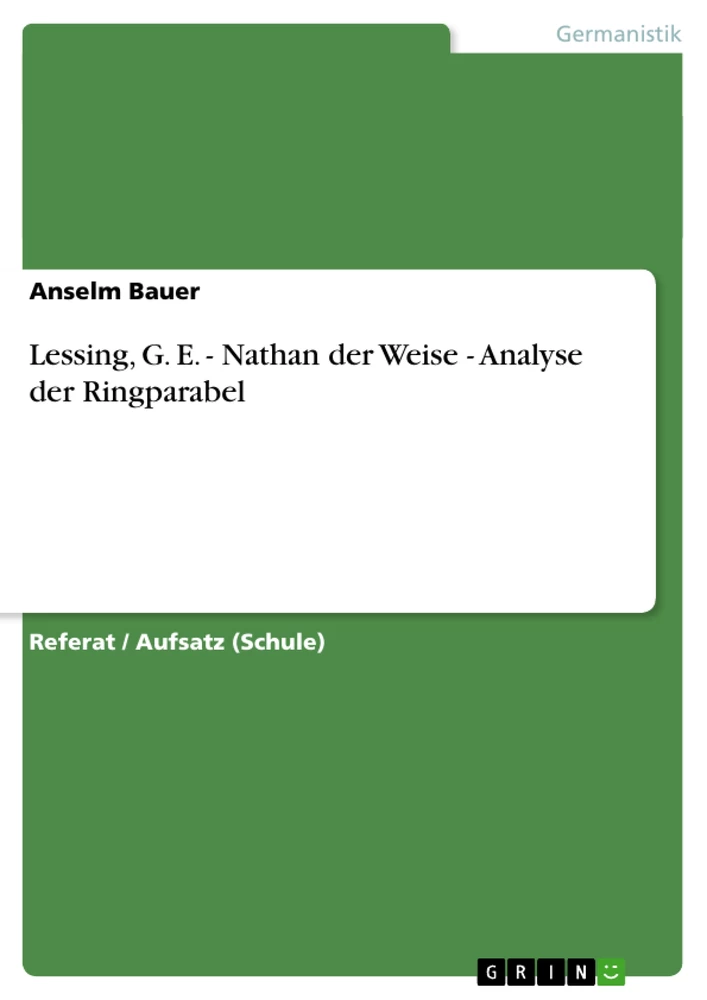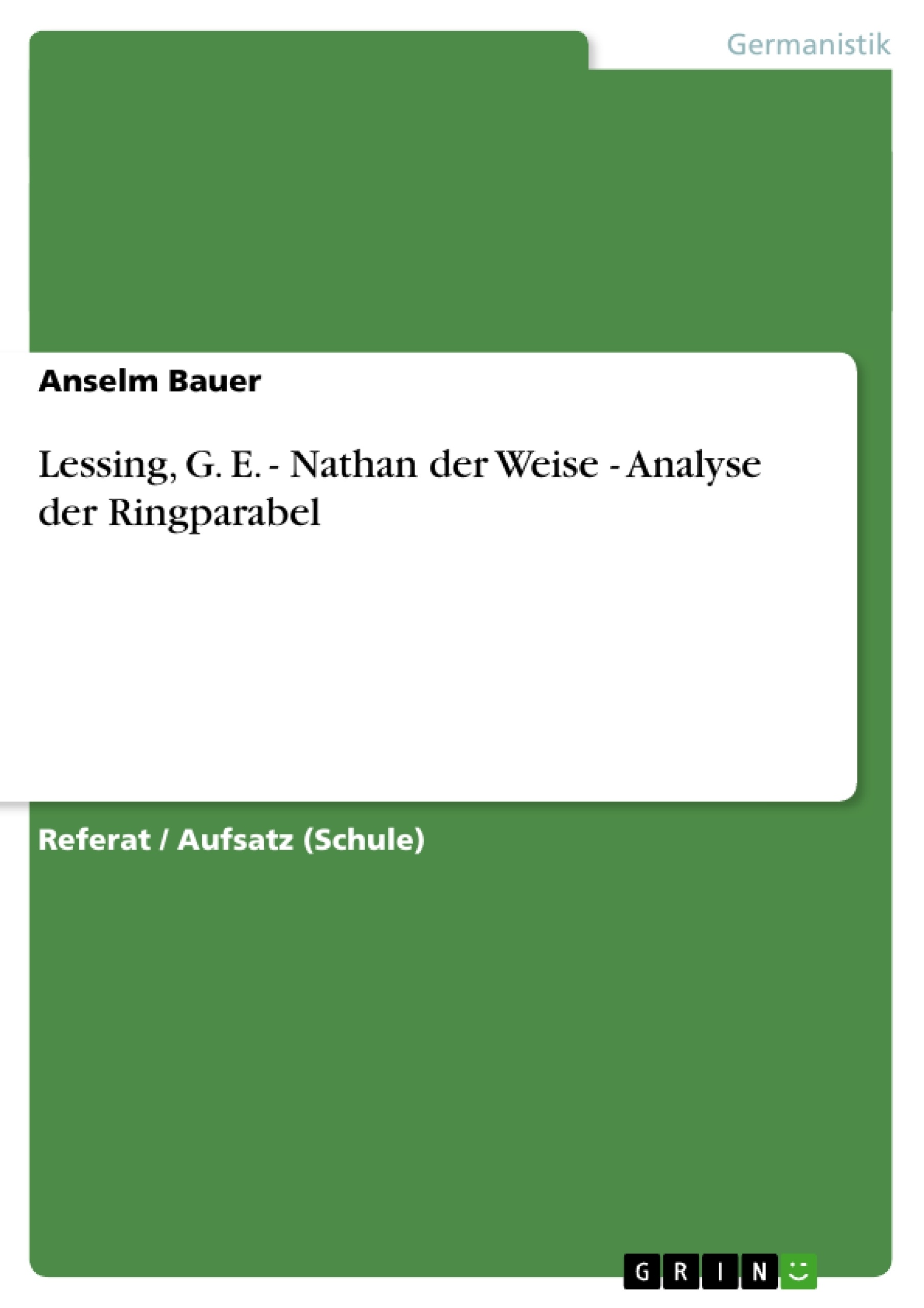In einer Welt religiöser Spannungen und unerbittlicher Vorurteile erstrahlt Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" als zeitloses Plädoyer für Toleranz, Vernunft und Menschlichkeit. Dieses dramatische Gedicht, eingebettet in das Jerusalem des 12. Jahrhunderts während des Dritten Kreuzzugs, entfaltet eine intriguereiche Geschichte, die den Leser unweigerlich in ihren Bann zieht. Der weise jüdische Kaufmann Nathan, der aufgeklärte Sultan Saladin und der junge Tempelherr stehen vor existenziellen Fragen nach dem wahren Glauben und der Bedeutung von Nächstenliebe. Im Zentrum dieses Meisterwerks steht die berühmte "Ringparabel", eine ergreifende Erzählung über die Ununterscheidbarkeit der drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam – und die Notwendigkeit, sich nicht auf Äußerlichkeiten, sondern auf die innere Haltung und die gelebte Humanität zu konzentrieren. Lessing verwebt auf meisterhafte Weise philosophische Tiefe mit dramatischer Spannung und schafft so ein Werk, das nicht nur zur Reflexion über religiöse Dogmen anregt, sondern auch universelle Werte wie Empathie, Dialogbereitschaft und die Suche nach Wahrheit in den Vordergrund rückt. "Nathan der Weise" ist mehr als nur ein literarisches Denkmal der Aufklärung; es ist eine leidenschaftliche Mahnung an die Menschheit, über konfessionelle Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und eine Welt des Friedens und der gegenseitigen Achtung zu schaffen. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Weisheit, Mut und die Kraft der Argumentation die scheinbar unüberwindlichen Mauern des Hasses und der Intoleranz niederreißen. Begleiten Sie Nathan auf seiner Reise, die zeigt, dass wahre Größe nicht in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion liegt, sondern in der Fähigkeit, die Menschlichkeit im Anderen zu erkennen und zu ehren. Entdecken Sie die zeitlose Botschaft von "Nathan der Weise", ein Buch, das uns auch heute noch dazu auffordert, unsere Vorurteile zu hinterfragen und uns für eine gerechtere und friedlichere Welt einzusetzen. Dieses Werk ist ein Muss für alle, die sich mit den Themen Toleranz, Religion, Aufklärung und interkultureller Dialog auseinandersetzen möchten und einen tiefgründigen Einblick in die menschliche Natur suchen. Lassen Sie sich von Lessings Weisheit inspirieren und werden Sie Teil einer Bewegung, die sich für eine Welt einsetzt, in der Respekt und Verständnis die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben bilden. "Nathan der Weise" – ein Buch, das Ihr Denken verändern und Ihr Herz berühren wird.
Gliederung:
1. Entstehung des Werkes „Nathan der Weise“ von G.E. Lessing
2. Analyse der „Ringparabel“ (Vers 1911-2054)
2.1. Erläuterung von Inhalt und Form
2.1.1. Inhalt und gedanklicher Aufbau
2.1.2. Sprachlich-stilistische Gestaltung
2.2. Zusammenspiel von Form und inhaltlicher Aussage
2.3. Vergleich der „Ringparabel“ von G.E. Lessing mit „Die drei Ringe“ von Giovanni Boccaccio
2.3.1. Inhaltlicher Vergleich
2.3.2. Vergleich von Sprache und Form
2.4. Aussageabsicht des Autors in Bezug auf die Epoche der Aufklärung
2.4.1. Kennzeichen der Aufklärung
2.4.2. Aussage und aufklärerischer Wert der „Ringparabel“
2.4.3. Interpretation anderer Textstellen
3. „Nathan der Weise“ als „zeitabhängiges“ oder „zeitloses“ Werk?
1. Entstehung des Werkes „Nathan der Weise“ von G.E. Lessing
Der Durchleuchtigste Fürst und Herr (Titul. Sereniss.) lassen dem Hofrat und Bibliothekar Lessing [...] hiermit die Resolution erteilen, [...], dass er in Religi-onssachen, so wenig hier als auswärts, auch weder unter seinem noch anderen angenommenen Namen, ohne vorherige Genehmigung des Fürstl. Geheimen Ministerii ferner etwas drucken lassen möge, [...]1. Mit diesem Brief erteilte der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel Gotthold Ephraim Lessing am 17.August 1778 ein Verbot Abhandlungen über die Religion zu schreiben. Aus- löser dieser Zensur war der Streit mit dem Hamburger Hauptpastor Johan Mel- chior Goeze über die „Wolfenbüttler Fragmente eines Ungenannten“, die Les- sing zwischen 1774 und 1777 veröffentlichte. Sie stammten aus der Feder des Hamburger Gymnasialprofessors und Orientalisten Hermann Samuel Reimarus (+1768) und waren geprägt von der deistischen These, Gott habe eine Welt ge- schaffen, in der das materielle, geistige und sittliche Leben nach unverrückbar feststehenden Gesetzen geregelt sei.2 Obwohl sich Lessing von diesen Schriften distanzierte, riefen sie einige orthodoxe Eiferer auf den Plan, so auch Pastor Jo- han Melchior Goeze. Er beschwor Gottes Zorn von der Kanzel der Katharinen- kirche herab und verfasste wütende wie bösartige Schmähschriften gegen den Hofrat. Lessings schrieb darauf die polemischen Briefe „Anti-Goeze 1-11“ und lehrte damit seinen Widersacher das Fürchten. Diese Briefe, in denen er mit „den Waffen der guten Gründe und der geschliffenen Sätze“3 focht, haben in der deutschen polemischen Literatur einen hohen Stellenwert. Als nun der Herzog das Veröffentlichungsverbot verhängte, schrieb Lessing am 6. September 1778 an Elise Reimarus: „Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater, wenigstens noch ungestört will predigen lassen.“ 4 So entstand Lessings „Nathan der Weise“, quasi als „Anti-Goeze 12“ und Glaubensbekennt- nis des Autors.
Es ist zugleich eines der wichtigsten aufklärerischen Werke und beinhaltet alle Ideen und Wertvorstellungen dieser Epoche wie ich im folgenden erläutern werde.
2. Analyse der „Ringparabel“ (Vers 1911-2054)
Im Mittelpunkt des „dramatischen Gedichts in fünf Aufzügen“ steht die Erzäh- lung Nathans über das Gleichnis der drei Ringe. Saladin ist in Geldnöten und will den reichen Juden Nathan in eine Falle locken. Ich will nun auf Sprache, Inhalt und Gesamtaussage der „Ringparabel“ näher eingehen und sie mit der Erzählung „Die drei Ringe“ aus dem 13. Jahrhundert vergleichen.
2.1. Erläuterung von Inhalt und Form
Im folgenden Abschnitt wird nun der Inhalt kurz zusammengefasst und auf die sprachlichen und formalen Kennzeichen näher eingegangen.
2.1.1. Inhalt und gedanklicher Aufbau
Nathans Klugheit hat ihm im Volk den Beinamen „der Weise“ verschafft. Saladin will ihn auf die Probe stellen und überrascht ihn mit der Frage, welcher der rechte Glaube sei, der christliche, der jüdische oder der islamische. Nach einer kurzen Bedenkzeit antwortet Nathan mit der „Ringparabel“, dem Kernstück des Dramas:
Im Altertum besaß ein Mann einen Ring von unschätzbarem Wert, der die Zau- berkraft hatte, den Träger vor Gott und den Menschen angenehm zu machen, falls er ihn in dieser Zuversicht trug. Der Ring wurde von Generation zu Genera- tion vererbt, bis er zu einem Fürsten gelangte, welcher drei Söhne hatte die ihm alle gleich lieb und wert waren. Da er sich nicht entscheiden konnte und keinen der Söhne kränken wollte, ließ er zwei weitere Ringe anfertigen, so dass sie nicht mehr vom Original zu unterscheiden waren. Der Vater rief jeden der Söhne an sein Sterbelager und überreichte ihm einen der Ringe. Nach seinem Tode kam es zum gerichtlichen Streit zwischen den Brüdern, denn jeder wollte nun der al- leinige Erbe sein. Der Richter aber wies die Kläger ab, da sich die Wunderkraft an keinem offenbarte und gab ihnen den Rat sich zu bemühen nach der Wunder- kraft des Rings zu streben. Nathan bezieht dieses Märchen dann auf die drei Weltreligionen, die einmal von Gott geschaffen, an die Menschen weitergeben wurden und dann zum Streit zwischen diesen führten.
Saladin ist nach anfänglicher Skepsis von Nathans Weisheit und Toleranz überwältigt und bittet ihn um die Freundschaft.
Die Verse 1911 bis 2054 der „Ringparabel“ kann man grob in fünf gedankliche Schritte unterteilen, die jeweils von Einwürfen Saladins abgegrenzt werden. Der erste Teil (V. 1911-1928) bildet die Exposition, in der Nathan die Ausgangssituation darlegt. Nun folgt die Hinführung zum eigentlichen Konflikt (V. 1929- 1955), an deren Ende der Sultan Nathan drängt zum Ende zu kommen, da er den Sinn des „Märchens“ (vgl. V. 1957) noch nicht verstanden hat. Im Abschnitt von Vers 1956 bis 1974 enthält ihm Nathan die Auflösung des Gleichnisses vor und testet die Intelligenz des Sultans. Als Saladin sich nun auf den Arm genom- men fühlt klärt ihn der Jude auf, worauf Saladin einen Ausruf der Einsicht macht (V. 1974-1992). Den Schluss bildet der Richterspruch (V. 1993-2054), der ledig- lich von zwei Aussprüchen des Entzückens aufseiten Saladins unterbrochen wird. Die Szene ist somit in der klassischen Form des aristotelischen Dramas aufgebaut, beinhaltet eine Einleitung, einen Konflikt inklusive Steigerung, einen Höhepunkt in Form der Auflösung und der Einsicht des Saladin und einen Schluss, den der Richterspruch darstellt.
2.1.2. Sprachlich-stilistische Gestaltung
Die „Parabel“ ist eine literarische Kurzform der gleichnishaften Erzählung und enthält Bilder, die der Leser entschlüsseln und auf die Realität beziehen muss. Man kann dies auch mit der mathematischen Parabel vergleichen, bei der die Ausgangswerte zwar verschieden sind, das Ergebnis aber dasselbe. Sie ist auch eine Spiegelung und trifft sich in einem Punkt, welcher in unserem Falle die „Wunderkraft“ ist, die die Ringe mit den Religionen verbindet. G.E. Lessing wählte diese Art der Darstellung mit didaktischer Absicht. Der Leser soll die „Ringparabel“ nicht als unterhaltsames Märchen ansehen, sondern als Spiegel der Realität, in dem er sich finden und verändern soll.
Lessing führte mit seinem Werk den „Blankvers“ in das deutsche Drama ein, d.h. er benutzt den fünffüßigen Jambus, wechselnde Kadenzen und keine Reime. Diese Art des Metrums stört den Lesefluss und nötigt den Leser die Verse genau zu durchdenken und damit besser zu verstehen. Lessing bemerkte, dass die Ver- se „besser sind, wenn sie schlechter sind“. Das heißt, je zerrissener und verdreh- ter die Verse, desto besser wirken sie auf den Leser. Der Text erscheint zwischen Prosa und Lyrik hin- und hergerissen, da er durchgehend Enjambements enthält (vgl. V. 1921 f., V. 1942 f.). Häufig wechseln die sprechenden Personen auch im Vers (vgl. V. 1958 f., V. 1927 f.). „ In der zusammenhängenden Rede treten gro-ße rhythmische Perioden auf, deren Glieder nicht durch die Verse abgegrenzt sind, sondern rückwärts das Ende des vorhergehenden Verses mitziehen oder vorwärts in den Anfang des folgenden sich hineindrängen“ (Wilhelm Dilthey)1. Mit kurzen aber prägnanten Sätzen schafft Lessing Klarheit und eine gewisse Lebendigkeit (vgl. V. 1980 ff.). Der Abschnitt ist voll von Metaphern und Bil- dern, als Beispiele sind die Ringe als Symbole der drei verschiedenen Glaubens- richtungen zu sehen, der Vater ist als Gott zu verstehen, die drei Söhne als die Anhänger der Weltreligionen. Zur Spannungssteigerung und zu Denkanstössen an den Leser benutzt der Autor die Einwürfe Saladins (V. 1964, V. 1970 ff.). Durch geschickte Dialogismen und rhetorische Fragen (V. 1975, Vers ff.) gestal- tet er den Text lebendiger und interessanter. Als einzelne Stilmittel sind noch ein Hendiadyoin (V. 1952), ein Chiasmus (V. 1940), eine Klimax (V. 1948 f.) und die häufige Wiederholung des Wortes „drei“ zu nennen, die zur Heraushebung und Verstärkung einzelner Gedanken und zur Irritation des Lesers dienen. Mit der Hyperbel in Vers 2049/50 spielt Lessing auf die Utopie an, in dieser Streit- frage zu richten.
2.2. Zusammenspiel von Form und inhaltlicher Aussage
G.E. Lessing wählte bewusst den Blankvers als Metrum. Durch diesen unge- wöhnlichen, zerrissenen, fast orientalischen Ton muss der Leser Sprache und In- halt konzentrierter betrachten, um alles zu verstehen. Im Zusammenhang mit dem Ort der Handlung erzeugt die Form des Märchens einen orientalischen Ef- fekt, also Distanz, aber auch genauere Betrachtung. Mit einzelnen rhetorischen Besonderheiten und Stilmitteln verstärkt Lessing einige Akzente. Mit den rheto- rischen Fragen (V. 1975 ff.) spricht er nicht nur Saladin, sondern ganz gezielt den Leser an und nötigt ihn über die angesprochenen Dinge nachzudenken. Mit der Klimax der beiden Einschübe „Wie auch wahr!“ zu „Wie nicht minder wahr!“ verstärkt Lessing, dass alle Religionen theoretisch das gleiche Recht ha- ben sich die „Echte“ zu nennen. Mit den zwei ironischen Fragen in Vers 2012 ff. zieht er den Konflikt ins Lächerliche. Die berühmte Wendung „Betrogene Be-trüger“, die Oxymoron, Alliteration und Polyptoton in einem darstellt, allerdings nicht von Lessing stammt („Auch diese Wendung lässt sich in der Literatur weit zurückverfolgen - bis auf Augustin zumindest!“ 2 ), stellt einerseits den intoleran- ten Menschen als Betrüger, andererseits als selbst von Gott Betrogenen dar.
2.3. Vergleich der „Ringparabel“ von G.E. Lessing mit „Die drei Ringe“ von Giovanni Boccaccio
Die Idee zu seinem Werk erhielt G.E. Lessing aus „Die drei Ringe“ von Gio- vanni Boccaccio. In einem Brief an seinen Bruder Karl schrieb er über den In- halt des Werkes: „...wenn Ihr, Du und Moses, ihn wissen wollte, so schlagt das Decamerone des Boccaccio auf [...]. Ich glaube, eine sehr interessante Episode dazu gefunden zu haben, dass sich alles sehr gut soll lesen lassen und ich ge-wiss den Theologen einenärgeren Possen damit spielen will als noch mit zehn Fragmenten.“1 (siehe 2.4.).
Lessing erweiterte die Erzählung aber um einige weitere Aspekte und machte sie so zu einer Parabel mit erzieherischem Wert. Die Unterschiede werden im folgenden erläutert.
2.3.1. Inhaltlicher Vergleich
2.3.1 Inhaltlich unterscheidet sich der Text des deutschen Autors von dem des italie- nischen in einigen wichtigen Dingen. Boccaccio beschreibt den Ring lediglich als „wunderschön und wertvoll“ (Z. 6) , Lessing beschreibt ihn als Opal der „hundert schöne Farben spiegelt“ (V. 1914 f.). „Dies, die unermessliche Viel- fältigkeit, über alle verständige Eindeutigkeit hinaus, das in Gott begründete Überrationale, kennzeichnet die positive Religion“2 (Otto Mann) . Darüber hin- aus gibt Lessing ihm die Zauberkraft „vor Gott und den Menschen angenehm zu machen“ (V. 1916 f.), allerdings nur dem, der ihn in dieser Zuversicht trägt. Mit diesem Zusatz will Lessing ausdrücken, dass die religiöse Zugehörigkeit allein nicht ausreicht ein guter Mensch zu sein. Auch Saladins zeitweises Unverständ- nis (V. 1964) und die anfängliche Ungeduld (V. 1957 f.) sind aus Lessings Fe- der. Er spricht damit dem einen oder anderen Leser aus dem Mund und bezieht ihn in die Erzählung mit ein. Der ausführliche Richterspruch im deutschen Werk verstärkt Lessings Ansichten und das Gewicht der Gleichheit, der Tole- ranz und der Auslegung der Religionen (V. 2010 ff.).
2.3.2. Vergleich von Sprache und Form
Der größte sprachliche Unterschied ist natürlich der Unterschied zwischen Prosa und Lyrik. Die Erzählung Boccaccios ist im märchenhaften „dahinplätschern- den“ Erzählstil geschrieben, Lessings Parabel voller Fragen, Einwürfen, Spitz- findigkeiten und exakten Beschreibungen. Die Auflösung und Überzeugung Sa- ladins ist sprachlich ausgefeilter, redegewandter, fast schon sophistischer Natur (V. 1974 ff.). Auch das Metrum und die kompakte, treffsichere Sprache zwingt den Leser sich auf das Gesagte zu konzentrieren.
Letztendlich hat Lessing aus der „netten“ Erzählung Boccaccios eine didaktisch wertvolle Parabel hervorgebracht, die nicht zur Unterhaltung sondern zum Nachdenken dient.
2.4. Aussageabsicht des Autors in Bezug auf die Epoche der Aufklärung
Mit dem Zitat „Wer den Nathan recht versteht, kennt Lessing“1 (Fr. Schlegel), ist die Bedeutung des Buches und der Figur Nathan am besten beschrieben. Les- sing hat in diesem Werk seine ganzen Ideen und aufklärerischen Gedanken ver- wirklicht, Nathan zeigt sogar einige biographische Züge Lessings auf. Nicht nur in der Ringparabel predigt er Vernunft, das Loslösen von biblischen Dogmen, eigenständiges Denken und Toleranz gegenüber Andersgläubigen und - denkenden.
2.4.1. Kennzeichen der Aufklärung
Die Epoche der Aufklärung begann im 18. Jahrhundert und rief einige moderne Denkweisen und Gedanken hervor. Mit Mitteln der Beobachtung und des Expe- riments gelangten neue Erkenntnisse in den Naturwissenschaften. Die wissen- schaftlichen Entdeckungen zeigten, dass die Vorgänge in der Welt nicht die Wirkung eines göttlichen Willens, sondern die Folge von Naturgesetzen war, die der Mensch erkennen und für sich auch zu Folgerungen über das gesellschaftli- che Zusammenleben der Menschen nutzen kann. Mit „Aufklärung ist der Aus-gang des Menschen aus seine selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be-dienen“ und dem Schlagwort „Sapere aude!“2 appellierte Immanuel Kant (1724 - 1804) an die Menschen, selbstständig, rational und unabhängig von jeglichen Dogmen der Kirche oder des Staates zu denken und zu handeln. Ein ebenfalls wichtiger Standpunkt für die Aufklärung war die Forderung nach Toleranz, die sowohl der Religion als auch der Erziehung zum Ziel gesetzt wur- de. Letzterer widmeten die Aufklärer ihre besondere Aufmerksamkeit, da sie die Ansicht vertraten, dass nur Bildung und Erziehung die Menschheit voranbringen kann. In Gotthold Ephraim Lessings Schaffen erfuhr die deutsche Aufklärung ih- ren Höhepunkt.
In den nächsten zwei Punkten werden nun die modernen Gedanken der Ringparabel und anderer Textabschnitte erläutert.
2.4.2. Aussage und aufklärerischer Wert der „Ringparabel“
Die drei Ringe entstammen alle einer „Urreligion“, man könnte sie auch als Na- tur- oder Vernunftreligion bezeichnen und sind von Gott den Menschen überge- ben worden. Alle drei, keine der drei oder nur eine von ihnen ist die wahre Reli- gion, die die Kraft hat vor Gott und den Menschen „angenehm zu machen“ (V. 1916). Dies kann aber nur geschehen, wenn man den Ring, also die Religion „in dieser Zuversicht [trägt]“ (V. 1917). Lessing will damit ausdrücken, dass die Existenz einer Religion, egal welcher, noch nicht ausreicht ein guter Mensch zu sein. Dies ist nur „mit Sanftmut, mit herzlichster Verträglichkeit, mit Wohltun [und] mit innigster Ergebenheit in Gott“ (V. 2045 f.) zu erreichen. Mit dem Zu- satz „es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen freien Liebe nach“ (V. 2041 f.), ist das aufklärerische Motto perfekt. Das Denken und Streben der Men- schen soll frei von Vorurteilen und „unbestochen“ (V. 2041) von jeglichen tra- dierten Gesetzesformeln sein. Mit Toleranz und vernünftigem Denken „strebe jeder [der jeweiligen Religionsanhängern] um die Wette, die Kraft des Steins [seiner Religion] an Tag zu legen!“ (V. 2043 ff.) . Es geht dabei nicht darum die anderen beiden Religion zu vernichten, denn „liebt sich [jeder] selber nur am meisten - Oh, so seid ihr alle drei Betrogene Betrüger!“ (V. 2024) . Lessing will damit ausdrücken, dass, wenn jede Religion nur sich akzeptiert, die anderen Re- ligionen zu Fall bringen will und weder danach strebt die potentielle „Zauber- kraft“ der Religion zu Tage zu bringen, noch dieses Ziel erreicht, der ganze Re- ligionsgedanke „Betrug“ ist und nur von Gott selbst aufgelöst werden kann. Les- sing plädiert für Verständnis und Toleranz unter den Religionen. Er wertet keine als die richtige oder wahre Religion, sondern spricht jeder das gleiche Recht zu, sich Gottes Nachfolge zu nennen.
Wie Lessing ist auch Nathan ein Anhänger des Deismus und der Vernunft. Deismus bedeutet, dass Gott die Welt zwar erschaffen und mit vernünftigen Naturgesetzen ausgestattet hat, aber seit der Erschaffung der Welt nicht mehr aktiv in das Geschehen eingreift.
Ein Beleg in der Ringparabel findet sich in der Tatsache, dass der Vater, also Gott, seinen Kindern die drei Ringe überlässt und daraufhin stirbt, er kann also nicht mehr aktiv in den Streit seiner drei Söhne eingreifen, sie sind auf sich allein gestellt und es gibt keine Möglichkeit, den Vater wieder zum Leben zu erwecken um ihn um Rat zu fragen.
2.4.3. Interpretation anderer Textstellen
Im Anschluss an die Aussage der Ringparabel ist unmittelbar die Schlussszene zu interpretieren (S. 120-125). Sie stellt das Ziel der Menschheit, die Hoffnung Lessings, aber auch das Utopische dieses Buches dar. Nachdem alle Vorurteile und Intoleranzen abgebaut sind vereinigen sich alle drei Religionen wie in einer ironisch-heiteren Vision zu einer harmonischen „Familie“. Dass dies der Ideal- zustand ist und leider nie erreicht werden kann war auch Lessing schon bewusst. Den Gedanken des rationalen Denkens greift Lessing einige Male auf. Nathan erzieht seine Tochter praktisch konfessionsunabhängig und losgelöst von „kalter Buchgelehrsamkeit“ (S. 115 V. 3534). Als sie ihm erzählt, dass sie von einem Engel gerettet worden sei, holt er sie auf den Boden der Tatsachen und der Vernunft zurück und ärgert sich über ihre „Schwärmereien“ (vgl. S. 13 V. 360). Auch der Tempelherr lobt die Erziehung Nathans, obwohl er mit den Umstän- den, dass Nathan eine Christin als Jüdin aufgezogen hat nicht zufrieden ist (vgl. S. 84 V. 2557 f.). Den krassen Gegensatz zum aufgeklärten Menschen stellt der Patriarch dar. Man könnte in ihm sogar Züge des Hamburger Hauptpastors und Erzfeinds Lessings sehen. Er predigt gegen die Vernunft und für blinden Gehor- sam gegenüber der Kirche. Seiner Meinung nach darf „das ewige Gesetz der Herrlichkeit des Himmels, [nicht] nach den Regeln einer eiteln Ehre (der Ver- nunft) [geprüft werden]“ (S. 82 V. 2489 ff.). Auch durch seine wiederholten Ausrufe „Tut nichts! Er wird verbrannt“ (S. 84 V. 2546, V. 2552), obwohl er gar nicht abgewogen hat, ob Nathans Handeln sinnvoll war, macht ihn Lessing zur personifizierten Intoleranz. Toleranz muss auch der Tempelherr vom aufge- klärten Pädagogen Nathan erlernen. Will er Nathan am Anfang gar nicht sehen, da „Jud Jude ist“ (vgl. S. 26 V. 777), erfährt er von diesem, dass Mensch zu sein wichtiger ist als Jude oder Christ (vgl. S. 44 V. 1310). Am Ende dieses Lernvor- gangs steht Lessings Ideal vom aufgeklärten Menschen, der tolerant, rational, of- fen und unabhängig von Zwängen der Kirche denkt und handelt.
3. „Nathan der Weise“ als „zeitabhängiges“ oder „zeitloses“ Werk?
Nun stellt sich die Frage ob dieses Werk für den eigentlich „aufgeklärten“ Men- schen des 21.Jahrhunderts sinnvoll ist oder nur ein Hirngespinst einiger Germanisten darstellt. Muss man „Nathan der Weise“ als ein „zeitabhängiges“ oder ein „zeitloses“ Werk einstufen? Ich denke, dass sich der moderne Mensch längst noch nicht „aufgeklärt“ nennen kann, bzw. darf. Vorgänge, Ereignisse noch nicht „aufgeklärt“ nennen kann, bzw. darf. Vorgänge, Ereignisse und Krie- ge in der neueren Zeit sind der beste Beweis dafür. Ist Neofaschismus ein Er- gebnis von Bemühungen um Toleranz? Sind Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland kein Zeichen von Dogmatismus? Kann man die Vorgänge im nahen Osten als pure Toleranz bezeichnen? Israels einstiger Au- ßenminister und Regierungschef Shimon Peres brachte es einmal resignierend auf den Punkt: ,,Wo das Heilige anfängt, hört die Vernunft auf. Vernunft aber ist im Nahen Osten wieder ein Fremdwort." Das aktuellste Beispiel religiös- fanatischer Intoleranz ist die Sprengung der Buddha-Statue im afghanischen Bamiyan durch die moslemischen Taliban. Dies alles sind Zeichen eines moder- nen Menschen, der weder vernünftig, noch tolerant - eben nicht aufgeklärt denkt und handelt.
Ich befürchte, dass der Mensch des anfangenden dritten Jahrtausends den Weg vom Patriarchen und Daja zu Nathan lediglich bis zur Hälfte bewältigt hat. Ob er sein Ziel je erreichen wird ist ernsthaft zu bezweifeln.
Literaturverzeichnis:
- Gotthold Ephraim Lessing, „Nathan der Weise“, Hamburger Lesehefte Ver- lag, Husum/Nordsee
- Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, Bayer Verlag, Hollfeld, 1980
- Willy Grabert, Arno Mulot, Geschichte der deutschen Literatur, Bayrischer Schulbuch Verlag, München, 1986
- http://www.gymnasium-borghorst.de/nathan/
- http://www.hausarbeiten.de
- Giovanni Boccaccio, Die drei Ringe
[...]
1 Vgl. http://www.gymnasium-borghorst.de/nathan/anlass.htm
2 Vgl. Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 11
3 Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 13
4 Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 13
1 Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 89
2 Vgl. S. 133, Lessing G.E., Nathan der Weise, Anmerkungen
1 vgl. Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 14
2 Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 83
1 Gehrke Hans, Lessings „Nathan der Weise“, S. 94
Häufig gestellte Fragen zu "Nathan der Weise"
Worum geht es in der Analyse des Werkes "Nathan der Weise"?
Die Analyse behandelt die Entstehung des Werkes von G.E. Lessing, insbesondere die Umstände, die zur Entstehung führten, einschließlich des Verbots, über Religion zu schreiben. Ein zentraler Punkt ist die detaillierte Analyse der "Ringparabel" (Verse 1911-2054), wobei Inhalt, Form, sprachlich-stilistische Gestaltung und die Aussageabsicht im Kontext der Aufklärung untersucht werden. Außerdem wird die "Ringparabel" mit Boccaccios "Die drei Ringe" verglichen.
Was beinhaltet die Analyse der Ringparabel?
Die Analyse der Ringparabel umfasst eine Erläuterung von Inhalt und Form, einschließlich des gedanklichen Aufbaus und der sprachlich-stilistischen Gestaltung. Es wird das Zusammenspiel von Form und inhaltlicher Aussage betrachtet und die Parabel mit Boccaccios Erzählung verglichen. Weiterhin wird die Aussageabsicht des Autors in Bezug auf die Epoche der Aufklärung erörtert, einschließlich der Kennzeichen der Aufklärung und der aufklärerische Wert der "Ringparabel".
Wie wird die Ringparabel mit Boccaccios "Die drei Ringe" verglichen?
Der Vergleich beinhaltet sowohl inhaltliche als auch sprachlich-formale Aspekte. Der inhaltliche Vergleich konzentriert sich auf die Unterschiede in der Darstellung der Ringe, der Motivationen der Charaktere und der Botschaft. Der sprachlich-formale Vergleich analysiert die Unterschiede zwischen Boccaccios Prosa und Lessings Versform, sowie die stilistischen Mittel und die damit verbundene Wirkung auf den Leser.
Was sind die Kennzeichen der Aufklärung, die im Werk relevant sind?
Die Kennzeichen der Aufklärung umfassen Vernunft, Toleranz, Humanität, Kritik an Dogmen und Autoritäten, sowie den Glauben an den Fortschritt durch Bildung und Erziehung. Die Analyse untersucht, wie diese Prinzipien in "Nathan der Weise" und insbesondere in der "Ringparabel" zum Ausdruck kommen.
Welche Bedeutung hat die Frage, ob "Nathan der Weise" ein "zeitabhängiges" oder "zeitloses" Werk ist?
Die Frage zielt darauf ab, zu beurteilen, inwieweit die im Werk behandelten Themen wie Toleranz, Religionsfreiheit und Vernunft auch im 21. Jahrhundert noch relevant sind. Es wird diskutiert, ob die im Werk dargestellten Ideale bereits erreicht wurden oder ob sie weiterhin eine Utopie darstellen.
Welche Stilmittel verwendet Lessing in der Ringparabel?
Lessing verwendet in der Ringparabel eine Vielzahl von Stilmitteln, darunter Metaphern (Ringe als Symbole für Religionen, Vater als Gott), rhetorische Fragen, Dialogismen, Hendiadyoin, Chiasmus, Klimax und die Wiederholung des Wortes "drei". Der Blankvers als Metrum trägt ebenfalls zur besonderen Wirkung der Parabel bei.
Was ist die Kernaussage der Ringparabel bezüglich der Religionen?
Die Kernaussage der Ringparabel ist, dass keine der drei Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam) den alleinigen Anspruch auf die Wahrheit erheben kann. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Anhänger jeder Religion nach den Prinzipien der Humanität, Toleranz und Vernunft leben und sich bemühen, die positive Kraft ihrer Religion zu entfalten.
Wie wird der Patriarch im Werk dargestellt?
Der Patriarch wird als Gegenbild zum aufgeklärten Menschen dargestellt. Er verkörpert Intoleranz, Dogmatismus und blinden Gehorsam gegenüber der Kirche. Seine Aussagen und Handlungen stehen im krassen Gegensatz zu den Werten der Aufklärung, die Nathan und andere Charaktere im Werk vertreten.
- Quote paper
- Anselm Bauer (Author), 2001, Lessing, G. E. - Nathan der Weise - Analyse der Ringparabel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105430