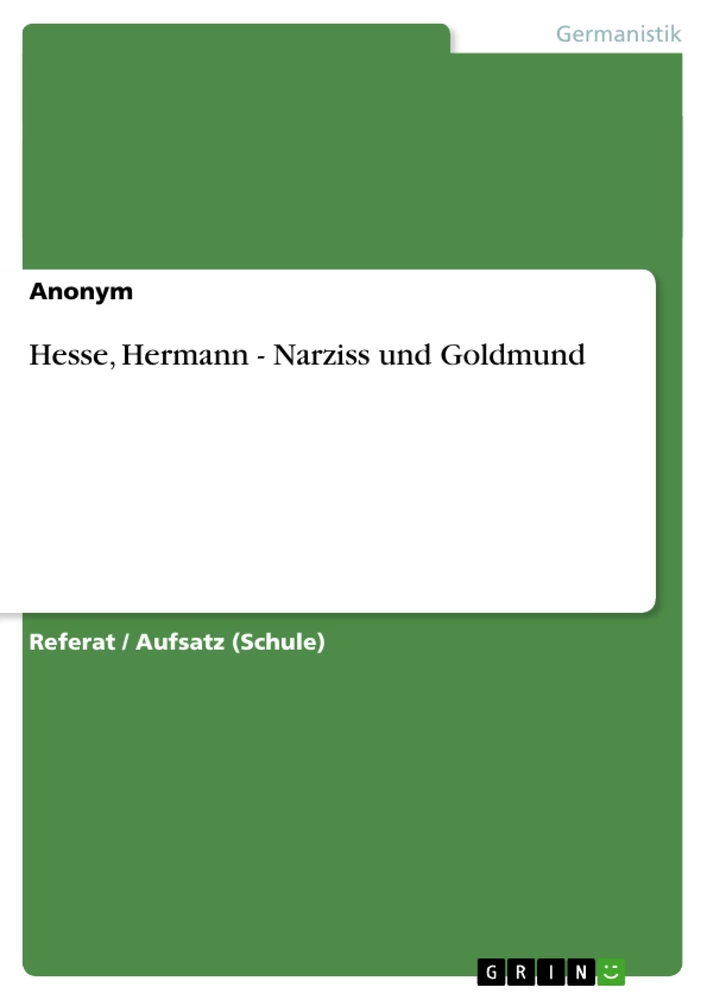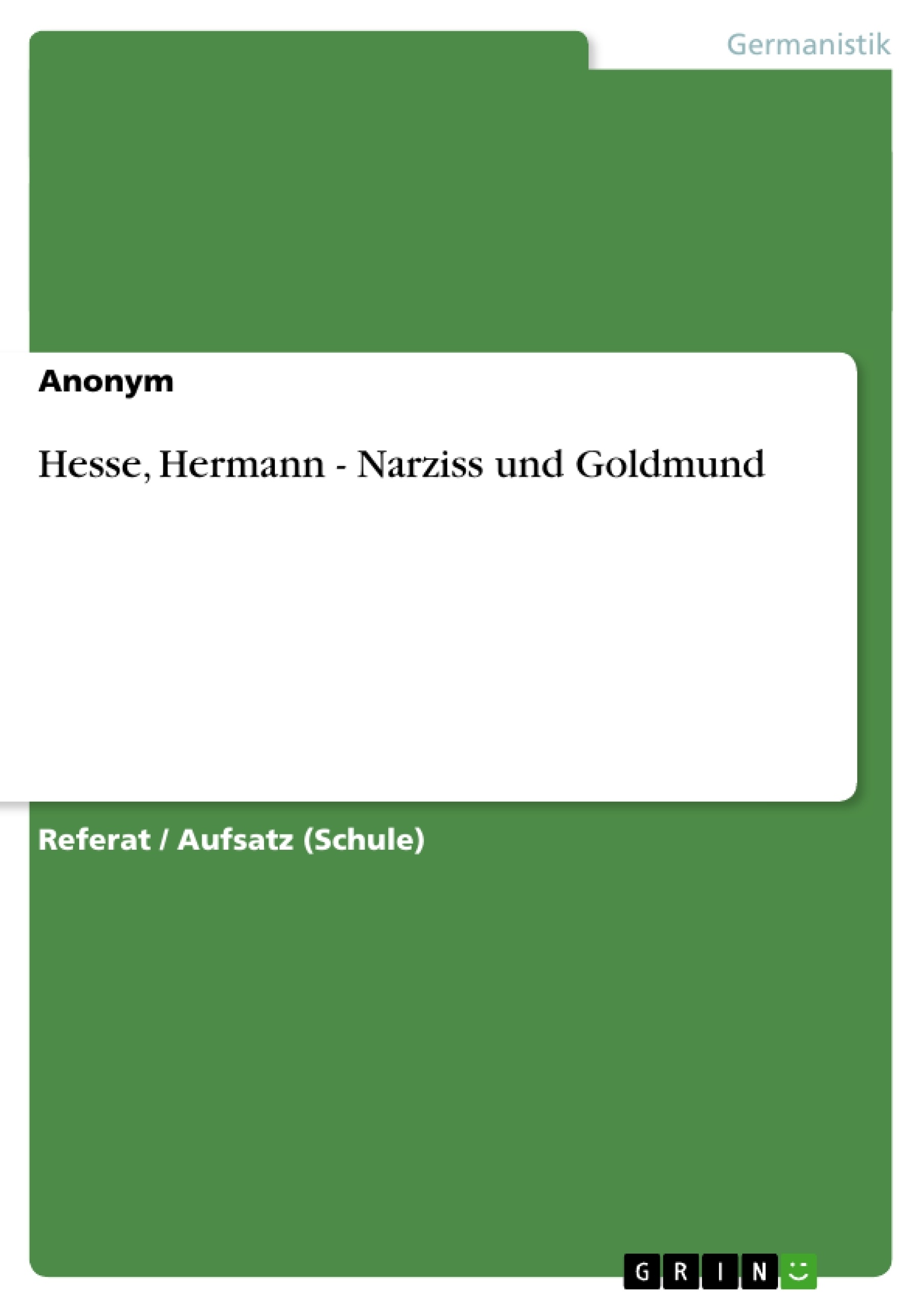Was bedeutet es, ein Leben zwischen Askese und sinnlicher Ekstase zu führen? Hermann Hesses zeitloser Roman "Narziß und Goldmund" entführt uns in eine faszinierende Welt des mittelalterlichen Deutschlands, wo zwei ungleiche Seelen eine außergewöhnliche Freundschaft eingehen. Narziß, der brillante und asketische Novize, verkörpert die Welt des Geistes und der Kontemplation im Kloster Mariabronn. Goldmund hingegen, ein impulsiver und lebenshungriger Jüngling, spürt eine unbändige Sehnsucht nach der sinnlichen Erfahrung der Welt. Ihre Begegnung wird zum Katalysator einer tiefgreifenden Wandlung. Goldmund verlässt das Kloster, um die Welt in all ihren Facetten zu erkunden – die Liebe, die Kunst, aber auch den Tod und die Verzweiflung. Er wird zum Wanderer, zum Künstler, zum Liebhaber, getrieben von der Suche nach dem Sinn des Lebens und der eigenen Identität. Auf seinen Reisen begegnet er unzähligen Frauen, erlebt die Schrecken der Pest und entdeckt seine Leidenschaft für die Bildhauerei. Doch immer wieder kehrt er zu Narziß zurück, dem ruhenden Pol in seinem turbulenten Leben. Die tiefe Verbundenheit der beiden Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, bildet das Herzstück dieser ergreifenden Geschichte über Freundschaft, духовность und die Suche nach dem Selbst. Tauchen Sie ein in eine Welt voller philosophischer Fragen, leidenschaftlicher Begegnungen und künstlerischer Inspiration. Begleiten Sie Narziß und Goldmund auf ihrer Reise zwischen духовность und Sinnlichkeit, zwischen Askese und Ekstase, und entdecken Sie die zeitlose Weisheit dieses literarischen Meisterwerks. Ein Muss für Leser, die tiefgründige Erzählungen, psychologische Einblicke und die Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens suchen. Hesse entwirft ein vielschichtiges Bild der menschlichen Existenz, in dem Gegensätze sich nicht ausschließen, sondern einander ergänzen. "Narziß und Goldmund" ist mehr als nur ein Roman; es ist eine Reise zu sich selbst, ein Spiegelbild unserer innersten Sehnsüchte und Ängste, eine Hymne an die Freundschaft und die Kraft der Kunst. Erleben Sie die Magie von Hesses Sprache und lassen Sie sich von der Geschichte zweier außergewöhnlicher Männer berühren, deren Suche nach Wahrheit und Erfüllung bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Ein bewegendes Plädoyer für die Freiheit des Geistes und die Schönheit des Lebens, das noch lange nach dem Zuklappen des Buches nachhallt.
Inhaltsverzeichnis
1. Kurzbiographie
2. Inhaltsangabe des Romans
3. Entstehung und Aufnahme der Erzählung
4. Charakteristik der Hauptpersonen:
4.1. Narziß
4.2. Goldmund
5. Hauptproblem der Polarität
6. Literaturverzeichnis
7. Abkürzungsverzeichnis
8. Anmerkung - Zitate
9. Eidesstattliche Erklärung
10. Bildmaterial
Narziss und Goldmund
Hesse, Hermann: Leben, Werk und Zeit
Am 2. Juli 1877 wird Hesse in Calw/Württemberg als Sohn von Johannes Hesse (1847-1916), ein aus Estland stammender Missionar, und Marie Hesse geb. Gundert verw. Isenberg (1842-1902) geboren. Ab 1887 besucht er das Reallyzeum in Calw. Er legt das Württembergische Landesexamen der Lateinschule in Göppingen ab, um die Theologenlaufbahn einzuschlagen. Im September 1891 tritt Hesse in das evang. Klosterseminar Maulbronn ein, von dem er aber bald davonläuft, weil er „entweder Dichter oder gar nichts“ werden will. Ab November 1892 besucht er für ein Jahr das Gymnasium zu Cannstadt. Bis 1900 lebt er unter anderem als Buchhändler und Antiquar, dann als freier Schriftsteller und Literaturkritiker. 1904 heiratet er die Baslerin Maria Bernoulli (1868-1963), mit der er drei Söhne hat. Seine ersten Romane Unterm Rad (1906) und Peter Camenzind (1904) erscheinen und werden mit Erfolg vom Publikum aufgenommen. Bereits hier, wie auch in seinen folgenden Werken, verarbeitet er die drückenden Erfahrungen der Schulzeit und des Priesterseminars und setzt dagegen das Ideal eines freizügigen Vagabundenlebens. Während des 1.Weltkrieges zeigt sich der Autor, der inzwischen in das Dorf Montagnola in die Schweiz umgesiedelt ist, als engagierter Pazifist. So beginnt er im Dienste der Kriegsgefangenenfürsorge Antikriegs-Essays herauszugeben, um von der „unnötigen Barbarei des Krieges“ zu überzeugen. Während des Krieges schreibt Hesse unter dem Pseudonym Emil Sinclair, da seine Werke verboten werden. Seine literarischen Werke erhalten zunehmend meditative, von der fernöstlichen Philosophie beeinflußte Züge, wie in Siddharta (1929). Hesse gibt 1923 die deutsche Staatsangehörigkeit auf und erwirbt das eidgenössische Bürgerrecht der Schweiz. Er trennt sich von seiner Frau und ist von 1924 bis 1927 mit Ruth Wenger (geb. 1897) verheiratet.1930 erscheint die Langerzählung Narzißund Goldmund. Hierin schildert Hesse einmal mehr die Zerrissenheit zwischen individuellem Rebellionsdrang und dem Zwang zu spießbürgerlicher Anpassung. Hesse heiratet 1931 erneut, und zwar die Kunsthistorikerin Ninon Dolbin geb. Ausländer (1895-1966). Der Autor erhält 1946 den Nobelpreis für Literatur. Die Philosophische Fakultät der Universität Bern verleiht ihm 1947 die Würde eines Ehrendoktor. Bis zu seinem Tod erhält Hesse noch einige Auszeichnungen, so 1955 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Am 9. August 1962 stirbt er in Montagnola an Gehirnschlag.
Seine Prosa wie seine nostalgische, oft nahezu rührselige und volksliednahe Lyrik weisen Hesse als harmonisierenden Nachfahren der Romantik aus. Die literarische Qualität seiner Texte ist heutzutage eher umstritten, außer Frage stehen hingegen seine kultur- und literaturkritischen Verdienste (eine Bibliothek der Weltliteratur, 1929).
2.Inhaltsangabe
Der Roman Hesses beschreibt eine Freundschaft zwischen Narziß, dem Denker, und Goldmund, dem Künstler und „Kind des Lebens“. Goldmund wird als Knabe von seinem Vater in die Klosterschule Mariabronn gebracht. Ohne Mutter, die „schon vor langer Zeit verschollen[en] oder umgekommen[en ..]“ und „die nur noch ein blasser Name war“(IV) aufwachsend, fühlt er sich nur zu wenigen Menschen hingezogen. Da ist zum einen Abt Daniel, denn ihn „war er geneigt [,] für einen Heiligen zu halten“(II). Zum anderen ist da der Lehrgehilfe Narziß, der die Rolle eines Führers und Vorbildes einnimmt und mit dessen Freundschaft Goldmund zum verdrängten Bild der Mutter und damit zu sich selbst findet. Dem Freund folgend, strebt er danach, „ein guter Schüler zu sein, bald ins Noviziat aufgenommen und dann ein frommer, stiller Bruder der Patres zu werden“(II). Narziß erkennt in Goldmund einen Seelenverwandten, der aber „in allem sein Gegenspiel zu sein“(II) scheint. Er bemerkt, daß auf „dem schönen, strahlenden Knaben [..] eine Bürde der Herkunft, eine geheime Bestimmung zu Sühne und Opfer“(II) liegt und will ihm helfen. Nach einem Gespräch zwischen beiden löst sich Goldmund aus dem tiefen Zwiespalt seiner Kindheit und stellt sich seiner wahren Natur - dem weltlichen Wanderleben. Denn „Eines [..] wußte er: der Mutter zu folgen, zu ihr unterwegs zu sein, [..]das war gut“(XII). So begibt er sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Er zieht viele Jahre umher, wandert von Hof zu Hof, von Frau zu Frau. Eines Tages kommt er in eine Kapelle nahe der Bischofsstadt, wo er eine Figur findet, die „so lebendig; so schön und innig und beseelt [ist], wie er es nie gesehen zu haben meinte“(X). Diese Mutter Gottes erweckt in ihm den Drang zur Kunst, und so geht er zu einem Bildschnitzer in die Lehre. Doch auch hier hält es ihn nicht lange, bald wandert Goldmund wieder umher, zeitweise in Gesellschaft, zeitweise allein. Er erlebt den Schwarzen Tod, von dem das Land heimgesucht wird. Vergebens kehrt er in die Bischofsstadt zurück, um seine Eindrücke zu verarbeiten. Statt dessen soll er aufgrund eines Verhältnisses hingerichtet werden, doch das Schicksal führt Narziß und Goldmund wieder zusammen. Narziß, der inzwischen Abt ist, erwirkt dessen Freilassung und führt ihn zurück ins Kloster, wo er sich eine Werkstatt einrichtet. Damit finden Kunst und Denken auf geistiger Ebene zusammen, und doch hält dieser Zustand Goldmund nicht. Obwohl er inzwischen gealtert ist, ruft es ihn erneut zur Wanderung. Als die Frauen auf seine Werbungen nicht mehr reagieren, setzt der Alterungsprozeß bei Goldmund auch geistig ein („und wie ich so ritt, hatte mich die Kraft und die Jugend [..] schon ganz verlassen“(XX)). Krank und innerlich zerbrochen kehrt er zu Narziß zurück, welcher bis zu seinem nahen Tod bei ihm bleibt.
3.Entstehung und Aufnahme
Im Frühjahr 1927 ging Hesse daran, die „Geschichte des Vaganten und Bildschnitzers Goldmund zu erzählen“. Bis 1929/30 schrieb er Teile im Veronahof in Baden und in Zürich, den Hauptteil verfaßte er in Montagnola. Der Vorabdruck erschien in der „Neuen Rundschau“ und trug den Untertitel: „Geschichte einer Freundschaft“. 1930 wurde der Roman innerhalb Hesses „Gesammelten Werken“ in Berlin herausgegeben.
In seinem Aufsatz „Eine Arbeitsnacht“ schreibt er, daß beinahe alle Werke, die er verfaßt hat, „Seelenbiographien“ sind, denn „in allen handelt es sich nicht um Geschichten, Verwicklungen und Spannungen, sondern sie sind im Grunde Monologe, in denen eine einzige Person, eben jene mythische Figur, in ihren Beziehungen zur Welt und zum eigenen Ich betrachtet wird“. Damit will er ausdrücken, daß die meisten seiner Hauptfiguren keine unterschiedlichen Typen sind, sondern nur in ihrem Schicksal, in Möglichkeit und Fähigkeit variieren und somit vielmehr eine „neue Inkarnation, eine [..] Verkörperung meines eigenen [Hesses] Wesens im Wort“ darstellen. So läßt sich behaupten, daß Hesse sich in seinen Werken immer wieder neu mit seinen Konflikten auseinandersetzt. Das erklärt, warum sich seine Geschichten in ihrer Handlung ähneln. In seinem Roman wendet sich Hesse diesmal von der Gegenwart ab. Er versetzt seine Figuren in das Mittelalter, ohne jedoch eine Wertung über die Vergangenheit ablegen zu wollen. Deshalb ist die Zeit, in der Goldmund lebt, auch keine wirklich reale Zeit. Sie stellt eher eine fiktive Illusion des Autors, vermischt mit geschichtlichen Ereignissen, dar. Doch ist das große Thema dasselbe geblieben, wie der Leser es teilweise in anderen Werken Hesses wiederfinden kann. So wird z.B. in den ersten sechs Kapiteln die Geschichte von Hans Giebenrath aus dem Roman „Unterm Rad“ abermals erzählt. Auch in diesem Werk ist ein Kloster Ausgangspunkt, führt eine falsche Erziehung zum Ausbruch der Hauptfigur aus ihrer Umgebung. Das Kloster Mariabronn hat übrigens ein existierendes Kloster zum Vorbild: das ehemalige Zisterzienserkloster Maulbronn, in dem sich das theologische Seminar befand, das der vierzehnjährige Hesse besuchte und aus welchem er erfolglos floh. Allerdings spielt Hesses Erzählung in vorreformatorischer Zeit, also vor 1500. Die Figur Goldmund aber ist nicht nur ein Mensch des Mittelalters. Sein Denken und Handeln ist geprägt von einer Zweidimensionalität, d.h. er bewegt sich auch in einer zweiten Zeitebene, der modernen Zeit des 20.Jahrhunderts.
Ebenso wird aus dem „Demian“ ein wichtiges Motiv wieder aufgenommen: das Symbol der Mutter. Gleich zu Beginn ist von den Persönlichkeitsproblemen Goldmunds, entstanden durch die Verdrängung der Mutter, die Rede. Doch nicht nur die individuelle Mutter sondern auch die moralische Urmutter stellen eine Art Leitfigur für ihn dar: „Es war Eva, die Urmutter, die dahinterstand“ (III.).
Hesses Werk erschien bereits im ersten Jahr in mehreren Auflagen mit insgesamt 40 000 Exemplaren. Mit Begeisterung wurde es vom Publikum wie auch von den Kollegen aufgenommen. Thomas Mann bezeichnete 1930 die Dichtung als „ein wunderschönes Buch in seiner poetischen Klugheit, seiner Mischung aus deutsch-romantischen und modernpsychologischen, ja psychoanalytischen Elementen“. Max Herrmann-Neiße nannte es sogar „eine Dichtung künstlerischer Meisterschaft“. Unter dem Einfluß nationalsozialistischer Herrschaft änderte sich jedoch die Bewertung, sodaß ab 1941 keine weiteren Auflagen mehr erschienen. Hesse selbst beschreibt die Wirkung seines Buches: „es erschien nicht lang vor der letzten Krieger- und Heldenepoche Deutschlands und war in hohem Grade unheldisch, unkriegerisch, weichlich und, wie man mir sagte, zur zuchtlosen Lebenslust verführend, [..] Studenten waren dafür, daß es verbrannt und verboten werden müsse“. Diese Meinung hat sich längst geändert. Die Geschichte des Goldmund besitzt heute wie damals Aktualität. Die Problematik, die darin enthalten ist, regt noch Jahrzehnte danach zur Diskussion an.
4.Charakteristik der Hauptpersonen
Der Titel des Romans „Narziß und Goldmund“ nennt schon im voraus die Hauptfiguren in Hesses Erzählung.
4.1.Narziß
Hesses Narziß kann nicht verglichen werden mit dem Jüngling aus der griechischen Sage, er ist eine freie Erfindung des Dichters. Mit Narziß beginnt die Handlung und mit ihm hört sie auch wieder auf. Obwohl dies eine Dichtung über Goldmund und sein Leben ist, spielt Narziß eine entscheidende Rolle. Zu ihm findet Goldmund immer wieder zurück und der Gedanke an Narziß ist es, der ihn treibt, den Sinn des Lebens zu suchen.
Gleich zu Beginn der Handlung wird die Rolle des Narziß definiert. Er erscheint als etwas Besonderes, obgleich er nur Zögling eines Klosters ist. In einem Zuge mit dem Abt Daniel erwähnt, als die „zwei, von denen jeder wußte, auf die jeder achtete“ (I), wird er in dem Kloster Mariabronn von allen verehrt. Er gilt als ein „Wunderknabe, dem schönen Jüngling mit dem eleganten Griechisch, mit dem ritterlich tadellosen Benehmen, mit dem stillen, eindringlichen Denkerblick und den schmalen, schön und streng gezeichneten Lippen.“ (I). Hesse führt dem Leser das Bild des „Auserwählten“ (I) auf wunderbare Weise vor. Narziß wird eindeutig charakterisiert als ein sehr intelligenter Mensch, auf eine gewisse Art arrogant und doch edel und angenehm. Er besitzt die Eigenschaft, in die Seele eines Menschen zu blicken und dessen Bestimmung zu erahnen. Narziß weiß, daß er zum Klosterleben bestimmt ist und lebt danach. Aufgrund seines Wissens unterrichtet er bereits, ohne im Noviziat aufgenommen zu sein. „Der Kern und Sinn seines Lebens war der Dienst am Geist, der Dienst am Wort, war das stille, überlegene, auf eigenen Nutzen verzichtende Führen seiner Schüler“ (II). Er fühlt sich sehr zu dem Abt hingezogen, ansonsten ist er ein Einzelgänger. Bis auf den Tag, da Goldmund in die Klosterschule aufgenommen wird. Von Anfang an erkennt er in diesem Schüler einen Seelenverwandten und so wird Narziß` Liebe zu Goldmund geweckt. Obgleich der Ähnlichkeiten bemerkt Narziß auch, daß Goldmund sein Gegenpol ist, nach dem er gesucht hat. „Er wünschte sich diesen hübschen, hellen, lieben Jungen zum Freunde, [..] er hätte ihn an sich nehmen mögen, ihn führen, aufklären, steigern und zur Blüte bringen.“ (II) Doch er hält sich zurück, nur allmählich kommt zwischen beiden eine Annäherung zustande. Narziß erkennt den Komplex, den Goldmund in sich trägt und an dem er leidet. Er will ihm helfen, denn er glaubt nicht an dessen Bestimmung für ein Leben im Kloster. In einem ernsten Gespräch gelingt es ihm endlich, den Freund an seine Kindheit und damit an seine Mutter zu erinnern. Er macht ihm den Unterschied bewußt, der zwischen beiden besteht. Nachdem Goldmund zur Einsicht gelangt ist, trennen sich ihre Wege. Narziß wird Abt des Klosters. Als sie nach langen Jahren erneut aufeinander treffen, besteht Narziß` Aufgabe nicht mehr darin, Goldmund zur Annahme seiner wahren Natur und damit zum Aufbruch in die Welt zu bewegen, sondern er führt ihn zurück in die Klosterwelt. Somit finden Kunst durch Goldmund und Denken, vertreten durch Narziß, auf geistiger Ebene zusammen.
4.2.Goldmund
Auch diese Gestalt ist eine freie Erfindung des Dichters, sie hat nichts gemein mit dem Patriarchen Johannes Chrysostomos (4.Jh.n.Ch.). Goldmund wird in die Erzählung durch seinen Eintritt in die Klosterschule Mariabronn eingeführt. Sein Vater, „ein ältlicher Herr mit einem versorgten und etwas verkniffenen Gesicht“ (I), findet nur kurz Erwähnung. Seine Mutter hat er verdrängt als Folge der Erziehung durch den Vater. Goldmund selbst wird als ein hübscher Junge beschrieben mit einem holden Lachen und hellblondem Haar. Er ist ein „Träumer und eine kindliche Seele“, und „durch sichtbare Gaben und Zeichen vor den andern ausgezeichnet“ (II). Schnell lebt er sich ein und wird, aufgrund seiner Offenheit, von allen akzeptiert. Doch einen wirklichen Freund findet er nicht. Es gibt zwei Menschen im Kloster, zu denen Goldmund sich hingezogen fühlt, „für die er Bewunderung, Liebe und Ehrfurcht“ (II) empfindet: den Abt Daniel und den Lehrgehilfen Narziß. Goldmund ist gewillt, „nicht nur die Klosterschule zu absolvieren, sondern womöglich ganz und für immer im Kloster zu bleiben und sein Leben Gott zu weihen; so war es sein Wille, [..] so war es wohl von Gott selbst bestimmt und gefordert.“(II). So sehr er auch die Freundschaft des schönen und überlegenen Lehrgehilfen sucht, so findet er doch „keine andere Weise, um Narziß zu werben, als daß er sich bis zur Übermüdung bemüht[e], ein aufmerksamer und gelehriger Schüler zu sein“(II). In einem schwachen Moment Goldmunds beginnt die Freundschaft zu Narziß, und Goldmund gibt sich „innig und glühend, spielend und rechenschaftslos“ (II) dem hin. Entgegen den Reden seines Freundes, liegt es Goldmund ferne, „ sich seinen Freund als Widerspiel und Gegenpol zu denken. Ihm schien, es bedürfe ja nur der Liebe, […] um Unterschiede auszulöschen“(III). Doch Narziß glaubt nicht an „Goldmunds Bestimmung zum Asketen“, statt dessen erkennt er, daß er „alle Zeichen eines starken, in den Sinnen und der Seele reich begabten Menschen [trägt], eines Künstlers vielleicht, jedenfalls aber eines Menschen von großer Liebeskraft“(III). Endlich bringt Narziß Goldmund so weit, daß er sich an seine verlorene Vergangenheit, die Gestalt der Mutter, erinnert: „Es ist unbegreiflich, wie ich das hatte vergessen können. Nie in meinem Leben habe ich jemand so geliebt wie meine Mutter, so unbedingt und glühend.“(IV). Nun, da Goldmund geheilt ist, treibt es ihn mit 18 Jahren hinaus in die Welt. Er befreit sich damit von der geistigen Führung durch Narziß. Viele Jahre wandert Goldmund durch das Land, die Liebe wird zu seinem Ziel. In ihm brennt „der Stolz und die Verachtung des Heimatlosen gegen die Seßhaften und Besitzenden“(XI). Er erlebt Tod und Pest, Angst, Hunger und Durst. Er findet ein Ausdrucksmittel für sein Inneres - die Kunst des Bildschnitzens. Nachdem Narziß ihn vor einem Todesurteil bewahrt und Goldmund in das Kloster zurückkehrt, erkennt er den Sinn seines Lebens, „als übersähe er es wie von oben, sähe deutlich seine drei großen Stufen: die Abhängigkeit von Narziß und ihre Lösung - die Zeit der Freiheit und des Wanderns - und die Rückkehr, die Einkehr, den Beginn der Reife und Ernte.“(XVII).
Polarität: Vergänglichkeit des Lebens - Ewigkeit der Kunst Im ganzen Roman lassen sich Gegensätzlichkeiten finden, und das in den unterschiedlichsten Variationen. Sei es nun der Gegensatz zwischen Narziß und Goldmund oder zwischen „Seßhafter und Landfahrer“, all dies zeigt die Spannung auf, von der die Geschichte lebt. „Eine Versöhnung der Gegensätze ist nur durch das Erkennen und Verstehen des Gegenpols möglich.“
Die Polarität“Vergänglichkeit des Lebens - Unvergänglichkeit der Kunst“ ist eine Spannung, welche die ganze Erzählung durchzieht, und die Goldmund am Ende seines Lebens erkennt und versteht. Denn in ihm selbst herrschen diese zwei Pole: das Leben und die Kunst. Goldmund ist ein Mensch, der das Leben liebt und der es in vollen Zügen auskostet. Er gehört zu den „Naturen [..] mit den starken und zarten Sinnen“(IV), zu den Künstlern. Schon als Knabe zeichnet er viel und gerne. Eine reiche Phantasie ist ihm eigen, wobei er sich manchmal selbst davon überraschen läßt, „ob aus der begonnenen Gestalt das Blatt eines Baumes, die Schnauze eines Fisches, […] die Augenbraue eines Menschen werde.“(VII) Als Klosterschüler hat Goldmund es oft als Nachteil der Gelehrsamkeit empfunden, „alles so zu sehen und darzustellen, als ob es flach wäre und nur zwei Dimensionen hätte.“(VI). Erst, als er die Madonna des Meister Niklaus sieht, wird er sich seiner Berufung bewußt, und so geht er zu ihm in die Lehre. Sein Talent besteht nicht nur in der Gabe des Zeichnens oder Schnitzens, er besitzt einen Blick für Details, für Zusammenhänge und Möglichkeiten. Er findet Mittel und Wege, sein Können umzusetzen. Er denkt viel über das Gesehene und Aufgenommene nach und kommt zu der Erkenntnis, daß „in einer Gestalt überall eine gewisse Form, eine gewisse Linie wiederkehrt, wie eine Stirn dem Knie, eine Schulter der Hüfte entspricht, und wie das alles im Innersten gleich und eins ist mit dem Wesen und Gemüt des Menschen...“
(X). Er bemerkt, daß auch das Ungreifbare und Gestaltlose auf seine Seele wirkt und befindet sich damit als Künstler mitten zwischen Natur und Geist. „Mit irgendeinem geheimen Sinn ahnte Goldmund […] das Geheimnis seiner Künstlerschaft, seiner innigen Liebe zur Kunst, seines zeitweiligen wilden Hasses gegen sie. Ohne Gedanken, gefühlhaft ahnte er in vielerlei Gleichnissen: die Kunst war eine Vereinigung von […] Geist und Blut; […] alle jene echten und unzweifelhaften Künstlerwerke hatten dies gefährliche, lächelnde Doppelgesicht, dies Mann - Weibliche, dies Beieinander von Triebhaftem und reiner Geistigkeit.“(XI) Als ihm dies deutlich wird, erscheint das Bild der Urmutter, entstanden aus dem Bildnis seiner Mutter, in ihm immer klarer. Nur hier vereinen sich alle Gegensätze: „Die Mutter des Lebens konnte man Liebe oder Lust nennen, man konnte sie auch Grab und Verwesung nennen. Die Mutter war Eva, sie war die Quelle des Glücks und die Quelle des Todes, sie gebar ewig, sie tötete ewig, in ihr waren Liebe und Grausamkeit eins, und ihre Gestalt wurde ihm [Goldmund] zum Gleichnis und heiligen Sinnbild, je länger er sie in sich trug.“(XI) Diese Vorstellung reift in ihm. So wird dies sein Ziel, das Gesicht der Eva einzufangen und für ewig festzuhalten. Immer wieder „zuckt“ ein „fahles Leuchten in Goldmunds Seele“ auf und für einen Moment sieht er das Bild der Urmutter, „über den Abgrund des Lebens geneigt“ (XI). So sehr die Kunst für Goldmund sein Leben bedeutet, so sehr fordert sie auch Opfer von ihm. Für die Kunst gibt er „das Höchste und Unentbehrlichste […], was er nächst der Liebeswollust kannte: die Freiheit.“(XI) auf, denn um seine Ideen umzusetzen, benötigt er die Mittel dazu. Dieser Umstand quält ihn sehr. Mit dem Entdecken des Künstlers in sich hatte er einen neuen Weg betreten und war, wenn auch nur für einige Zeit, wieder seßhaft geworden. Doch das ist gegen Goldmunds unstete Natur: „Die Kunst war eine schöne Sache, aber sie war keine Göttin und kein Ziel, für ihn nicht; nicht der Kunst hatte er zu folgen, nur dem Ruf der Mutter“(XII). Seßhaftigkeit, was die Kunst letztendlich einfordert, führt in Goldmunds Augen zur Verdorrung und Verkümmerung der inneren Sinne.
Dennoch war er ein Künstler, eine Art Lebenskünstler, ein Philosoph. Auf seinem Weg durch die Welt erkennt Goldmund, daß alles Leben und Sein vergänglich ist. Es wird nichts bleiben von dem, was ein Mensch in seinem Leben erreicht. Es sei denn, es ist von so einer Stärke und Ausdruckskraft, daß es dem Vergessen durch die Menschen selbst standhält. Goldmund ist ein sehr emotionaler Mensch, tagelang grübelt er über den Sinn des Lebens nach, wenn doch alles am Ende eines einzigen Menschenlebens verlorengeht. Diese stumme Klage erhebt er gewissermaßen gegen Gott, wodurch er sich in einem großen Zwiespalt mit sich selbst befindet. Er zweifelt damit die Ewigkeit aller Dinge an. Für ihn gibt es fast ausschließlich nur die Stimmungen ´himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt`, dazwischen bewegt er sich. Befindet sich Goldmund in einer depressiven Phase, so will ihm nichts gelingen, doch gerade jetzt kommt er zu Einsichten, die er braucht, um Künstler zu sein. Er ist wütend über all diese Erkenntnisse und er trauert: „so erging es allen und allem, es blühte schnell und welkte schnell hinweg, nachher fiel der Schnee drüber“(XII). Diese Schwermut in ihm bringt ihn dazu, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Er ist wie ein Kind, so voll von Träumen und Wünschen, das der Realität entfliehen will und doch ihre Geheimnisse bereits kennt, um ihre Grausamkeiten bereits weiß. Immer wieder flüchtet er sich in eine innere Welt, er lebt in Gedanken, in irrealen Momenten. „Aus demselben unwirklichen, magischen Stoff waren nachts die Träume gewoben, ein Nichts, das alle Bilder der Welt in sich enthielt, ein Wasser, in dessen Kristall die Formen aller Menschen, Tiere, Engel und Dämonen als allzeit wache Möglichkeiten wohnten.“(XII) Er philosophiert über das Schöne genauso wie über das Grausame, jedem bringt er eine unersättliche Neugier entgegen. In allem, was ihm begegnet, ob nun Mensch oder nicht, sucht er ein Geheimnis, das Geheimnis des Daseins. Dieses Geheimnis möchte er darstellen und zum Sprechen bringen. Nur das bedeutet für ihn wahre Kunst. Auf dieser fortwährenden Suche ist er hin und her gerissen zwischen der Genialität des Seins und der Unfähigkeit der Menschen, dies zu erkennen und dessen Sinn zu erfassen. Er leidet „an quälender Sehnsucht, den holden dahintreibenden Unsinn des Lebens durch Geist zu beschwören und in Sinn zu verwandeln“(XIII). Seinen Glauben an die Ewigkeit hat er schon längst aufgegeben, obwohl er sich noch auf der Suche danach findet. Er ist uneins mit seinem Glauben. Wütend erkennt er, daß man nur entweder leben konnte, ohne gegen die Vergänglichkeit geschützt zu sein, oder man mußte auf das Leben verzichten und suchte dem flüchtigen Leben ein Denkmal zu bauen. Beides zu vereinen ist sein Bestreben, das versteht er als einzigen Sinn: „Schaffen, ohne dafür den Preis des Lebens zu zahlen!“(XIV). Alles Dasein beschränkt sich auf „die Zweiheit“ und es besteht eine ewige Sehnsucht im Menschen, diese „Zweiheit“(XIV) auszulöschen. Warum gab es einen Gott, wenn seine Schöpfung so unvollkommen, so mißglückt schien? War dies eine göttliche Absicht, denn aus dieser Unvollkommenheit entstand auch das Schöne? Doch wozu das alles, darauf konnte Goldmund sich keine Antwort geben.
Als Goldmund am vermeintlichen Ende seines Lebens, der Stunde seiner Hinrichtung, steht, will er sich seinem Schicksal nicht ergeben. Mit einer wilden Verbissenheit kämpft er entschlossen gegen den nahen Tod an: „ob es nun eine Ewigkeit geben mochte oder nicht: er begehrte sie nicht, er wollte nichts als dies unsichere, vergängliche Leben, dieses Atmen,[…] er wollte nichts als leben“(XIV). Das Schicksal aber hat ihn noch nicht zum Tode vorgesehen, er kann durch Narziß gerettet werden. Hier können nun Kunst und Denken auf einer geistigen Ebene vereinigt werden. Die beiden verfallen in einen heftigen Disput darüber, in was für einer Welt sie leben, und was für eine Rolle die Menschen darin spielen. Goldmund ist erbost über die Welt und was in ihr geschieht: „es will mir scheinen, unsere Mütter hätten uns in eine hoffnungslos grausame und teuflische Welt hinein geboren, und es wäre besser, sie hätten es nicht getan und Gott hätte diese schreckliche Welt nicht erschaffen“ (XVII). Goldmund wird von Narziß belehrt, daß nicht Gedanken, sondern daß es Gefühle sind, die ihn treiben. („Es sind die Gefühle eines Menschen, dem das Grauen des Daseins zu schaffen macht.“(XVII)) Sie kommen überein, daß es neben diesen Gefühlen auch noch jene der Freude und der Lust gibt, doch daß das „Grauen“ dadurch nicht vermindert wird. Aus all dem gibt es nur wenig, was ein Menschenleben überdauern kann: die Kunstwerke. So etwas zu erschaffen, scheint für Goldmund der einzige Trost zu sein, denn sie „bilden jenseits des Augenblicks ein stilles Reich der Bilder und Heiligtümer. […] es ist beinahe [wie] ein Verewigen des Vergänglichen“(XVII). Sicher, auch Kunstwerke können zerstört werden, aber die Chance, daß man sich ihrer auch noch über den Tod des Künstlers hinaus erinnert, ist wesentlich höher. Denn das „Urbild eines guten Kunstwerkes […] ist nicht Fleisch und Blut, es ist geistig. Es ist ein Bild, das in der Seele des Künstlers seine Heimat hat“(XVII). Mit dem Bekennen zu den Urbildern, muß Goldmund einsehen, daß er sich in die geistige Welt begeben hat. Zwar in einer anderen Art als der Denker Narziß, damit ist aber der Gegensatz zwischen Narziß und Goldmund in einer Form von Gegenseitigkeit und Freiheit überbrückt. Langsam beginnt Goldmund den Sinn seines Lebens zu verstehen. In dem er sich selbst verwirklichen konnte, hat er „das vollkommene Sein“ (XVIII) angestrebt, also Gott selbst. Die totale Vollkommenheit gibt es nicht, aber indem man es versucht, indem man nach Möglichkeiten sucht, an diesem `Sein´ teilzuhaben, verwirklicht man sich selbst. Der Glaube an Gerechtigkeit kehrt allmählich zu Goldmund zurück, der Glaube an Gott allerdings nie mehr. Mit jedem Werk, das er fertigstellt, gibt er ein Stück seines Inneren her und es bleibt eine Leere zurück. Es dauert, bis diese Lücke wieder angefüllt ist mit neuen Bildern. Mit der Zeit wird Goldmund müde und unruhig, und so begibt er sich noch einmal auf die Suche nach Ideen. Von dieser Reise kehrt jedoch ein anderer Goldmund zurück, ein Goldmund, der um viele Jahre auch innerlich gealtert ist. Eine innere Zufriedenheit scheint auf seiner Seele zu liegen. Seine Schöpferkraft ist erloschen, nun herrscht eine Art ruhige Gleichgültigkeit in ihm. Er ist bereits der Wirklichkeit entfernt, es scheint, daß Goldmund Frieden mit sich und der Gestalt der Urmutter geschlossen hat. Er hat erkannt, daß „die Sinnlichkeit [das Leben] beseelt werden kann“(XX). Mit dieser Harmonie, die zu erreichen die Triebkraft seiner Kunst war, ist er nun bereit, zu sterben. Er glaubt nicht an das Jenseits, dafür träumt er davon, endlich zu seiner Mutter zu gelangen, seinen Weg zu ihr zu beenden. „Ich kann mich von dem Gedanken nicht trennen, daß […] es meine Mutter sein wird, die mich wieder zu sich nimmt und in das Nichtsein und in die Unschuld zurückführt.“(XX). Sein Traum war es gewesen, eine Figur der Mutter zu machen. „Vor kurzem noch wäre es mir ganz unerträglich gewesen zu denken, daß ich sterben könnte, ohne ihre Figur gemacht zu haben; mein Leben wäre mir unnütz erschienen. Und nun sieh, wie wunderlich es mir mit ihr gegangen ist: statt daß meine Hände sie formen und gestalten, ist sie es, die mich formt und gestaltet. […] Ich sterbe gern, sie macht es mir leicht.“ (XX).
6.Literaturverzeichnis
1. Böttger, F.: Hermann Hesse. Berlin: Verlag der Nation IV 1980.
2. Pfeifer, M.: Königs Erläuterungen und Materialien - Hermann Hesse, Bd. 86. Hollfeld: Bange Verlag VII 1992
3. Deutsche Dichter - Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart: Reclam Verlag 1993
4. Bertelsmann Universallexikon. Gütersloh/München: Bertelsmann Electronic Publishing 1994
5. Enzyklopädie Encarta. Microsoft 1997
7 Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.Anmerkung - Zitate
- Hesse, Hermann: Leben, Werk und Zeit:
- Zitat Zeile 8: „entweder Dichter oder gar nichts“ aus: Königs Erläuterungen und Materialien, S.7
- Inhaltsangabe:
- Zitat Zeile 2: „Kind des Lebens“ aus: Deutsche Dichter , S.597
- restlichen Zitate aus dem laufenden Text des Romans „Narziß und Goldmund“ entnommen
- Entstehung und Aufnahme:
- Zitat Zeile 1-2: „ Geschichte des Vaganten und Bildschnitzers Goldmund zu erzählen“ aus: Fritz Böttger, S.361
- Zitate Hesse aus: Königs Erläuterungen und Materialien, S.23-25
- Charakteristik der Hauptpersonen:
- Narziß - Zitate aus dem laufenden Text des Romans
- Goldmund - Zitate aus dem laufenden Text des Romans
- Polarität: Vergänglichkeit des Lebens-Ewigkeit der Kunst:
- Zitat Zeile 3: „Seßhafter und Landfahrer“ aus: Königs Erläuterungen und Materialien, S.58
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inhaltsverzeichnis von "Narziss und Goldmund"?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Kurzbiographie, Inhaltsangabe des Romans, Entstehung und Aufnahme der Erzählung, Charakteristik der Hauptpersonen (Narziß und Goldmund), Hauptproblem der Polarität, Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Anmerkung - Zitate, Eidesstattliche Erklärung, und Bildmaterial.
Was ist eine kurze Biographie von Hermann Hesse?
Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw/Württemberg geboren. Er war Schriftsteller und Literaturkritiker. Zu seinen Werken gehören Unterm Rad und Peter Camenzind. Er erhielt 1946 den Nobelpreis für Literatur und starb am 9. August 1962 in Montagnola.
Worum geht es in der Inhaltsangabe von "Narziss und Goldmund"?
Der Roman beschreibt die Freundschaft zwischen Narziß, dem Denker, und Goldmund, dem Künstler. Goldmund wächst in einem Kloster auf, löst sich dann aber und begibt sich auf eine Wanderschaft, auf der er die Kunst entdeckt und viele Erfahrungen sammelt. Später kehrt er ins Kloster zurück und stirbt schließlich.
Wie entstand die Erzählung "Narziss und Goldmund" und wie wurde sie aufgenommen?
Hesse begann 1927 mit dem Schreiben der Geschichte. Sie erschien zunächst als Vorabdruck in der "Neuen Rundschau" und wurde 1930 als Teil seiner "Gesammelten Werke" herausgegeben. Thomas Mann lobte das Werk, aber unter dem Einfluss des Nationalsozialismus wurde es ab 1941 nicht mehr aufgelegt. Heute wird die Geschichte wieder geschätzt und regt zur Diskussion an.
Wie werden Narziß und Goldmund charakterisiert?
Narziß wird als intelligenter, edler und etwas arroganter Mann beschrieben, der zum Klosterleben bestimmt ist. Goldmund hingegen ist ein hübscher, offener Junge, der sich nach Liebe sehnt und dessen Weg ihn in die Welt und zur Kunst führt.
Was ist das Hauptproblem der Polarität in "Narziss und Goldmund"?
Das Hauptproblem ist die Polarität zwischen Denken und Fühlen, Geist und Sinnlichkeit, Seßhaftigkeit und Wanderschaft, Vergänglichkeit des Lebens und Ewigkeit der Kunst. Der Roman zeigt, wie diese Gegensätze sich ergänzen und wie die Figuren damit umgehen.
Welche Literatur wird im Literaturverzeichnis von "Narziss und Goldmund" erwähnt?
Das Literaturverzeichnis listet folgende Werke auf: Hermann Hesse von F. Böttger, Königs Erläuterungen und Materialien - Hermann Hesse von M. Pfeifer, Deutsche Dichter - Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bertelsmann Universallexikon, und Enzyklopädie Encarta.
Was sind die Anmerkungen zu Zitaten in "Narziss und Goldmund"?
Die Anmerkungen geben Auskunft darüber, wo die Zitate im Text herkommen. Hauptsächlich stammen die Zitate direkt aus dem Roman, zusammen mit einer Referenz zu Böttger.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1999, Hesse, Hermann - Narziss und Goldmund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105428