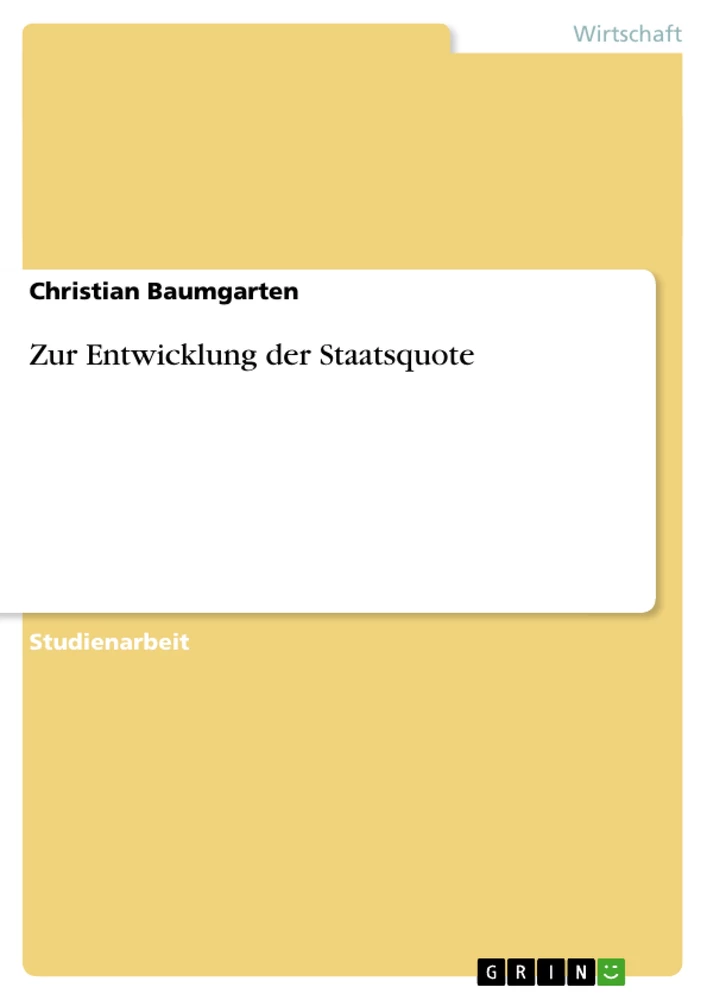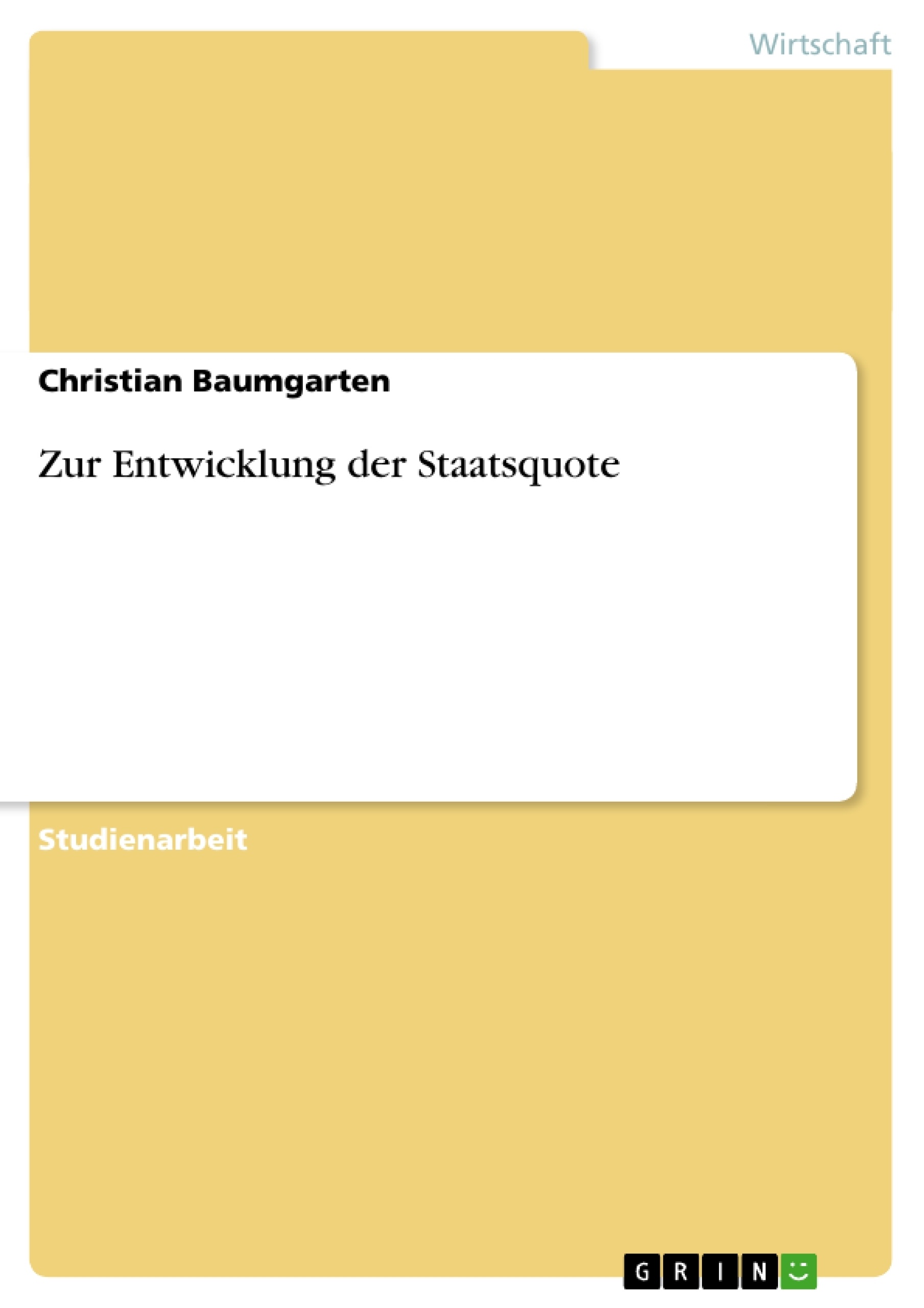1. Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
Studiert man die internationale finanzwirtschaftliche Literatur, so stellt man fest, dass vor allem in den westlichen Industrieländern der Staatssektor in den letzten Jahrzehnten erheblich an Umfang und damit auch an Bedeutung gewonnen hat. Dies läßt sich vor allem durch die Zunahme der Staatsausgaben und der damit verbundenen Erhöhung der Staatsquote dokumentieren. Holsey und Borcherding zum Beispiel zeigen, dass sich die Staatsquote in den letzten neun Jahrzehnten in den USA um ungefähr 500% erhöht hat.1 Sie stellen auch fest, dass in den reicheren Industrieländern die Staatsquoten ungefähr bei 40% liegen.2 Ein weiterer Hinweis auf das Wachstum des Staatsapparates ist die Zunahme der Beschäftigten im öffentlichen Sektor.
Dieses Phänomen des wachsenden Staates wird zunehmend in der volkswirtschaftlichen Literatur diskutiert und es werden Modelle vorgestellt, welche versuchen das Wachstum selbst und die damit verbundenen wachsenden Staatsausgaben zu erklären. In der Seminararbeit soll im ersten Teil der Begriff der Staatsquote näher erläutert werden, sowie deren Aussagekraft und die Entwicklung der Staatsquote in Deutschland und in ausgewählten Ländern. Im zweiten Teil, welcher den Hauptteil der Seminararbeit darstellt, werden -ausgehend von der Analyse von Cheryl M. Holsey und Thomas E. Borcherding- Modelle und Ansätze zur Erklärung des Staatswachstums und die damit verbundene Zunahme der Staatsausgaben dargestellt und kritisch betrachtet. Dabei werden zwei Modellkategorien unterschieden: 1. die Modelle ohne ,,politischen Charakter", wonach das Handeln des Staates aufgrund von Marktversagen begründet wird und 2. die Modelle mit ,,politischem Einfluss", welche sich hauptsächlich mit ,,Rent- Seeking" Aktivitäten beschäftigen.3 Dabei wird hauptsächlich Sekundärliteratur ausgewertet. Anschließend erfolgt eine abschließende Betrachtung der Gesamtsituation.
2. Die Staatsquote als Maßstab der Staatsaktivität
2.1. Definition
Die Staatsquote misst das Verhältnis von Staatsausgaben zum Bruttosozialprodukt4 und kann formal dargestellt werden als:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Definition entspricht der allgemeinen Staatsquote.
In der Literatur finden sich noch differenzierte Darstellungsweisen, wie zum Beispiel in Blankart. Er teilt die Staatsquote noch einmal in Realausgaben- und Gesamtausgabenquote, die er wie folgt darstellt:5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 6
2.2. Zur Aussagekraft der allgemeinen Staatsquote
Alle Daten, die zur Ermittlung der Staatsquote dienen, werden aus den statistischen Berechnungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ermittelt. Diese sind üblicherweise mit Messfehlern und Ungenauigkeiten behaftet.7
Auch die BSP-Größe oder BIP-Größe unterliegen kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen, welche den Aussagewert der Staatsquote zusätzlich verfälschen können.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Staatseingriffe durch Regulierung, die zu privaten Ausgaben verpflichten,8 in die Staatsquote ebenso wenig eingehen, wie staatliche Maßnahmen die zu privaten Ausgaben anreizen9. Im allgemeinen ist aber zu sagen, dass, hält man kleinere Schwankungen der Staatsquoten für unbedeutend, sich langfristig ein Trend der wachsenden Staatsquote, wie im Punkt 2.3. zu sehen ist, abzeichnet.
2.3. Staatsquoten in Deutschland und ausgewählten Ländern
Nachdem wir die These aufgestellt haben, dass sich die Staatsquote langfristig erhöht, soll diese nun durch Zahlen belegt werden. Die nun folgende Abbildung verdeutlicht die langfristige Zunahme der Staatsausgaben.
Abb. 1: Die Zunahme der Staatsquote in ausgewählten Ländern10
Man kann deutlich sehen, dass in den dargestellten Ländern die Staatsquoten gestiegen sind. Im nächsten Abschnitt sollen verschiedene Modelle dargestellt werden, die das Phänomen wachsender Staatsquoten erklären sollen.
3. Warum wächst der Staat? Streifzüge durch die Literatur
In der Literatur gibt eine unersättliche Fülle von Ansätzen und Modellen welche versuchen den wachsenden Staatsapparat und die damit verbundenen wachsenden Staatsausgaben zu erklären. Dabei kann man diese Ansätze einteilen in: traditionelle und neuere Ansätze, kurzfristige und langfristige Ansätze oder in ,,apolitical"- und ,,poltical" models, wie sie von Holsey und Borcherding eingeteilt wurden.
3.1. Modelle ohne ,,politischen Einfluss" - Darstellung und Kritik
Diese Modelle klammern die politischen Institutionen und deren Entscheidungen aus.11 Sie betonen den nichtpolitischen Einfluss auf die Erhöhung der Staatsausgaben. Folgende Modelle werden vorgestellt:
- Das Wagner'sche Gesetz wachsender Staatsausgaben
- Die Hypothese von Peacock und Wiseman
- Baumol's Modell des begrenzten Produktivitätsfortschritts im Staatssektor
- Erklärungen mittels des Medianwählermodells sowie
- eine Kurzdarstellung weiterer Ansätze und Meinungen aus der neueren Literatur.
3.1.1. Das Gesetz wachsender Staatsausgaben von Alfred Wagner
Alfred Wagner stellte erstmals 1863 sein ,,Gesetz der wachsenden Staatsausgaben" auf. Er begründete dies mittels neueren öffentlichen Aufgaben, die der Staat nun zunehmend zu übernehmen hatte. Er unterschied diese Aufgaben nach Rechts- und Machtzwecken sowie Kultur- und Wohlfahrtszwecken.12 Er meint, dass mit der zunehmenden Bevölkerungsdichte und der weiterentwickelten Arbeitsteilung stets komplizierter werdende Verkehrs-, Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse folgen. Dies schlage sich zum Beispiel in Form von steigenden Ausgaben für die Verwaltung, die Polizei und dem Heer nieder.13
Der Staat kann sich aber nicht nur auf die traditionellen Tätigkeiten des Rechtsstaates beschränken, sondern muß auch vermehrt Aufgaben für Kultur und Wohlfahrt übernehmen. Durch den zunehmenden Wohlstand und die Erhöhung der Einkommen des Volkes verlagert sich ein Teil der privaten Nachfrage zu höheren Bedarfsbereichen, wie zum Beispiel höhere Schulbildung, soziale Sicherheit, bessere Gesundheitsversorgung, welche aber nicht mehr durch private Leistungen abgedeckt werden können, sondern durch öffentliche Leistungen abgedeckt werden müssen.14 Durch die genannte Aufgabenerweiterung des Staates steigen die öffentlichen Ausgaben und zwar überproportional zum Wachstum des Sozialproduktes. Dies bedeutet aber auch, dass die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen eine Einkommenselastizität größer als eins mit sich bringe.15
Tests der Hypothese von Wagner haben unterschiedliche Resultate ergeben. Viele Studien ergaben keinen geschätzten Einkommenselastizitätskoeffizient von über eins.16 Es wird weiterhin eingewendet, dass es sich bei Wagner's Analyse um vorschnelle Verallgemeinerungen vereinzelter empirischer Beobachtungen handelt.17 Des weiteren kritisiert Leineweber, dass sich Wagners Ausführungen auf geschichtsphilosophische Annahmen stützen, ,, die einer Denkweise entsprechen, wie man sie in der Wissenschaft der Gegenwart kaum mehr findet."18
3.1.2. Die Hypothese von Peacock und Wiseman
Diese Hypothese geht davon aus, dass 19 Kriege und soziale Unruhen die Staatsausgaben steigen lassen. In normalen Zeiten bestimmt die Bevölkerung die Steuerlast und das damit verbundene Ausgabenvolumen. In großen Krisen und Kriegen verursacht die Erhöhung der Vorstellung über gewünschte Ausgaben und ertragbare Steuern eine Niveauverschiebung, die Peacock und Wisemann ,,displacement effect" nennen. Nach den Kriegen und Krisen sinkt der Staatsanteil nicht mehr auf das frühere Niveau. Die Überprüfung der Hypothese legte jedoch kaum empirische Evidenz vor.
3.1.3. Baumol's Modell des begrenzten Produktivitätsfortschritts im Staatssektor
Baumol erklärt das Wachstum der Staatsausgaben mit dem kleineren Produktivitätsfortschritt im öffentlichen, relativ zum privaten Sektor.20 Er unterscheidet die arbeitsintensive Produktion von Dienstleistungen im öffentlichen Sektor und die kapitalintensive Güterproduktion im privaten Sektor.21 Im öffentlichen Sektor gibt es keine oder kaum eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität, im privaten Sektor erfolgt dagegen ein positiver Zuwachs. Da staatliche Dienstleistungen sehr arbeits- und lohnkostenintensiv sind, ist eine Rationalisierung kaum möglich. Im privaten Sektor dagegen würden Lohnkostensteigerungen durch Produktivitätssteigerungen aufgefangen und somit die Lohnstückkosten konstant gehalten. Da die Löhne im privatem wie im öffentlichem Sektor gleich rasch steigen, steigen durch die nicht oder kaum vorhandene Arbeitsproduktivität im öffentlichem Sektor die Kosten überproportional. Dieses kann sich wiederum in steigenden öffentlichen Ausgaben niederschlagen.22
Es wurden viele Studien zu Baumols Hypothese gemacht. Bradford, Malt und Oates (1969) haben empirische Analysen durchgeführt und festgestellt, dass die steigenden Kosten öffentlicher Leistungen ein ausgabenfördernder Faktor ist.23
Auch Spawn beschäftigte sich mit der Hypothese von Baumol. Gestützt auf die Arbeit von Bradford, Malt und Oates (1969) und eigener Berechnungen von Produktivitätsfortschritten bei Leistungen von lokalen Gebietskörperschaften24
kommt er auch zu dem Ergebnis, dass es nur einen geringfügigen bis hin zu gar keinen Produktivitätsfortschritt bei diesen öffentlichen Leistungen gibt.
Folgende Kritikpunkte zu Baumol sind aber anzumerken: (1) Es kann die starke Zunahme der Transferleistungen nicht erklären und (2) die empirischen Untersuchungen können höchstens 40% des tatsächlichen Staatsausgabenwachstums erklären.25
3.1.4. Erklärung des Staatsausgabenwachstums mit dem Medianwählermodell
Im einfachsten Modell wird unterstellt, dass die Bürger ihre kollektiven Entscheidungen über öffentliche Ausgabenprojekte in direkter Abstimmung und mit Hilfe der einfachen Mehrheitsregel fällen. Somit kann hier das Medianwählermodell zur Erklärung des Wachstums der Staatsausgaben herangezogen werden.26 Die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen kann wie folgt charakterisiert werden:27
ln (X) = a + b*ln(Y) + c*ln(P) + d*ln(E) +µ mit
X = öffentliche Ausgabenprogramme
Y = Medianeinkommen
P = Steuerpreis des Medianeinkommenbeziehers
E = Bevölkerungszahl
a,b,c,d =Parameter
µ = Störglied
Somit hängt die Nachfrage nach öffentlichen Gütern von dem Medianeinkommen, dem Steuerpreis und der Bevölkerungszahl ab.28 Es wird nun der Einfluss der Variablen Einkommen, Steuerpreis und Bevölkerungswachstum untersucht.
a) Die Einkommenselastizität der Nachfrage nach öffentlichen Leistungen
Damit das relative Anwachsen des öffentlichen Sektors statistisch erklärt werden kann, muss die Einkommenselastizität der Nachfrage nach X größer als 1 sein.29 Die Einkommenselastizität der Nachfrage liegt laut amerikanischen Schätzungen für einzelne Ausgabenkategorien zwischen 0,3 und 1,3 und für die gesamten öffentlichen Ausgaben bei 0,7 bis 0,9.30
Damit kann das relative Wachstum der Staatsausgaben nicht allein mit dem gestiegenem Einkommen erklärt werden.
b) Die Steuerpreiselastizität der Nachfrage nach öffentlichen Leistungen 31
Nach Blankart gibt es hier zwei Möglichkeiten, welche zu einem relativen Wachstum der Staatsausgaben führen: (1) c<1 und der Steuerpreis für öffentliche Güter im Vergleich zum Preis privater Güter steigt und (2) c>1 und der Steuerpreis für öffentliche Güter im Vergleich zum Preis der privaten Güter fällt. Durch empirische Studien wurde geschätzt das c<1 ist. Von der vergleichsweise unelastischen Nachfrage könnte somit in der Tat ein relatives Wachstum ausgehen, da auch wegen des geringen Produktivitätszuwachses im öffentlichen Sektor die Preise für öffentliche Güter im Vergleich zu den privaten Gütern im Laufe der Zeit gestiegen sind. Baumol (1967) hat dies in seinem Modell auch beschrieben. Aber auch hiermit kann nur ein bescheidener Teil des Staatsausgabenwachstums beschrieben werden.
c) Bevölkerungswachstum32
Das Bevölkerungswachstum würde kein Einfluss auf das Wachstum der öffentlichen Ausgaben haben, wenn der Staat nur rein öffentliche Güter bereitstellt. Es gibt keine Rivalität und es gilt das Nichtauschließbarkeitsprinzip. Allerdings gibt es auch Güter die der Staat bereitstellt, die der Gefahr der Überfüllung oder Übernutzung unterliegen. Bei wachsender Bevölkerung und konstantem Angebot verringert sich die Menge der öffentlichen Güter, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen. Dieser Nachteil wird mit wachsenden Staatsausgaben ausgeglichen.
Folgende Kritikpunkte zum Medianwählermodell werden in der Literatur genannt:
(1) Das ,,Politikmachen" wird außer acht gelassen. Die Kompetenz zur Festlegung der Staatsausgaben liegt allein bei den Stimmbürgern. Dies ist nur in einer direkten Demokratie so.33
(2) Staatliche Transferleistungen und Subventionen lassen sich mit diesem Ansatz nicht erklären.
(3) Das Modell kann nur angewendet werden, wenn allen Bürgern staatliche Leistungen gleichermaßen zu Gute kommen. Spezifische Leistungen werden aber auch nur bestimmten Gruppen zur Verfügung gestellt und der Medianwähler spielt dann keine entscheidende Rolle mehr.34
3.1.5. Kurzdarstellung weiterer Ansätze und Meinungen
Hamilton(1982)35 argumentiert über die gemeinschaftlichen Produktionsfaktoren. Er hat die These von Bradfort, Malt und Oates (1969) bezüglich der Umweltfaktoren der Gemeinschaft zu einem formalen Modell weiterentwickelt. Er sagt, dass die Bestandsgröße Medianwähler sowohl von Umwelteinsatzgütern der Gemeinschaft als auch von staatlich beschafften Einsatzgütern abhängt und zeigt, dass niedrigere Stufen an Gemeinschaftsressourcen den Steuer- Preis pro Leistungseinheit des Medianwählers erhöhen. Da die Nachfragekurven für beinah alle öffentlich zur Verfügung gestellten Güter preisunelastisch zu sein scheinen, erhöhen reduzierte Gemeinschaftsbeiträge systematisch das Niveau der staatlichen Aufwendungen, so Hamilton. Schwab und Zampelli (1985) unterstützen die Annahme, dass Unterschiede der Ressourcenniveaus der Gemeinschaften zu gemeinschaftsübergreifenden Abweichungen sowohl bei den Stückkosten der Produktion öffentlich zur Verfügung gestellten Güter als auch bei den Niveau der staatlichen Aufwendungen führen.36 Ein weiterer Ansatz ist der von North (1985a) und Breton (1989).37 Sie untersuchen staatliches Wachstum innerhalb des Kontextes der industriellen Revolution und seine Wirkungen auf die Haushaltsproduktion. Breton bemerkt, dass ein typisches traditionelles erweitertes Familiensystem in Form eines Verwandtschaftsnetzwerkes seinen Mitgliedern Obdach, Nahrung, Schutz, Sicherheit und Versicherung gibt. Ferner haben erhöhte geografische Mobilität und das Teilhaben der Frauen an der Erwerbsbevölkerung zu einem starken Anstieg der traditionellen Familienkosten bei der Bereitstellung dieser Güter geführt. Als ein Ergebnis dessen wurden traditionelle Familienfunktionen durch kostengünstigere staatliche Vorkehrungen und Vorkehrungen der freien Marktwirtschaft ersetzt. North und Breton überprüfen diese Hypothese jedoch empirisch nicht, aber beide liefern Argumente, welche ihre Behauptungen unterstützen, dass ein Großteil des Anstiegs an sozialer Sicherheit und Wohlfahtsprogrammen auf drastisch veränderte Muster der Haushaltsproduktion zurückzuführen ist.38
Ein weitere Hypothese über das Wachstum der Staatsausgaben ist von North (1984,1985a und 1985b) und North und Wallis (1982,1986)39 aufgestellt wurden. Sie argumentieren, dass der Drang der industriellen Welt zu einer größeren Spezialisierung und Arbeitsteilung zu einem Anstieg der Transaktionskosten des Marktaustausches geführt haben, was zur Folge hatte, dass der staatliche Sektor gewachsen ist. Im Gegensatz zur neoklassischen Theorie, die Transaktionskosten vernachlässigt, betonen diese Studien den Umstand, dass das Feilschen, Abwägen, Versichern und die Durchführungskosten privaten Austausches die Fähigkeit einer Wirtschaft sich zu spezialisieren hemmen und Vertreter veranlasst, kostensenkende Leistungen sowohl aus dem privaten als auch dem öffentlichem Sektor zu suchen, um die Gewinne aus dem Handel vollständig realisieren zu können. Der Beitrag des öffentlichen Sektors zur Senkung der Transaktionskosten bestand und besteht vorwiegend in der Bereitstellung spezifischer Programme, wie zum Beispiel Programme zur Entwicklung der Infrastruktur, des staatlichen Gesundheitswesens und des Rechtswesens.40 Es ist allerdings unklar, inwieweit diese staatlichen Programme primär effizienzfördernd sind oder ob es sich hier nicht eher um überwiegend redistributive Maßnahmen zugunsten spezifischer nach persönlichem Vorteil strebenden Interessengruppen handelt.41 Dieser Sachverhalt wird im nächsten Abschnitt näher untersucht.
3.2. Modelle mit ,,politischem Charakter" - Darstellung und Kritik -
Diese Modelle versuchen das Staatsausgabenwachstum mittels ,,Rent Seeking" Aktivitäten und Umverteilungsvorgänge zu Gunsten bestimmter Interessengruppen zu erklären.42 Folgende Modelle werden vorgestellt:
- Das Modell vom Meltzer und Richard
- Das Modell von Peltzman
- Der Einfluß der Interessengruppen
- Das Leviathan- Modell
- Die ,, Fiscal Illusion" Theorie
3.2.1. Das Modell von Meltzer und Richard
Melzer und Richard43 gehen davon aus, dass jede Staatstätigkeit auf Umverteilung abzielt. Die Umverteilung kommt dadurch zustande, dass der Staat eine proportionale Steuer auf das Arbeitseinkommen erhebt und dieses Steueraufkommen in Form von gleichen Pro- Kopf- Transfer an alle Stimmbürger weitergibt. Durch diese Annahme kann nun wieder das Medianwählermodell wie folgt angewendet werden. Die durch die Umverteilung profitierenden ärmeren Bürger44 können mit dem Medianstimmbürger eine Koalition eingehen, der aufgrund seiner Stellung das Maß der Umverteilung bestimmt. Der Medianbürger ist allerdings eigennützig und versucht seinen Nutzen zu maximieren. Meltzer und Richard berücksichtigen aber, dass es für die Mehrheitskoalition nicht lohnt den Steuersatz und den damit verbundenen Pro- Kopf- Transfer so hoch zu wählen, dass durch die hohe Steuerbelastung Anreize zur Einkommenserzielung gedämpft werden und damit das Gesamtprodukt und auch das Durchschnittseinkommen sinkt. Ein wesentlicher Grund für das in vielen Ländern langfristige Anwachsen der Staatstätigkeit besteht gemäß diesem Modell in der Ausweitung des Stimmrechts. Vor allem in der Nachkriegszeit ist dieses erheblich ausgeweitet wurden, und zwar einerseits im Sinne einer Formalausweitung und anderseits durch die Zunahme des Stimmrechtsgebrauchs durch die ärmeren Bevölkerungsschichten. Somit ist die Position der mehrheitsschaffenden Stimmbürger tendenziell in Richtung auf die Individuen mit niedrigeren Arbeitseinkommen verschoben wurden. Die Folge ist, dass ein höherer Steuersatz (und damit ein höherer Pro- Kopf- Transfer) als der für den Medianstimmbürger optimalen Steuersatz festgelegt wird. Denselben Effekt hätte eine Senkung des Medianeinkommens gegenüber dem Durchschnittseinkommen. Zusammenfassend läßt sich nach diesem Modell die langfristige Zunahme der Staatsausgaben auf zwei Faktoren zurückführen:
(1) die säkulare Ausweitung des Stimmrechts auf die tendenziell Ärmeren und
(2) die im Lauf der Zeit größer gewordene Einkommensungleichheit, gemessen am Auseinanderfallen von Median- und Durchschnittseinkommen.
Meltzer und Richard legen für die USA und die Periode 1937- 1977 empirische Evidenz vor, dass die zunehmende Ungleichheit in der Einkommensverteilung einen positiven Einfluss auf das relative Anwachsen der Staatsausgaben hat.45
Hendrekson und Lybeck (1988) bestätigten auch, dass die Veränderung der Einkommensverteilung einen Einfluß auf das Staatswachstum in Schweden hatte. 46 Es gibt aber auch eine Reihe von Kritikpunkten zu diesem Modell:47
- Meltzer und Richard verwenden eine Proportionalsteuer, welche in der Realität häufig nicht anzutreffen ist.
- Nach Meltzer und Richard sind allein Umverteilungsgründe von Reich zu Arm ausschlaggebend für Staatshandeln.
- Die Stimmrechtsgewährung in mitteleuropäischen Ländern ist schon seit langer Zeit abgeschlossen.
- Warum soll der Medianbürger eine Koalition mit den ,,Ärmeren" eingehen und so seine strategische Stellung verlieren.
- In fast keinem Land wird auf direkte Weise durch den Stimmbürger entschieden.
3.2.2. Das Modell von Peltzman
Ein weiteres Modell zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Einkommens-ungleichheit und Zunahme der Staatsausgaben ist von Peltzman entwickelt worden und soll hier in vereinfachter Form dargestellt werden.48 Er geht nicht vom Medianwähleransatz aus, sondern von einem repräsentativen System, in dem Politiker mit Versprechungen um Wählerstimmen werben. Dieses Versprechen beinhaltet, dass an die Gruppen und Stimmbürger umverteilt wird, welche die von dem politischen Mittelsmann arrangierte Koalition mit ihrer Stimme unterstützen. Bei linksschiefer Verteilung49 und gegebener Besetzung der Einkommensklassen wird von ,,Reich" zu ,,Arm" umverteilt. Dadurch maximieren die Politiker ihren Stimmenzuwachs, was Sie damit letztendlich auch erreichen wollen, da sie eigennützig und ,,stimmenfangend" handeln. Peltzman zeigt aber auch, dass es auf die Einkommensunterschiede innerhalb der begünstigten Gruppen ankommt. Die politischen Transaktionskosten seien geringer und die Verhandlungsmacht wäre um so größer, wenn die Mitglieder ein ähnlich großes Einkommen aufwiesen, als wenn es große Unterschiede in dem Einkommen innerhalb der Gruppenmitglieder gäbe. Die Politiker müssen demnach solche Gruppen identifizieren, deren Mitglieder wegen der geringen Einkommensunterschiede gemeinsame Interessen vertreten.
Die empirische Überprüfung dieses Modell ist recht erfolgreich. Die Analyse weit zurückreichender Daten aus England, Japan, Kanada und den USA ergeben durchaus einen signifikanten Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und Staatsausgabenwachstum. Nicht aber die größer gewordene Ungleichheit in der Einkommensverteilung selbst sei ausschlaggebend, sondern eher die Fähigkeit zur Gruppenbildung, welche zu einer immer größeren Zahl von einflussreichen Gruppen geführt hat.
Kritikpunkte zu diesem Modell sind:50
- Umverteilung ist hier wieder alleinige Triebkraft
- Die vorgebrachte Evidenz wirkt künstlich.
3.2.3. Der Einfluss von Interessengruppen
Im Abschnitt 3.2.1. und 3.2.2. wurde dargelegt, dass sich Staatstätigkeit nur auf bloßes Umverteilen zurückführen lässt und zwar von der Mehrheit zur Minderheit Downs ist da anderer Meinung. Er behauptet, dass sich kleinere Gruppen mit begrenzten Interessen besser organisieren lassen und geringere politische Kosten haben.51 Diese gut organisierten
Minderheitengruppen erzielen effekivere Renten als die großen Gruppen 52 Demsetz, und North und Wallis versuchen einen Zusammenhang zwischen der Anzahl und den Aktivitäten von den gut organisierten Interessengruppen und dem Wachstum der Staatstätigkeit herzustellen.53 Die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung hat zufolge, so Demsetz, dass mit jeder weiteren Spezialisierung eine zusätzliche Interessengruppe entsteht und sich somit auch das Potential für mehr Staatstätigkeit ausweitet. Der Einfluss dieser Interessengruppen sei um so stärker, je mehr positive Externalitäten sie aufweisen. North and Wallis argumentieren, dass zusätzliche staatliche Leistungen ,die von den Interessengruppen gefordert, die mit der Entwicklung einer arbeitsteiligen und spezialisierten Marktwirtschaft gestiegenen Transaktionskosten wieder gesenkt haben, somit der Einfluss der Interessengruppen die Staatstätikeit erhöhen läßt. Olson vertritt die Hypothese, dass eine relativ gleichmäßige wirtschaftliche Entwicklung in der Nachkriegszeit und der stabile politische Rahmen in den westlichen Demokratien den Einfluß bestehender Interessengruppen erhöht und das Entstehen von weiteren Gruppen begünstigt hat.54 Als Folge davon habe auch der Einfluss auf den öffentlichen Sektor zugenommen und ein Anwachsen der redistributiven Staatstätigkeit bewirkt. Zwei Hypothesen über Interessengruppentheorien und Staatswachstum lassen sich also formulieren:55 (1) Die ökonomische Entwicklung und die politiche Stabilität bringen immer mehr einflussreiche Interessengruppen hervor und (2) diese immer größer werdene Anzahl von Interessengruppen hat einen gewichtigen Einfluss auf die Erhöhung der Staatstätigkeit.
3.2.4. Das Leviathan- Modell
In diesem Modell wird unterstellt, dass der Staat, repräsentiert durch Politiker, den Bürger ausbeutet, weil dieser sich als Einnahmenmaximierer verhält und im eigenen Interesse handelt.56 Brennan und Buchanan sehen den Staat als Nutzenmaximierer und nicht als Wohlfahrtsmaximierer, wie er in herkömmlichen Theorien dargestellt wird.57 Nach ihrer Meinung übt der Staat Monopolmacht aus und hat einen diskretionären Spielraum, der nicht dem Wohl der Bürger dient, sondern um eigene Ziele und Interessen durchzusetzen. Dieser Ansatz geht demnach über die Maximierung des Budgets, die der Mobilisierung der Wähler dient, hinaus.58
Der Staatsapparat wird auf- und ausgebaut damit Politiker größere Macht haben, Mittel in ihre eigenen Taschen zu lenken. Durch die Zentralisierung von Regierungsfunktionen wird die Monopolmacht des Staates größer und die Macht der Wähler kleiner.59 Nelson und Zax haben zwei empirisch testbare Hypothesen aufgestellt: ,,(1) government expenditure is positively related to the degree of centralism, and (2) government expenditure is negaltively related to the degree of fragmentation".60 Tests und Studien ergaben gemischte Resultate.61
3.2.5. Die Fiscalillusion
Oates definiert die Fiskalillusion als:" a systematic misperception of fiscal parameters". 62 In dieser Theorie geht es darum, dass Bürger die Steuer- und Ausgabenbelastung nur unzureichend wahrnehmen und den Steuerpreis für öffentliche Leistungen unterschätzen.63 Nach Blankart64 gibt es den politischen Unternehmer, der diese Fiskallillusion nutzt, um Sonderinteressen zu befriedigen und somit eine Wählermehrheit erringen will. Sonderinteressen kosten aber Geld und der politische Unternehmer muss andere Wählergruppen belasten, wenn er die Wünsche der Sonderinteressengruppen befriedigen will. Er muß somit einen unmerklichen Finanzierungsweg finden damit die anderen Wähler nicht abspringen. Es stehen dazu drei Taktiken im Vordergrund:65
- Gestaltung des Steuersystems
Es muß komplex gehalten und gestaltet werden. Die Steuern müssen aus einer Vielzahl von Quellen stammen, so dass man die Gesamtheit nicht überblicken kann.66
- Wahrnehmbarkeit von Staatsleistungen
Der Politiker soll Projekte fördern, die vom Wähler besonders wahrgenommen werden.
- Wahltermineinbezug
Vor den Wahlen widmet sich der Politiker den Wählern mehr als danach. Er kann nach den Wahlen die Bedürfnisse der Sonderinteressengruppen, die ihm im Wahlkampf unterstützt haben,67 befriedigen. Missmut der Wähler spielt deswegen keine Rolle, weil bis zu den nächsten Wahlen eine gewisse Zeit vergeht und die Wähler die ,,schlechten Taten" der Politiker fast vergessen haben werden.
Es spricht demnach einiges dafür, dass die von den Politikern erzeugte Steuer- und Ausgabenillusion einen Einfluß auf die Erhöhung der Staatsausgaben hat. Jedoch ist dieses Kapitel empirisch schwer zu belegen. Gabriel68 meint, dass, wenn man eine solche Illusion auf eine systematische Weise feststellen könnte, nur Implikationen bezüglich der absoluten Ausgabenhöhe des Staates herleiten könnte.
4. Abschließende Betrachtung und Fazit
In dem vorangegangenem 3. Kapitel wurden Modelle vorgestellt, die im Zusammenhang mit nichtpolitischen und politischen Variablen erläutert wurden. Wir haben einen Eindruck gewonnen, welche Fülle von Modellen und Theorien über Staatswachstum und die damit verbundene langfristige Erhöhung der Staatsausgaben existieren. Aber keine Theorie allein ist in der Lage das Phänomen des Staatswachstums zu erklären. Nach Buchanan (1978) wäre eine vollständige Erklärung des Staatswachstums gegeben, wenn beide Modellgruppen oder ein Mix aus den Elementen der ,,apolitical" und ,,political" models." betrachtet werden.69 Aber welche Modellgruppe bietet die bessere Erklärung? Eine Methode um dies herauszufinden wäre zum Beispiel zu analysieren, welche Theorie in einer Modellgruppe besonders gut eine Erklärung für die Staatsausdehnung liefert.70 Borcherdings Analyse mit dem Medianwählermodell kann nur knapp 40% der amerikanischen Staatsausgaben von 1902-1978 erklären.71
Andere Autoren finden mehr Erklärungskraft mit diesem Modell. Congleton und Shugart (1990) testeten ein leicht verändertes Medianwählermodell und stellten dies dem Interessengruppenmodell gegenüber um zu sehen, welches besser die U.S. Ausgabenerhöhungen für soziale Sicherheit erklärt.72 Sie fanden mehr Erklärungskraft in dem Medianwählermodell.
Aber letztendlich wäre es vielleicht nicht verkehrt verschiedene Erklärungsmodelle aus den Modellgruppen zu kombinieren, wie zum Beispiel Blankart aufzeigt.73 Er kombiniert die 40%-ige Erklärungskraft des Wachstums der Staatsausgaben aus dem Medianwählermodell mit den politischen Modellen, welche vor allem durch Becker, Olson und Tullock geprägt sind und kann dadurch insgesamt mehr Erklärungskraft erzielen.
Abschließend kann man sagen, dass die gesamte Literatur einige gute Erklärungsansätze für die Ausdehnung des Staates liefert, jedoch noch weiter geforscht werden muß, um den komplexen Prozess des ,,political decision- making" in Verbindung mit der Ausdehnung des Staates vollständig erklären zu können.
[...]
1 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S.563.
2 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S. 562.
3 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S. 565.
4 In der neueren Literatur wird auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verwendet.
5 Vgl. Blankart (1991), S.120.
6 Dazu gehören insbesondere die Sozialversicherungsleistungen.
7 Vgl. Rosen, Windisch (1997), S.207-208.
8 zum Beispiel die Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
9 zum Beispiel Kreditbürgschaften.
10 Quelle: in modifizierter Form übernommen von Timm, H., Das Gesetz der wachsenden Staatsausgaben, in: Finanzarchiv, NF Bd. 21, 1961, S. 244 f. ; Finanzbericht 2000, Bonn 1999, S. 394.
11 Vgl. Wagner, zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S.576.
12 Vgl. Wagner, zitiert bei Andel, Norbert (1992), S. 186.
13 Vgl. Wagner, Adolf (1892), S.899.
14 Vgl. Wagner, Adolf (1892), S.900.
15 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S.569.
16 Vgl. Holsey, Borcherding (1997), S.569.
17 Vgl Andel, Norbert (1992), S.187.
18.Vgl Gabriel, Luciano (1983), S.40..
19 Vgl. folgende Darstellung in Gabriel, Lucino (1983), S..38-39.
20 Vgl. Baumol, zitiert bei Leineweber, Norbert (1988), S. 72.
21 Vgl. Baumol, zitiert bei Leineweber, Norbert (1988), S.72.
22 Vgl. Baumol, zitiert bei Blankart (1991), S.130.
23 Vgl. Gabriel, Luciano (1983), S.46.
24 Dazu gehören hier unter anderem Polizei, Feuerwehr, Rechtspflege und die öffentlicheVerwaltung.
25 Vgl. dazu und weitere Kritikpunkte in Gabriel, Luciano (1983), S.49-51.
26 Vgl. Pommerehne (1987), S.95 ff.
27 in modifizierter Form übernommen von Blankart (1991), S.129.
28 Vgl. Blankart (1991), S.129.
29 Vgl. Pommerehne (1987), S. 107 ff.
30 Vgl. Pommerehne (1987), S. 108 ff.
31
32 Vgl. dazu die Ausführungen in Blankart (1991), S.130-132.
33 Vgl. Blankart (1991), S.133.
34 Vgl. Gabriel (1983), S.59.
35 Vgl. Hamilton (1982), zitiert in Holsey und Borcherding (1997), S.571.
36 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S. 571.
37 Vgl. nachfolgende Hauptthesen in Holsey und Borcherding (1987), S.572.
38 Vgl. Holsey und Borcherding (1997, S.572.
39 Vgl. North, North und Wallis, zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S. 572.
40 Vgl. Pommerehne, Kirchgässner (1988), S. 231.
41 Vgl. Pommerehne, Kirchgässner (1988), S. 231.
42 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S.565, 575.
43 Vgl. folgende Ausführung in Holsey und Borcherding (1988), S.575 ff. und Pommerehne, Kirchgässner (1988), S. 215 ff.
44 insbesondere die schwarze Bevölkerung.
45 Vgl. Pommerehne, Kirchgässner (1988), S. 219.
46 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S.576.
47 Vgl. Pommerehne, Kirchgässner (1988), S.222 ff.
48 Die Modellbescheibung lehnt sich an Holsey und Borcherding (1997),S.577 und Pommerehne, Kirchgässner (1988), S.220- 222 an.
49 Das Einkommen ist so verteilt, das viele ein relativ niedriges und wenige ein relativ hohes haben.
50 Vgl. dazu und mehrere Kritikpunkte in Pommerehne, Kirchgässner (1988) S.222-224.
51 Vgl. Downs (1957), zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S. 578.
52 Vgl. Downs (1957), zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S. 578.
53 Vgl. Holsey und Borchersding (1997), S. 578.
54 Vgl Olson, zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S. 579.
55 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S. 579.
56 Vgl. Brümmerhoff (1996), S.211.
57 Vgl. Brennan und Buchanan, zitiert bei Leineweber (1988), S.178.
58 Vgl. Leineweber (1988), S.179.
59 Vgl. Holsey und Borcherding (1997), S.581.
60 zitiert bei Hosey und Borchering (1997), S.581.
61 Vgl. dazu Holsey und Borchering (1997), S.582.
62 Vgl. Oates (1988), zitiert bei Holsy und Borchering (1988), S.582.
63 Vgl. Holsey und Borchering (1997), S.582.
64 Vgl. dazu Blankart (1991), S. 140.
65 Vgl. Blankart (1991), S.140-142.
66 Siehe auch die Steuervielfalt in Deutschland.
67 Zum Beispiel durch finanzielle Unterstützungen und großzügige Spenden.
68 Vgl. Gabriel, Luciano (1983), S.117.
69 Vgl. Buchanan (1978), zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S. 588.
70 Vgl Holsey und Borcherding (1997), S.588.
71 Vgl Holsey und Borcherding (1997), S.588.
72 Vgl. Congleton und Shugart(1990), zitiert bei Holsey und Borcherding (1997), S. 589.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wachstum des Staatssektors in westlichen Industrieländern, insbesondere mit der Zunahme der Staatsausgaben und der Staatsquote.
Was ist die Staatsquote und wie wird sie definiert?
Die Staatsquote misst das Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttosozialprodukt (BSP) oder Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es gibt auch differenziertere Darstellungsweisen, wie die Unterteilung in Realausgaben- und Gesamtausgabenquote.
Welche Kritik gibt es an der Staatsquote als Messinstrument?
Die Staatsquote kann durch Messfehler in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, kurzfristige konjunkturelle Schwankungen und die Nichtberücksichtigung von Staatseingriffen durch Regulierung verzerrt werden.
Welche Modelle werden zur Erklärung des Staatswachstums vorgestellt?
Es werden Modelle ohne "politischen Einfluss" (z.B. Wagnersches Gesetz, Hypothese von Peacock und Wiseman, Baumols Modell) und Modelle mit "politischem Einfluss" (z.B. Modell von Meltzer und Richard, Modell von Peltzman, Leviathan-Modell) vorgestellt.
Was besagt das Wagnersche Gesetz wachsender Staatsausgaben?
Alfred Wagner argumentierte, dass mit zunehmender Bevölkerungsdichte und Arbeitsteilung kompliziertere Verkehrs-, Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse entstehen, was zu steigenden Staatsausgaben führt. Zudem übernimmt der Staat vermehrt Aufgaben für Kultur und Wohlfahrt.
Was ist Baumols Modell des begrenzten Produktivitätsfortschritts im Staatssektor?
Baumol erklärt das Staatswachstum mit dem geringeren Produktivitätsfortschritt im öffentlichen Sektor im Vergleich zum privaten Sektor. Da staatliche Dienstleistungen sehr arbeitsintensiv sind, steigen die Kosten im öffentlichen Sektor überproportional.
Wie erklärt das Medianwählermodell das Wachstum der Staatsausgaben?
Das Modell geht davon aus, dass die Nachfrage nach öffentlichen Gütern vom Medianeinkommen, dem Steuerpreis und der Bevölkerungszahl abhängt. Eine Einkommenselastizität der Nachfrage größer als 1, ein steigender Steuerpreis für öffentliche Güter im Vergleich zu privaten Gütern (c < 1) oder Bevölkerungswachstum können zu einem Wachstum der Staatsausgaben führen.
Was besagt das Modell von Meltzer und Richard?
Meltzer und Richard gehen davon aus, dass jede Staatstätigkeit auf Umverteilung abzielt. Die Ausweitung des Stimmrechts und eine zunehmende Einkommensungleichheit führen demnach zu höheren Staatsausgaben.
Was ist das Leviathan-Modell?
Dieses Modell unterstellt, dass der Staat (repräsentiert durch Politiker) den Bürger ausbeutet, weil er sich als Einnahmenmaximierer verhält und im eigenen Interesse handelt.
Was ist die Fiscal Illusion?
Die Fiskalillusion beschreibt eine systematische Fehlwahrnehmung der Steuer- und Ausgabenbelastung durch die Bürger, die den Steuerpreis für öffentliche Leistungen unterschätzen.
Welches Fazit wird aus der Literatur gezogen?
Keine Theorie allein kann das Phänomen des Staatswachstums vollständig erklären. Eine Kombination verschiedener Erklärungsmodelle aus den "apolitical" und "political" models kann zu einem besseren Verständnis beitragen. Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um den komplexen Prozess des "political decision-making" in Verbindung mit der Ausdehnung des Staates vollständig erklären zu können.
- Quote paper
- Christian Baumgarten (Author), 2001, Zur Entwicklung der Staatsquote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105412