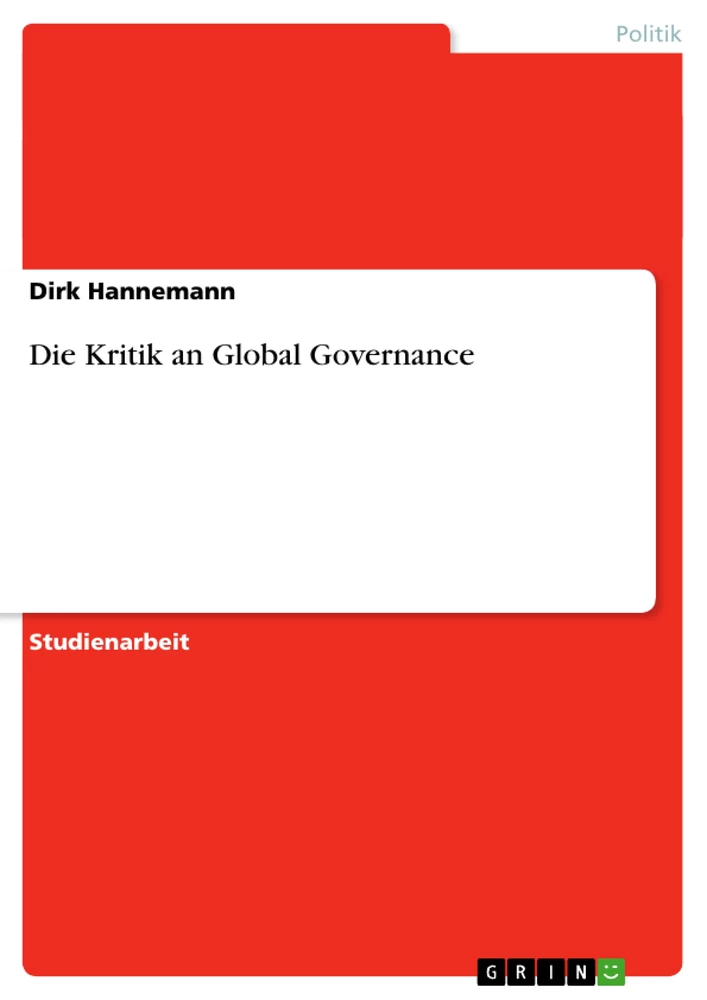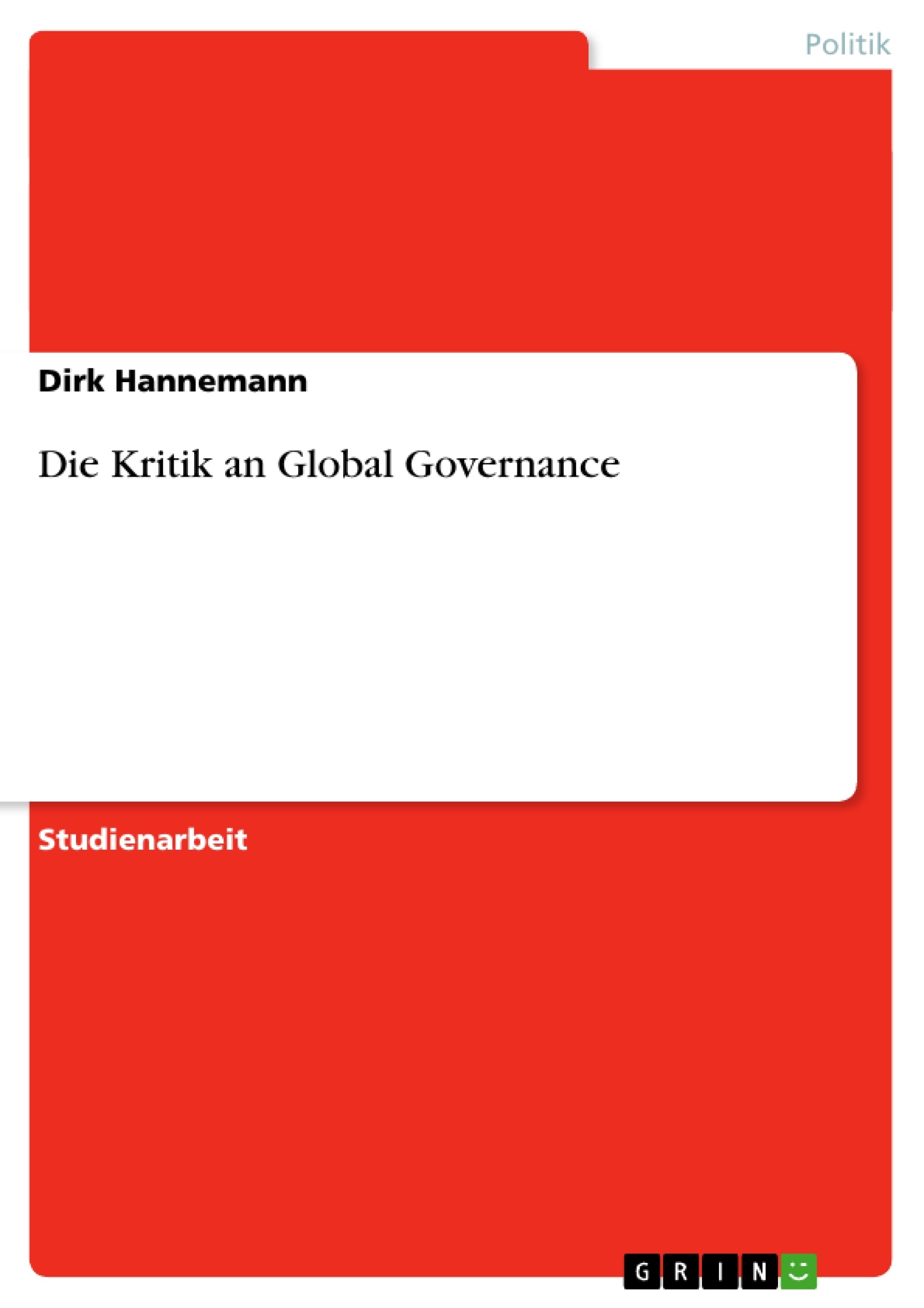Dirk Hannemann*: Die Kritik an Global Governance
Dieses Paper bezieht sich thematisch auf beide Grundlagentexte des Seminars. Zum einen auf „Globale Trends 2000“, in dem Dirk Messner und Franz Nuscheler vom Duisburger Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) Global Governance als politischen Ansatz zur Regulierung globaler Probleme vertreten (vgl. Messner 1999, Messner/Nuscheler 1999). Zum anderen - und hauptsächlich - auf die Publikation einer Autorengruppe aus dem Umfeld von Joachim Hirsch und Elmar Altvater (Brand u.a. 2000), in der sich Ulrich Brand, Achim Brunnengräber, Lutz Schrader, Christian Stock und Peter Wahl kritisch mit Global Governance- Konzepten auseinandersetzen. Neben dem bereits genannten INEF-Konzept von Messner und Nuscheler betrifft dies vor allem die Ansätze der UN-Global Commission on Governance (SEF 1995) und der Gruppe von Lissabon (1997). (Literaturhinweise in diesem Paper beziehen sich immer auf Brand u.a.[2000], soweit nicht ausdrücklich anders angegeben.)
1 Politische Standortbestimmung von Global Governance
Für die Autorengruppe Brand u.a. (2000) ist „Global Governance“ ein Sammelbegriff für Kritiker der Globalisierung, also jenem fortschreitenden Prozess der Internationalisierung von Ökonomie, Politik und Kultur, der seit Anfang der 90er Jahre im Mittelpunkt des sozialwissenschaftlichen Interesses steht. Da die Möglichkeiten für emanzipatorische Selbstverwirklichung des Menschen unter den Bedingungen der Globalisierung von der Autorengruppe sehr kritisch beurteilt werden, begrüßt sie prinzipiell Projekte wie Global Governance, die eine demokratische Regulierung dieser Prozesse anstreben.
Globalisierung wird von der Autorengruppe als Form des Neoliberalismus gedeutet, der auf marktradikalen Konzepten der Wirtschaftswissenschaft aufbaut (Friedman, Hayek) und seit den späten 1970er Jahren (Thatcher, Reagan) bis heute quer zu allen parteipolitischen Orientierungen als die herrschende Staatsdoktrin zu gelten hat (Sozialabbau, Privatisierung). In der neoliberalen Globalisierung transformieren der globale Finanzmarkt und transnationale Konzerne den in der Nachkriegszeit ausgebildeten Wohlfahrtsstaat in einen Wettbewerbsstaat. Die nationalen Standorte treten in eine globale Konkurrenz auf dem Weltmarkt für Investitionen, was die soziale Ungleichheiten noch vergrößert und die Naturzerstörung vorantreibt, auch im Rahmen des Nord-Süd- Konflikts. Mit dieser Analyse greifen die Autoren methodisch auf das begriffliche Instrumentarium der neomarxistischen Regulationstheorie zurück, die die gegenwärtige wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Krise als Übergang vom System des „Fordismus“ zu einem noch nicht genau erkennbaren, aber vom Neoliberalismus geprägten „Postfordismus“ thematisiert (57-63).
Angesichts des expliziten Ziels der Autorengruppe, geeignete Wege zum Aufbau einer gesellschaftlichen Gegenmacht zu finden (170/71), gilt Global Governance als „progressive Alternative“ (13) zum liberal-konservativen Mainstream, die auch eine Chance habe, verwirklicht zu werden: dem Modell wird nicht nur eine akademische, sondern „durchaus auch eine politische Zukunft“ (13) zugetraut.
Dass das Projekt einer globalen Demokratisierung vom Ansatz her zu begrüßen wäre und ihm konzediert wird, zu praktischer Politik anleiten zu können, bedeutet jedoch nicht, dass die Autorengruppe Brand u.a. (2000) die Modelle der Global Governance in den vorliegenden Spielarten positiv beurteilt. Getreu der o.a. Krisenanalyse in emanzipatorischer Absicht müsse sich ein Konzept daran messen lassen, wie es neoliberalen Tendenzen der Gegenwart entgegenwirke (47). Wie noch näher auszuführen sein wird, kommt die Autorengruppe jedoch zu dem Ergebnis, dass von Global Governance eher zu erwarten sei, im Sinne einer neoliberalen Modernisierung instrumentalisiert zu werden (17), als dass es eine Gegenmacht zu den Prozessen der Globalisierung organisieren könne (157).
Beschrieben nach den Kategorien der von der Autorengruppe herangezogenen Gramsci und Foucault, bestellt diese das „diskursive Feld“ (14) ihrer Auseinandersetzung mit Global Governance als Neuauflage des historischen Richtungsstreits linker Theoriebildung zwischen Revolution und Reform.
- Messner und Nuscheler geben in dieser Interpretation die Reformer ab, die in einem praxisorientierten Ansatz nach einem Konzept suchen, Sachprobleme durch politische Veränderungen innerhalb der vorhandenen Struktur zu lösen. Auch kleine Reformen in Richtung Demokratie, Soziales und Ökologie gelten bei ihnen als Schritt in die richtige Richtung und werden auch dann begrüßt, wenn die realisierten Erfolge noch nicht dem entsprechen, was für nötig gehalten wird.
- Die Autorengruppe Brand u.a. orientiert sich dagegen an einer „revolutionären“ (radikalreformerischen, 167) Perspektive. Sie bemängelt bei Messner und Nuscheler gerade die Orientierung an oberflächlichen, tagesaktuellen Problemen, weil dadurch der Blick auf die kapitalistische Struktur im Hintergrund vernachlässigt werde. Eine reformerische Perspektive lehnt die Autorengruppe ab, solange sie nur zu einer perfekter institutionalisierten Marktgesellschaft führe und somit (so die Befürchtung) an den grundlegenden Strukturdefiziten des marktentfesselten Kapitalismus nichts ändere, sondern sie verfestige.
Während die Autorengruppe Brand u.a. also in undogmatischer Tradition eines um die gramscianische Hegemonietheorie erweiterten Marx (vgl. auch Scherrer 2000) die gesellschaftsverändernde Perspektive stark macht, wird der Ansatz von Messner und Nuscheler als „sozialdemokratisch“ klassifiziert. Dieses Etikett darf dabei nicht platt als parteipolitische Zuordnung verstanden werden (auch wenn das INEF als think tank der SPD für Fragen der Entwicklungspolitik gilt). Global Governance in der von Messner und Nuscheler präsentierten Variante greift nach Einschätzung der Autorengruppe eher Themen von Bündnis 90 / Die Grünen auf, hat aber auch Anknüpfungspunkte zum linken SPD-Flügel, der über die Person Heidemarie Wieczorek-Zeuls als Bundesministerin für Entwicklung und Zusammenarbeit sogar Eingang in die Regierungsarbeit findet, oder zur Süßmuth- / Geißler-Fraktion innerhalb der CDU (38).
In einer Erwiderung auf einen Artikel von Brunnengräber / Stock (1999), der die o.a. Thesen in komprimierter Form vorträgt, interpretiert der kritisierte Franz Nuscheler (2000) die Rezeption durch die Autorengruppe als den „krampfhafte(n) Versuch (...), Büttel des Systems zu entlarven und ein Feindbild aufzubauen.“ (ebd., 152). Eine reformerische Perspektive will Nuscheler gar nicht abstreiten, er empört sich aber über eine Darstellung des INEF-Modells von Global Governance als „revisionistische und sozialdemokratische Fehlgeburt“ (ebd., 153). Die Kritik sei ein Rückfall in Untugenden der ideologischen Rechthaberei, die einen fruchtbaren Diskurs verhindere.
2 Die drei Varianten von Global Governance
Die Autorengruppe Brand u.a. (2000) unterscheidet Global Governance in drei Varianten (21/22):
- empirisch-analytisch
- emphatisch
- politisch-strategisch
Die empirisch-analytische Verwendung des Terminus’ Global Governance wie bei James Rosenau (28-30) ist vor allem daran orientiert, ein begriffliches Instrumentarium zu bilden, dass der Realitätsbeschreibung für die Politikformen jenseits des Nationalstaates besser gerecht wird als bisherige Ansätze. Rosenau ist daran interessiert, mit dem Begriff Governance Konstellationen wissenschaftlich zu beschreiben, in denen ohne Rückgriff auf hierarchische Steuerungsmittel („Government“) politische Regulierungen ermöglicht werden (30). Bei dieser Variante sieht die Autorengruppe bei einer bloßen Beschreibung neuer Strukturen und Prozesse die Gefahr, dass bestehende Verhältnisse durch Verzicht auf politische Kritik positivistisch festgeschrieben werden (21).
Die emphatische Variante von Global Governance setzt sich zum Ziel, durch ein Leitbild Orientierungshilfen für die politische Gestaltung einer neuen Realität anzubieten (21f.). Als ein solches Konzept gilt der Autorengruppe der Ansatz der Gruppe von Lissabon (38-40), das - übrigens ohne expliziten Rekurs auf den Begriff „Global Governance“ - die führenden Wirtschaftsmächte dazu bewegen möchte, sich der globalen Krise anzunehmen. Akteure der globalen Zivilgesellschaft, aufgeklärte Eliten der Machtzentralen und die Städte sollen Druck auf die Regierungen ausüben, damit weltweit ein Vertrag mit insgesamt vier Abkommen abgeschlossen wird, der (1) die Grundversorgung aller Menschen sichert, (2) den Dialog zwischen den Kulturen fördert, (3) eine globale Steuerung unter Einschluss einer globalen Bürgerversammlung ermöglicht und (4) ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht. Die emphatische Variante stellt die Ethik in den Vordergrund, wodurch es nach Ansicht der Autorengruppe bei diesen Ansatz an konkreten Umsetzungsmechanismen fehlt.
Messner und Nuscheler repräsentieren für die Autorengruppe die dritte, nämlich die politisch-strategische Variante von Global Governance (34-38, „INEF- Konzept“). Diese Version ist handlungs- und problemorientiert und bietet operationalisierbare Kriterien, die es dafür prädestinieren, politische Praxis anzuleiten. Ihr Entstehen müsse im Zusammenhang mit der Erneuerung der Sozialdemokratie gesehen werden, die seit Mitte der 90er Jahre wieder verstärkt in der Regierungsverantwortung steht und nach Konzepten zur politischen Regulierung der Globalisierung suche (22). Messner und Nuscheler betonen, dass Politik dringend auch auf einer globalen Ebene stattfinden müsse, was eine Global Governance-Architektur erfordere. Diese besteht aus sechs Ebenen: Nationalstaaten, internationalen Regimen, regionalen Integrationsprojekten wie der EU, UN-Organisationen, der Zivilgesellschaft und der lokalen Politik (Messner/Nuscheler 1997, 345ff., nach Brand u.a. 2000, 35). Der Nationalstaat bleibt in dieser Architektur aber die entscheidende Instanz (Messner 1998, 22). Der Staat gibt traditionelle Aufgaben ab und stärkt seine moderierende Rolle als Integrationsinstanz, der zentrifugalen Kräften entgegenwirkt, und als globaler „Interdependenzmanager“. Die Europäische Union sei für diese Rolle das geeignete Übungsfeld, bei dem sich auch die Probleme von Bürokratisierung, Legitimationsdefiziten, Koordinationsprobleme und der Dominanz von Hegemonen zeigten (36). Messners Ansatz sei nach der Ansicht der Autorengruppe dabei staatszentrierter angelegt als derjenige Nuschelers (37).
Bei den von der Autorengruppe vorgestellten Konzepten von Global Governance (bei dem hier allerdings die ebenfalls emphatische Version der UN-Commission on Global Governance [30-34] ausgespart wurde), werden die Gemeinsamkeiten der Ansätze von Brand u.a. als relativ groß eingeschätzt (40-42).
- Ähnlicher analytischer Zugang zu den Weltproblemen: erstens Einigkeit darüber, dass die ökonomische Globalisierung die nationalen Formen politischer Regulierung überfordert, und zweitens das Bekenntnis zum Markt, auf dessen Selbstheilungskräfte des Marktes allerdings zu sehr vertraut wurde, und der nun global eingebettet werden soll.
- Erweiterter akteursbezogener Blickwinkel: Der Nationalstaat bleibt der wichtigste Akteur, bezieht aber stärker die obere und untere Ebene ein. Private Akteure wie NRO’s und Konzerne werden aufgewertet.
- Art der vorgeschlagenen Aktivitäten und Prozesse: Regulierung wird vor allem von Regimen erwartet, die sich auf ein Thema konzentrieren. Mit sachgerechten Lösungen werden „Win-win“-Situationen geschaffen
- Begründung mit einem globalen Ethos: Die Verwirklichung von Menschenrechten ist die Legitimationsbasis für alle Konzepte
- Gegenposition zu Huntington: Wenn auch nicht explizit ausgeführt, so sind alle Konzepte als eine Kritik an der These eines Zusammenpralls der Kulturen anzusehen, das nach Huntington das neue globale Konfliktmuster bilde (differenzierte Diskussion bei Krell 2000, 22-24)
Die Gemeinsamkeiten der Global Governance-Modelle werden von der Autorengruppe als wesentlich größer eingeschätzt als ihre Unterschiede. Differenzen zwischen den Modellen würden sich vor allem hinsichtlich der als Träger der Bewegung vorgesehenen Akteure ergeben. In einigen Theorien wird dem Staat die wichtigste Rolle zuerkannt, in anderen gelten die politischen Subjekte in der Zivilgesellschaft als ausschlaggebend (42).
3 Kritik an Global Governance
In Kapitel 5 und schon in der Einleitung (17/18) expliziert die Autorengruppe ihre Kritik an Global Governance, die sich in zwei Punkten zusammenfassen lässt:
1. Die Problemanalyse - bleibt an der Oberfläche und zeichnet ein harmonisierendes Bild von der Welt, das die in Machtstrukturen manifestierten Ungleichgewichte verkennt, was u.a. auch die Geschlechterverhältnisse betrifft
2. Die Problemlösungsstrategie - setzt in einer „etatistischen Illusion“ beim Staat an, der fälschlicherweise als Gegenspieler zur ökonomischen Kräften betrachtet wird, überschätzt aber auch die Möglichkeiten von transnationalen Netzwerken der Zivilgesellschaft, insbesondere der Nichtregierungsorganisationen (NRO’s). Der technokratische Ansatz sei dabei vor allem an verstärkter Problemlösungseffizienz interessiert, wobei demokratische Aspekte als vernachlässigbar gelten.
Die Kritik müsse sich noch mit der Theorie von Global Governance begnügen, da eine „direkte Umsetzung in staatliche und politische Programmatik sowie in kohärente Reformpolitik“ (43) bislang ausgeblieben ist. Dies kann man darauf zurückführen, dass der Ansatz noch relativ jung ist. Es finden sich aber auch konzeptionelle Unstimmigkeiten, wenn z.B. Ausblicke in die Zukunft des Staates, die „in weiten Teilen utopischen Charakter“ aufweisen, auf problematische Weise mit konkreten Handlungsempfehlungen vermengt werden (43).
Auch wenn die Autorengruppe dem Argument Messners zustimmt, dass Visionen reale Macht entfalten und somit Realität gestalten können, so sieht sie jedoch das der Global Governance-Konzeption zugrundeliegende Ethos der Einen Welt und einen bloßen Appell an die Vernunft als zu schwache Basis für ein politisches Konzept an: „Der normative Gehalt von Global Governance, insbesondere die Proklamation der ‚Einen Welt’ und der ‚Weltethik’, wird sich in absehbarer Zeit ... nicht in die Realität umsetzen lassen. Er bleibt die Vision einer Gesellschaft, in der alle Antagonismen durch freiwillige Einsicht und durch Verhandlungsprozesse unter Aufsicht des Staates bzw. der ‚Staatengemeinschaft’ zu allseitiger Zufriedenheit aufgelöst werden können.“ (43)
Die Kritik der Autorengruppe an Global Governance kann man folgendermaßen zusammenfassen (vgl. 129-57): Weil die Analyse der globalen Probleme an der Oberfläche bleibt und eine Auseinandersetzung mit realen Herrschaftsstrukturen scheut, muss der Lösungsansatz von Global Governance notwendigerweise verkürzt sein. Aus der sich daraus ergebenden Fixierung auf Institutionen des Staats ist es nur logisch, dass Global Governance auf eine Kooperation mit den Machtzentralen in Politik und Wirtschaft setzt, die jedoch bisher gerade als die entschiedenen Gegner dieser Reformen aufgetreten sind. Ein solch kompromisslerischer, etatistischer Ansatz kann nur auf die Einsicht in das bessere Argument hoffen und hat deshalb nach aller Erfahrung so gut wie keine Chance, seine Ziele durchzusetzen. Wohl aber besteht aufgrund der Durchsetzungsschwäche der Modell in Verbindung mit ihrer unbestrittenen Innovationskraft eine große Gefahr, dass bestehende Akteure der Weltpolitik Global Governance für ihre Zwecke adaptieren und sie damit den Ansatz auch noch seines letzten Rests kritischen Inhalts berauben.
Der Konflikt mit ökonomischen und politischen Interessen ist nach Ansicht der Autorengruppe bei einem demokratischen, sozialen und ökologischen Programm ohnehin vorprogrammiert und müsse aus diesem Grund auch schon in der Theorie antizipiert sein. Global Governance wird unterstellt, aus Gründen des Politik-Marketing auf Schmusekurs mit den Herrschenden zu gehen: „Man hofft auf breitere Zustimmung, wenn auf die Benennung von Konflikten und die Kritik an ihren Verursachern verzichtet wird.“ (129) Mit Kooperation statt Konfrontation begeben sich aber die Vertreter von Global Governance nach Ansicht der Autorengruppe in die Umarmung von Interessenvertretern, die über wesentlich mehr Durchsetzungskraft verfügen und niemals freiwillig auf Einfluss und Rendite verzichten werden. So besteht die Gefahr, dass das Herrschaftsprojekt des Neoliberalismus Global Governance in sein hegemoniales Konzept marktförmiger, effizienzorientierter und auch sonst zu Kapitalinteressen konformer Politik integriert. Idealistische und voluntaristische Modelle (157) wie Global Governance stärkten das bestehende ungerechte System durch seine wissenschaftlichen Innovationen am Ende noch, statt es zu transformieren.
Franz Nuscheler (2000) lässt in seiner Erwiderung den Vorwurf eines deskriptiven, theorielosen Konstrukts nicht gelten. „Ableitungsakrobatik“ nach Art der Regulationstheorie sei jedoch nicht sein Fall (Nuscheler 2000, 151). Sein Ansatz - und der der anderen „globalen Gouvernante“ Dirk Messner - sei handlungstheoretisch und wolle daran gemessen werden, ob er Probleme löse. In diesem Sinne halte er Politikberatung, „im Gegensatz zu unseren Kritikern“, für kein unanständiges Geschäft (ebd., 153). Sich in den akademischen Schreibstuben zu verstecken und mit intellektuellen Scharmützeln zu bekriegen, führe in die „politische Irrelevanz“ (ebd.). Während er eine „Demokratielücke“ unumwunden zugibt und auch mit einer Output-Legitimation nicht für gelöst hält (ebd., 154), so fällt die Verteidigung gegen die Kritik an mangelnder Konfliktfreude mau aus: Kooperation von Staaten sei nie konfliktfrei (ebd., 153).
4 Fazit zu Kritik und Gegenkritik
Brand u.a. (2000) beobachten mit ihrer geballten Kompetenz zu Staats-, Demokratie- und Kapitalismustheorie einerseits, sowie Entwicklungs-, Ökologie- und Gender-Problematik andererseits den Prozess der Globalisierung mit Argusaugen. Sie halten an kritischer Sozialwissenschaft in der undogmatischen Nachfolge von Marx fest, was in den heutigen konservativen Zeiten sehr zu begrüßen ist, und können in der vorliegenden Publikation verdeutlichen, zu welchen Fragen eine emanzipatorische Theorie Antworten bieten muss. Der didaktisch hervorragende Aufbau und die schlanke, pointierte Argumentation macht die Arbeit der Autorengruppe nicht nur zu einer sehr guten Einführung in den Ansatz der Global Governance (soweit man das beurteilen kann, wenn einem nicht alle besprochenen Ansätze auch im Original vorliegen), sondern geradezu zu einem methodischen Leitfaden für kritische Theorie im Allgemeinen.
Angesichts der fundierten und sachlich gehaltenen Argumentation in Brand u.a. (2000) mag die harsche Replik von Franz Nuscheler (2000) überraschen. Doch ohne damit der Kritik an Global Governance ihre Berechtigung abzusprechen, ist Nuscheler gut zu verstehen. Die Autorengruppe hat nämlich eines nicht beachtet: dass es wissenschaftlicher Redlichkeit entspricht, den INEF-Ansatz von Messner und Nuscheler erst einmal nach seinen eigenen Kriterien zu messen und ihn als solchen zu würdigen (und ihn kritisch zu vergleichen mit dem, was man selbst zu diesem Punkt anzubieten hat). Statt dessen stülpen Brand u.a. dem Global Governance-Konzept ihren eigenen Ansatz über und wundern sich, dass es ihm nicht gerecht wird. Es muss von der Kritik zunächst einmal anerkannt werden, dass Messner und Nuscheler sich für einen handlungsorientierten Ansatz entschieden haben und sich - in all seinen problematischen Konnotationen - „gutes Regieren“ zum Ziel setzen, und zwar weltweit. Dieser Ansatz trägt nicht über den Kapitalismus hinaus, soweit ist Brand u.a. zuzustimmen. Verwirklichte Global Governance unter heutigen Bedingungen wäre jedoch ein großer Fortschritt und ist deshalb völlig legitim (so nach eigener Erfahrung ein häufiges Argument bei Wolf-Dieter Narr zu angeblich anspruchslosen Theorien).
Natürlich müsste sich eine Strategie von Messner und Nuscheler in regelmäßigen Abständen selbstkritisch fragen, ob sie ihrem selbstgesetzten Ziel näher kommt und ob Aufwand und Erfolg in einem angemessenen Verhältnis stehen, wie bei jeder anderen Strategie auch. Wie die Autorengruppe aber selbst betont, ist die Vision der Global Governance noch recht neu (43). Es ist also keineswegs auszuschließen, dass gerade Messner und Nuscheler das Leitbild formulieren, das Machtstrukturen aufweichen kann, wie es emanzipative Bewegungen noch nicht zu bieten hatten (vgl. Verweise auf Held, Narr, Habermas, 168). Brunkhorst (1998) befürwortet diesbezüglich in pragmatischer Absicht einen „Demokratischen Experimentalismus“ nach John Dewey.
Vielleicht wird es sich erweisen, dass der Erfolg von Global Governance gerade darin liegt, dass auf esoterische Begriffe sozialwissenschaftlicher Theoriebildung weitestgehend verzichtet wurde, was theoretische Reflexion ja nicht ausschließt. Um ein handlungstheoretisches Konzept wie Global Governance zu bewerten, gibt es keine Alternative als den Test in der Praxis („Was zählt ist auf’m Platz“, weiß man in Duisburg). Die überkritische Haltung von Brand u.a. muss in Vergleich zu den eigenen vagen Vorschlägen gesehen werden, die nicht einmal konfliktfähig sind. Das für eigene Ideen vorgesehene Kapitel 6 bietet nichts Konkretes, abgesehen von einer lohnenswerten Perspektive, den Politikbegriff zu öffnen und Konsum stärker in politische Strategien einzubeziehen (171, 176). Zum x-ten Mal definieren Brand u.a. in diesem Kapitel wieder nur Anforderungen, die eine praxistaugliche Theorie zu erfüllen habe, aber nicht die Theorie.
Phantasielosigkeit und der fehlende Mut, sich auch einmal festzulegen, versucht die Autorengruppe dabei noch als wertvollen Erkenntnisfortschritt zu verkaufen: „(...) werden wir aber unsererseits nicht in den Fehler verfallen, ein Alternativprogramm aus den sieben Säulen der emanzipativen Weisheit am Reißbrett zu entwerfen.“ (158, vgl. 164f.) Forderungen nach Praxisrelevanz seitens der NROs werden verhöhnt (164). Wie Kennern der Marxschen Theorie ja eigentlich nicht gesagt werden müsste, hat die Kraft emanzipatorischer Bewegungen immer auch darin bestanden, eine Vision zu entfalten.
Brand u.a. argumentieren in ihrer Kritik auf eine Art, die - so meine zentrale These - sich nicht wirklich auf die besprochenen Ansätze einlässt, und misst andere Theorien an Anforderungen, die sie selbst nicht einlösen können. Die Schule der Regulationstheorie bzw. ihre staatstheoretische Ausarbeitung Frankfurter Provenienz (einschließlich ihrer Berliner Rezeption) scheint, wie von Nuscheler angedeutet, vor allem daraufhin angelegt zu sein, den linken Elfenbeinturm zu erhalten, gegen den man sich angeblich wendet (165). Kenner politischer Theoriebildung wissen übrigens, dass solche Bekenntnisse, wie auch z.B. die Absage an einer Orientierung an den 70er Jahren, als sicherer Hinweis zu werten ist, dass genau das vorliegt, wogegen man sich nominal wehrt.
Ganz typisch für die Argumentation der Kritiker ist, dass Global Governance abgewatscht wird, weil es auf die Einsicht in Vernunft setzt und den Staat als Akteur nicht aufgeben will, um politische Ziele umzusetzen. Messner wird aus diesen Gründen eines „sozialdemokratischen Etatismus“ (185) geziehen. Geht es der Gruppe um eigene Perspektiven, heißt es jedoch: „Nicht ausgeblendet werden sollte, dass es auch in herrschenden Institutionen Menschen gibt, die kritisch denken und handeln, um diese Widersprüche zu nutzen.“ (171), oder: „Das bedeutet natürlich nicht, Staaten aus der Verantwortung für einmal erkämpfte progressive Politiken, etwa im Bildungs- und Sozialbereich, zu entlassen.“ (160) Hier fehlt offenbar der sichere Maßstab der Beurteilung, was wohl als Versäumnis der eigenen Theoriebildung gesehen werden muss. Es ist vielsagend, dass Bekenntnisse dieser Art in den Fußnoten versteckt werden.
Die Autorengruppe kritisiert einen „juristischen Staatsbegriff“ bei Global Governance (142, 167f.), weil er sich an existierenden Institutionen des Staatsapparates orientiert. Sie selbst als herrschaftskritischer Ansatz dagegen heben bei der Beschreibung von Staatlichkeit auf den Souveränitätsbegriff ab, der im Absolutismus von Bodin und Hobbes geprägt wurde [in einer Diplomarbeit in Frankfurt auf diesem Kritikpunkt zu beharren, führt nach eigener Erfahrung zur Abwertung der Arbeit um eine Note]. Die Regulationstheoretiker tragen das bekannte Problem emanzipatorischer Praxis weiter, wie der Staat zu bewerten sei: Marx wollte ihn bekanntlich abschaffen, indem er ihn (übergangsweise) der Diktatur des Proletariats unterwerfen wollte - eine sehr dialektische Argumentation. Bei Joachim Hirsch (1995), in Rückgriff auf Nicos Poulantzas, wird die Frage nach dem Staat mit der Annahme einer „relativen Autonomie“ dementsprechend unentschieden entschieden. Dieses Problem theoretisch nicht gelöst zu haben, ist bei Brand u.a. verzeihlich. Aber diesen Makel (wie auch die orthodoxe Nationalstaatsposition [75, 169], die der realistischen Schule der Internationalen Beziehungen alle Ehre macht), nicht anzuerkennen, sondern mit Phrasen bezüglich des Raumverhältnisses zu überdecken (51), ist allerdings ein schweres Versäumnis. Mangelnde Selbstkritik ist die eine Seite der Medaille, fehlende Offenheit gegenüber anderen Ansätzen die andere. Diese zeigt sich vor allem in der Haltung gegenüber der Weltsystemtheorie nach Wallerstein, die zur Regulationstheorie viele Anschlusspunkte aufweist (Synthese bei Ziltener 1999), aber trotz guter Vorarbeiten zum globalen System konsequent ignoriert wird.
Brand u.a. zeichnen sich also in der Einschätzung ihres eigenen Ansatz als sehr unkritisch aus, was sich auch ausdrückt, dass Hinweise auf die mageren Ergebnisse bei ihren Mentoren Joachim Hirsch und Elmar Altvater völlig fehlen. Hirsch (1995) etwa verdammt den Nationalstaat als gewalttätige Form des Kapitalismus, um ihn am Ende doch als das geeignete Terrain politischer Kämpfe zu identifizieren. Mit welchem Ziel, bitteschön - den Nationalstaat in seiner „Souveränität“ zu festigen? Den so oft angeführten Altvater / Mahnkopf (1999) fällt nach über 500 Seiten Analyse zur Globalisierung nicht mehr ein, als Steuern auf Spekulationsgewinne und erhöhte Energieabgaben zu befürworten (Tobin-Tax; ebd., 527ff.). Die Kritik an den Global Governance-Modellen muss also auch vor dem Hintergrund fehlender Alternativen bei den Großtheoretikern betrachtet werden. Mit diesem imposanten Katalog an Versäumnissen kanzeln Brand u.a. Ansätze ab, die mit einem anderen - risikofreudigeren - Ansatz versuchen, über reflexive Praxis zu besseren Ergebnissen zu kommen (wobei ich nur Messner und Nuscheler als wissenschaftliches Konzept sehe, nicht die Kommissionen). Diese Haltung ist politisch und wissenschaftlich bedenklich und hat eine persönliche Dimension, gegen die sich Nuscheler zu Recht wehrt. Die Autorengruppe benutzt ihre redundanten Hinweise auf die „widersprüchliche“, „komplexe“ Realität (162) als Vorwand, um diese Widersprüche in ihrer Theorie abzubilden, statt sie zu bewältigen oder auch nur transparent zu machen.
Dies schmälert nicht die Ordnungsleistung der Autorengruppe bezüglich des Global Governance-Ansatzes und verneint nicht die Richtung ihrer Kritik - sie leisten eine nötige Arbeit in einem „Suchprozess“, wie Brand u.a. auch selbst betonen, die vielleicht in Zukunft dazu führen wird, sich stärker vom (eigentlich schon überwundenen) Nationalstaat zu lösen. Es war mein Ziel, mit einer Kritik an der Autorengruppe die allzu selbstgewisse Argumentation von Brand u.a. zu relativieren und zu mehr Offenheit anzuregen. Es wäre im Sinne der anstehenden Probleme zu bedauern, wenn die linke Arbeitsteilung zwischen sozialdemokratischen Machern als „Bütteln des Systems“ - niemand kann die historisch zwiespältige Rolle der Sozialdemokratie leugnen, die eine solche Bezeichnung zumindest verständlich macht (vgl. Narr 1999) - und den besserwisserischen Geistesaristokraten im Elfenbeinturm bestehen bliebe.
5 Eigener Ausblick
Wie vom Seminarleiter für jedes Paper gewünscht, gebe ich zum Abschluss meine eigenen Vorstellungen zur Zukunft der Staatlichkeit zum besten. Meiner Meinung nach orientiert sich gerade die kritische Politikwissenschaft zu stark am Nationalstaat, wie auch gerade wieder bei der Regulationstheorie angemerkt. Es wäre lohnenswert, mit mehr wissenschaftlichem Ernst über die Chancen eines demokratischen Weltstaates nachzudenken, der die Nation als Ordnungsprinzip überwindet, anstatt ihn voreilig zu dämonisieren (stereotyp „nicht möglich und nicht wünschenswert“, „despotisch“). Denn wegen der grausamen Geschichte und Gegenwart der Nationalstaaten mit Gewalt nach innen (kulturelle Homogenisierung, Ausbeutung durch Eliten) und außen (Krieg, Imperialismus, Rassismus gegen Migranten) kann sich eine kritische Wissenschaft meiner Meinung nach nicht positiv auf die Nation beziehen. Die national geprägte Staatenwelt ist im Kern auf einen Chauvinismus gegen alles Fremde aufgebaut, der bis zu einem gewissen Grad zu zähmen, aber nicht zu reformieren ist. Als Alternative halte ich das Modell eines demokratischen Weltstaates für (neu) bedenkenswert, welcher die Nationalstaaten auflöst und diese durch ein nach rationalen Kriterien gebildetes, basisdemokratisches Stufensystem ersetzt. Totalitäre Allmachtsphantasien (auch im Dienste guter Ziele wie Ökologie oder Gerechtigkeit für die Dritte Welt), die der Idee des Weltstaats zu Recht starke Ablehnung eingebracht haben, müssen und können vermieden werden.
Literatur
Altvater, Elmar / Birgit Mahnkopf (1999): Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. 4., völlig überarbeitete Auflage, Münster
Brand, Ulrich / Achim Brunnengräber / Lutz Schrader / Christian Stock / Peter Wahl (1999): Global Governance. Alternative zur neoliberalen Globalisierung?, Münster
Brunkhorst, Hauke (1998): Demokratischer Experimentalismus. Politik in der komplexen Gesellschaft, Frankfurt/M
Brunnengräber, Achim / Christian Stock (1999): „Global Governance: Ein neues Jahrhundertprojekt?“, S.445-468 in: PROKLA Nr. 116, 29. Jg., Nr. 3/1999
Gruppe von Lissabon (1997):Grenzen des Wettbewerbs. Die Globalisierung der Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit, München
Hauchler, Ingomar / Dirk Messner / Franz Nuscheler (Hg.) (1999): Globale Trends 2000, Frankfurt/M
Hauchler, Ingomar / Dirk Messner / Franz Nuscheler (2001): „Global Governance: Notwendigkeit, Bedingungen, Barrieren“, S. 11-37 in: dies. (Hg.) (2001): Globale Trends 2002, Frankfurt/M [neu erschienen und nicht im Text zitiert: sehr gute Darstellung von Global Governace vor dem Hintergrund einer Weltstaatsperspektive]
Hirsch, Joachim (1995): Der nationale Wettbewerbsstaat, Amsterdam/Berlin
Krell, Gert (2000): Weltbilder und Weltordnung. Einführung in die Theorie der Internationalen Beziehungen, Baden-Baden
Messner, Dirk (1999): „Weltgesellschaft - Realität oder Phantom?“, S. 45-75 in: Hauchler u.a. 1999
Messner, Dirk (1998): „Die Transformation von Staat und Politik im Globalisierungsprozess“, S. 14-43 in: ders. (Hg.): Die Zukunft des Staates und der Politik. Möglichkeiten und Grenzen der politischen Steuerung in der Weltgesellschaft, Bonn
Messner, Dirk (2000): „Ist Außenpolitik noch Außenpolitik... und was ist eigentlich Innenpolitik? Die Transformation der Politik in der ‚Ära des Globalismus’“, S. 123-50 in: PROKLA Nr. 118, 30. Jg., Nr. 1/2000
Messner, Dirk / Franz Nuscheler (1996): „Global Governance. Organisationselemente und Säulen einer Weltordnungspolitik“, S.12-36 in: dies. (Hg.): Weltkonferenzen und Weltberichte. Ein Wegweiser durch die internationale Diskussion, Bonn
Messner, Dirk / Franz Nuscheler (1997): „Global Governance. Herausforderung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert“, S.337-61 in: Dieter Senghaas (Hg.): Frieden machen, Frankfurt/M
Messner, Dirk / Franz Nuscheler (1999): „Strukturen und Trends der Weltpolitik: Neue Turbulenzen und anarchische Tendenzen“, S. 371-398 in: Hauchler u.a. 1999
Narr, Wolf-Dieter (1999): „Gegenwart und Zukunft einer Illusion. ‚Rot-Grün’ und die Möglichkeiten gegenwärtiger Politik“, S. 351-76, in: PROKLA Nr. 116, 29. Jg., Nr. 3/1999
Nuscheler, Franz (2000): „Kritik der Kritik am Global Governance-Konzept“, S. 151-56 in: PROKLA Nr. 118, 30. Jg., Nr. 1/2000
Rittberger, Volker (2000): „Globalisierung und der Wandel der Staatenwelt. Die Welt regieren ohne Weltstaat“, S. 188-218 in: Ulrich Menzel (Hg.): Vom Ewigen Frieden und vom Wohlstand der Nationen. Festschrift für Dieter Senghaas, Frankfurt/Main [nicht im Text zitiert: sehr gute Auseinandersetzung mit Weltstaatsideen aus Sicht der Lehre der Internationalen Beziehungen von einem ihrer führenden Vertreter in Deutschland]
Scherrer, Christoph (2000): „Global Governance: Vom fordistischen Trilateralismus zum neoliberalen Konstitutionalismus“, S. 13-38 in: PROKLA Nr. 118, 30. Jg., Nr. 1/2000
SEF (Stiftung Entwicklung und Frieden, Hg.) (1995): Nachbarn in Einer Welt. Der Bericht der Kommission für Weltordnungspolitik. The Commission on Global Governance, Bonn, Original: Commission on Global Governance: Our Global Neighbourhood, Oxford 1995
Yunker, James A. (1999): „A Pragmatic Route to Genuine Global Governance“, S. 139-60 in: Errol E. Harris and James A. Yunker (eds.): Toward Genuine Global Governance: Critical Reactions to ‘Our Global Neighborhood’, Westport, Conn. [nicht zitiert: Beispiel für Kritik von Global Governance aus Sicht der Weltföderalisten]
Yunker, James A. (2000): „Rethinking World Government: A new approach“, S. 3-33 in: International Journal on World Peace, Vol. XVII, No. 1, March 2000 [nicht zitiert: Beispiel für einen ernstzunehmender Ansatz von Weltstaatlichkeit]
Ziltener, Patrick (1999): Strukturwandel der europäischen Integration. Die Europäische Union und die Veränderung von Staatlichkeit, Münster
[...]
Häufig gestellte Fragen zu Dirk Hannemanns "Die Kritik an Global Governance"
Worum geht es in Dirk Hannemanns "Die Kritik an Global Governance"?
Das Paper analysiert und kritisiert das Konzept der Global Governance, insbesondere im Kontext der Globalisierung und des Neoliberalismus. Es vergleicht verschiedene Ansätze von Global Governance und bewertet deren Eignung zur Regulierung globaler Probleme.
Welche politischen Standpunkte werden in Bezug auf Global Governance beleuchtet?
Das Paper unterscheidet zwischen einer reformerischen Perspektive (vertreten durch Messner und Nuscheler) und einer radikalreformerischen bzw. "revolutionären" Perspektive (vertreten durch Brand u.a.). Es wird argumentiert, dass Global Governance als "progressive Alternative" zum liberal-konservativen Mainstream betrachtet werden kann, aber auch Gefahr läuft, im Sinne einer neoliberalen Modernisierung instrumentalisiert zu werden.
Welche drei Varianten von Global Governance werden unterschieden?
Das Paper unterscheidet drei Varianten: empirisch-analytisch, emphatisch und politisch-strategisch. Jede Variante wird kurz erläutert und anhand von Beispielen (Rosenau, Gruppe von Lissabon, INEF-Konzept) veranschaulicht.
Welche Kritik wird an Global Governance geübt?
Die Kritik lässt sich in zwei Hauptpunkte zusammenfassen: Erstens, die Problemanalyse bleibt an der Oberfläche und verkennt die in Machtstrukturen manifestierten Ungleichgewichte. Zweitens, die Problemlösungsstrategie setzt auf den Staat als Gegenspieler ökonomischer Kräfte und überschätzt die Möglichkeiten transnationaler Netzwerke.
Wie reagiert Franz Nuscheler auf die Kritik?
Nuscheler weist den Vorwurf eines theorielosen Konstrukts zurück und betont den handlungstheoretischen Ansatz des INEF-Konzepts, das darauf abzielt, Probleme zu lösen. Er kritisiert die "Ableitungsakrobatik" der Regulationstheorie und verteidigt die Politikberatung als legitimes Geschäft.
Welches Fazit zieht Dirk Hannemann aus Kritik und Gegenkritik?
Hannemann lobt Brand u.a. für ihre kritische Analyse und die Verdeutlichung, welche Fragen eine emanzipatorische Theorie beantworten muss. Er kritisiert jedoch, dass Brand u.a. den INEF-Ansatz nicht nach seinen eigenen Kriterien messen, sondern ihm ihren eigenen Ansatz überstülpen. Hannemann plädiert für mehr Offenheit und Selbstkritik in der linken Theoriebildung.
Welchen eigenen Ausblick gibt Dirk Hannemann zur Zukunft der Staatlichkeit?
Hannemann argumentiert für eine stärkere Berücksichtigung der Chancen eines demokratischen Weltstaates, der die Nation als Ordnungsprinzip überwindet. Er kritisiert die Fixierung der kritischen Politikwissenschaft auf den Nationalstaat und plädiert für ein basisdemokratisches Stufensystem.
Welche Literatur wird in dem Paper zitiert?
Es wird eine umfangreiche Liste von Literatur zitiert, darunter Werke von Altvater, Brand, Brunnengräber, Hirsch, Messner, Nuscheler, Narr, Rittberger und Ziltener. Die Literaturliste umfasst sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Studien zum Thema Global Governance und Globalisierung.
- Quote paper
- Dirk Hannemann (Author), 2001, Die Kritik an Global Governance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105397