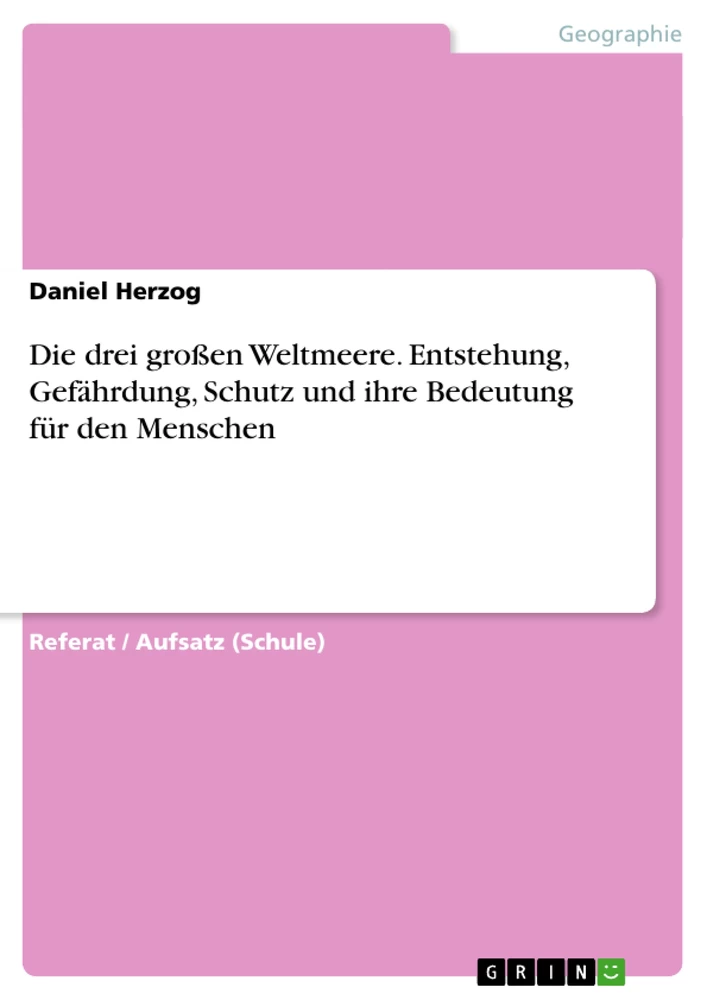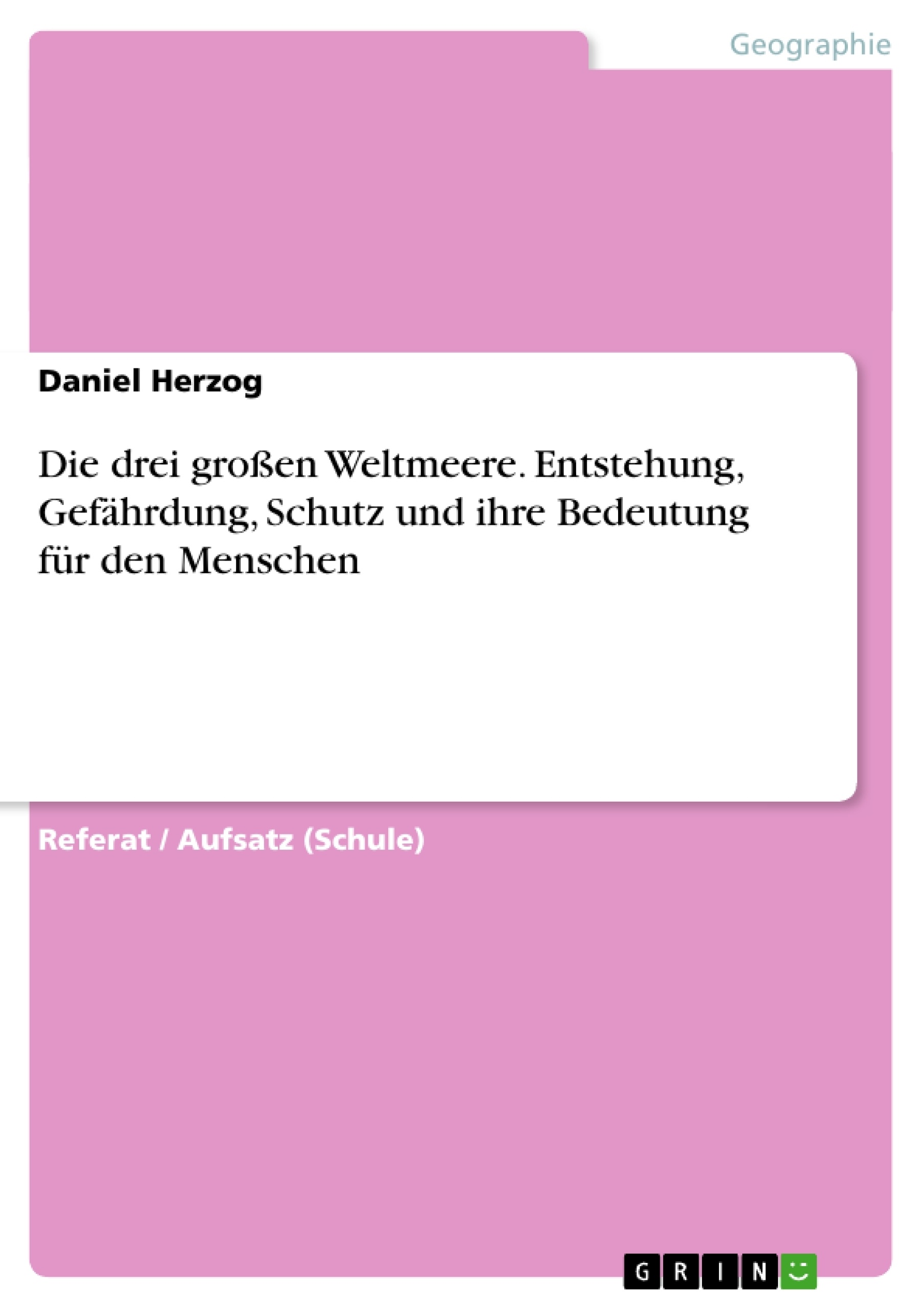Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die tiefsten Geheimnisse unseres Planeten in den unergründlichen Tiefen der Ozeane verborgen liegen, eine Welt, die wir erst zu einem winzigen Bruchteil erforscht haben. Dieses Buch ist eine fesselnde Reise in diese verborgene Dimension, beginnend mit der Entstehung der Ozeane und ihrer Bedeutung für die Plattentektonik. Es beleuchtet die drei großen Weltmeere – den Pazifischen, Atlantischen und Indischen Ozean – und enthüllt ihre einzigartigen geologischen Strukturen, Strömungen, Windsysteme und die Vielfalt des Lebens, das sie beherbergen. Tauchen Sie ein in die komplexen Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre, die den CO2-Haushalt und das globale Klima regulieren. Erfahren Sie, wie die Ozeane als gigantische Wärmespeicher wirken und welche verheerenden Folgen Klimaänderungen für diese empfindlichen Ökosysteme haben können. Das Buch untersucht auch die Bedeutung der Meere für den Menschen, von der Fischerei und dem Abbau von Mineralien bis hin zu ihrer Rolle als Transportwege und Erholungsgebiete. Doch diese Idylle ist bedroht: Die Verschmutzung und Ausbeutung der Ozeane durch den Menschen haben alarmierende Ausmaße angenommen. Erfahren Sie mehr über die verheerenden Auswirkungen von Abwässern, Ölkatastrophen, Atommüll und Plastikmüll auf die Meereslebewesen und die gesamte Umwelt. Entdecken Sie die dringenden Maßnahmen, die erforderlich sind, um diese wertvollen Ökosysteme zu schützen und ihre langfristige Gesundheit zu gewährleisten. Dieses Buch ist ein Weckruf, ein Appell an uns alle, die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Ozeane zu erkennen und uns für ihren Schutz einzusetzen, bevor es zu spät ist. Es ist eine umfassende Analyse der Ozeanographie, Meeresbiologie, des Klimawandels und der Umweltzerstörung, die jeden Leser dazu anregen soll, seinen Teil zur Rettung unserer Meere beizutragen. Es werden Schlüsselwörter wie marine Ökosysteme, Klimafolgenforschung, Meeresverschmutzung, Umweltschutz, nachhaltige Fischerei, erneuerbare Energien, globale Erwärmung, Biodiversität, Meeresschutzgebiete, Küstenschutz, Abfallmanagement, nachhaltiger Tourismus, maritime Wirtschaft, Fischereiressourcenmanagement, Klimaanpassung, Kohlenstoffkreislauf, Tiefseeforschung, Meeressäuger, Korallenriffe, Küstenerosion, Überfischung und marine Ressourcen behandelt.
1. Allgemeines:
Die Erde ist ein „Wasserplanet“: Mehr als 70% ihrer Oberfläche sind von einem zusammenhängenden Weltmeer bedeckt. Das Meer ist der größte Lebensraum der Erde und das größte aufkommen von Biomasse. Neben den Regenwäldern ist das Meer das größte und reichhaltigste Ökosystem und umfasst den größten Artenreichtum und die größte Vielfalt der Erde.
Die Tier- und Pflanzenwelt der tropischen Meere wird an Farbenpracht und Formenvielfalt in keiner anderen Landschaft der Welt übertroffen.
Brodelnde untermeerische Vulkane und kollidierende tektonische Platten, Korallenriffe bis zu enormen Schlammebenen - eine Genialität, die nicht durch künstliche, virtuelle ,,CellophanWelten" zu ersetzen ist.
Seine Besonderheiten liegen weiterhin in den riesigen Ausdehnungen und den dadurch sehr weiträumigen Nahrungsbeziehungen, den großräumigen horizontalen und vertikalen Wasserströmungen und den unvorstellbaren Tiefen (bis über 8000 m und mehr)
Was das Meer zu bieten hat ist also nicht zu übertreffen und nicht zu ersetzen.
Ein einziger Quadratmeter Meeresboden der Nordsee z.B. beherbergt mehrere Milliarden Mikroorganismen, einige Millionen Kleintiere und Tausende größere Meerestiere wie Würmer, Muscheln und Krebse. Diese dienen als Nahrungsgrundlage für die 224 Fischarten der Nordsee.
Korallenriffe, vor 200 Mio. Jahren entstanden, sind die Regenwälder der Meere und weisen die größte Artenvielfalt pro Raum auf. Es wird jedoch geschätzt, daß infolge der Verschmutzung der Meere durch den Menschen bis 2050 die Hälfte verschwunden sein wird. Obwohl das Wissen über die Meere heute ganze Bibliotheken füllt, hat der Mensch bis heute nur einen Bruchteil dieses Lebensraumes erforscht. Wir kennen vom Meer und seinen Gesetzmäßigkeiten nur etwa 1 %. Es ist bisher also fast völlig unerforscht. Genau sowenig die Konsequenzen seiner Zerstörung und Ausbeutung.
Eines ist aber klar: Die Ozeane bestimmen das Schicksal unseres Planeten. Sterben die Ozeane, bedeutet es das Ende aller Ökosysteme.
1.1 Die Entstehung der Ozeane und Meere
Die gegenwärtige Verteilung von Land und Meer eine geologische Momentaufnahme. Durch die Drift der Kontinentalplatten sind nämlich im Verlauf der Erdgeschichte alte Ozeane verschwunden und neue entstanden. Den Schlüssel zur Entzifferung der Genese unserer Ozeane und Meere liefert das Konzept der Plattentektonik.
Mit der ersten Erbohrung von Basalten der ozeanischen Kruste 1961 und den anschließenden Geowissenschaftlichen Tiefseeforschungen wurde die Kenntnis über die Entstehung der Ozeane revolutioniert. An den mittelozeanischen Rücken dringt basaltische Schmelze auf, die dann zu ozeanischer Kruste erstarrt. Der Ozeanboden breitet sich von diesem Zentrum mit durchschnittlich 6 cm pro Jahr aus. Wie ein großes Förderband wird er schließlich in den
Subduktionszonen wieder verschluckt. An der Erdoberfläche erscheinen diese als Tiefseerinnen. Die ältesten bekannten Ozeanböden datieren aus der Jurazeit, als das Rifting von Pangäa begann. Belege für die Bildung und den Bildungszeitraum der Ozeanböden sind u. a. die Magnetostratigraphie und die über Hot Spots gebildeten Vulkaninseln und Tiefseeberge.
Weitgehend unbemerkt von der sich wohlinformiert gebenden Öffentlichkeit vollzieht sich 1998 als "Jahr der Ozeane". Die Menschen sind sehr interessiert an der Meeresnatur wie der Erfolg des großes Meeresaquariums bei der Welt-Expo in Lissabon zeigte. Die Ozeanwelt ist wunderschön, weit und faszinierend, sie regt die Gedanken an, auch wenn man bedenkt, dass alles Leben aus den Meeren stammt. Der Umgang der Ökonomie mit diesem größten Raum des Planeten sieht aber anders aus.
Wie der BUND - Bund für Umwelt- und Naturschutz - mitteilt, sind 60% der Fische durch das Überfischen der Ozeane bereits ausgestorben. 100 Mio Tonnen werden jährlich aus den Weltmeeren gefischt. Der BUND meint, wenn wir nicht endlich beginnen die Meere wirklich zu schützen, dann wird die Artenvielfalt durch die Überfischung noch weiter ausgedünnt.
1.2 Ozeanographie,
die Wissenschaft vom Meer; beschäftigt sich mit den physikalischen, chemischen, biologischen, geologischen und geophysikalischen Erscheinungen und Vorgängen im Weltmeer. Sie erforscht u.a. die Wechselbeziehungen zwischen Wasser- und Lufthülle der Erde, die für das Klima entscheidend sind.
1.3 Die drei großen Weltmeere
1.3.1 Pazifischer Ozean,
auch Pazifik, Stiller Ozean oder Großer Ozean genannt, der größte und tiefste aller Ozeane. Der Pazifische Ozean bedeckt mehr als ein Drittel der Erdoberfläche und enthält über die Hälfte des nicht als Eis gebundenen Wassers des Planeten. Das Weltmeer trennt Amerika im Osten von Asien und Australien im Westen. Manchmal wird der Pazifische Ozean in zwei Hälften unterteilt, deren Trennung auf einer Übereinkunft beruht (und nicht auf geographischen Gegebenheiten): Der nördlich des Äquators befindliche Teil wird als Nordpazifik bezeichnet, der südlich des Äquators gelegene Teil entsprechend als Südpazifik. Der Name Pazifik, was so viel wie friedlicher Ozean bedeutet (lateinisch pax: Frieden), wurde ihm - in der irrtümlichen Annahme eines ruhigen, windstillen Ozeans - durch den portugiesischen Seefahrer Fernão Magalhães im Jahr 1520 gegeben.
Ausdehnung und Größe
Der Pazifische Ozean wird im Osten durch die Kontinente Nord- und Südamerika begrenzt, im Norden durch die Beringstraße, im Westen durch das asiatische Festland und zahlreiche Inseln (wie die japanischen Hauptinseln, Neuguinea und die Inselwelt der Philippinen und Indonesiens) sowie im Süden durch die Antarktis. Die Abgrenzung gegen den Atlantischen Ozean erfolgt im Norden durch die Beringstraße und im Südosten durch die Drakestraße etwa entlang des 68. Grades westlicher Länge von Kap Hoorn zur Antarktischen Halbinsel.
Die südwestliche Abgrenzung zum Indischen Ozean ist nicht offiziell festgelegt. Abgesehen von den Randmeeren am unregelmäßigen Westrand beträgt die Gesamtfläche des Pazifischen Ozeans etwa 166 Millionen Quadratkilometer und ist somit erheblich größer als die gesamte Landmasse der Erde. Die größte Länge beträgt von der Beringstraße bis zur Antarkis etwa 15 500 Kilometer, die größte Breite von Panamá bis zur Malaiischen Halbinsel etwa 17 700 Kilometer. Die mittlere Tiefe des Pazifiks beträgt 4 282 Meter; die tiefste Stelle, die überhaupt in einem der Weltmeere bekannt ist, liegt im Marianengraben vor Guam und beträgt 11 034 Meter (die so genannte Challenger Deep).
Geologie: Entstehung und Struktur
Der Pazifische Ozean ist das älteste der heute bestehenden Ozeanbecken, dessen ältestes Gestein auf etwa 200 Jahrmillionen zurückdatiert wurde. Das Becken und seine Ränder wurden durch tektonische Prozesse geformt. Der bis zu 180 Meter tiefe Küstenschelf (flacher Sockel an den Rändern der Kontinente mit entsprechend flachen Küstenmeeren) ist entlang der beiden amerikanischen Kontinente schmal, am Rand von Asien und Australien jedoch vergleichsweise breit. Der Ostpazifische Rücken, ein Mittelozeanischer Rücken, verläuft über eine Länge von 8 700 Kilometern vom Golf von Kalifornien bis zu einem Punkt, der sich etwa 3 600 Kilometer westlich der Südspitze Südamerikas befindet. Er erhebt sich durchschnittlich 2 130 Meter über den Meeresgrund. Geschmolzenes Gestein strömt entlang dieses Gebirgsrückens aus dem Erdmantel, ähnlich wie am Mittelatlantischen Rücken. Das Gestein bildet nach dem Auskristallisieren neuen Meeresboden, der sich zu beiden Seiten des Rückens von der Zentralspalte wegbewegt. Dies führt zu einem Zuwachs der an den Rücken angrenzenden Kontinentalplatten, was zu starken Spannungen führt. Diese sind die Voraussetzung für die wiederholt auftretenden Erdbeben und das gehäufte Vorkommen von Vulkanen an den Rändern der Kontinentalplatten. Der zirkumpazifische Vulkangürtel umfasst zahlreiche Vulkane, u. a. in den nord-, zentral- und südamerikanischen Küstengebirgen, auf der russischen Halbinsel Kamtschatka, in Japan, auf den Philippinen und Neuseeland. Da sich der in Richtung der Kontinente und Inselketten bewegende Tiefseeboden unter die Landmassen schiebt, kommt es zur Bildung markanter Tiefseegräben. Diese können, wie der bereits erwähnte Marianengraben, Tiefen von 10 000 Metern überschreiten.
Inseln
Die größeren Inseln im westlichen Bereich werden durch mehrere Inselbögen vulkanischen Ursprungs gebildet, die sich auf den breiten Kontinentalschelfen am Ostrand der eurasischen Platte erheben. Zu diesen Inselbögen zählen Japan, Taiwan, die Philippinen, Indonesien, Neuguinea und Neuseeland. Die pazifischen Inseln außerhalb des Bereiches an den Rändern der Kontinente werden insgesamt als Ozeanien bezeichnet; sie umfassen die Inselgruppen Melanesien, Mikronesien und Polynesien. Bei diesen Inseln handelt es sich um die Gipfel untermeerischer Berge, die sich auf dem Ozeangrund durch an dünnen Stellen der Erdkruste austretendes, geschmolzenes Gestein aufgetürmt haben. Im Pazifischen Ozean gibt es insgesamt mehr als 30 000 solcher Inseln, deren Oberfläche zusammengenommen jedoch nur 0,25 Prozent der Gesamtoberfläche des Pazifiks ausmacht. Die Berge, die die Meeresoberfläche nicht durchstoßen, heißen Tiefseeberge. Vielfach, vor allem in den südlichen Bereichen des Pazifischen Ozeans, stellen die über dem Meeresspiegel liegenden Inseloberflächen über die Wasseroberfläche hinausragende Korallenriffe dar. Am Ostrand des Pazifiks ist der Kontinentalschelf schmal und steil, hier liegen nur wenig Inseln. Die wichtigsten Inselgruppen auf dieser Seite sind die Galápagos-Inseln, die sich auf der Nazcaplatte (einer kleinen Kontinentalplatte) erheben, die Alëuten auf dem nordamerikanischen Kontinentalschelf und die Hawaii-Inseln, die sich etwa 5 550 Meter hoch über den Meeresgrund des Zentralpazifiks erheben.
Strömungen
Die wesentlichen Antriebskräfte der Meeresströmungen sind die Erdrotation, die Windreibung auf der Wasseroberfläche und die Unterschiede in der Dichte des Ozeanwassers, die durch unterschiedliche Temperaturen und Salzgehalte bedingt sind. Das
Zusammenspiel von Winden und Strömungen hat starke Auswirkungen auf das Klima; diese komplexen Zusammenhänge werden untersucht, um längerfristige Wettervorhersagen treffen zu können und die Schifffahrt sicherer zu machen.
Die Oberflächenströmungen des Nordpazifiks bestehen aus zwei Hauptwirbeln oder - kreisläufen. Im hohen Norden dreht sich der subarktische Wirbel, zu dem der westwärts fließende Alaskawirbel und der ostwärts fließende Subarktisstrom gehören; beide drehen sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Hauptbereich des Nordpazifiks wird jedoch vom gewaltigen Nordwirbel beherrscht, der im Uhrzeigersinn kreist. Zu diesem riesigen Wirbel gehören der westwärts fließende Nordäquatorialstrom, der Nordpazifische Strom, der ostwärts strömt, der Kalifornische Strom, der in südöstlicher Richtung fließt, und der Kuroshio, der an der Küste Japans entlang nach Norden strömt. Der Kalifornische Strom ist kalt, breit und bewegt sich langsam; der Kuroshio dagegen ist warm, schmal und schnell fließend, worin er dem Golfstrom ähnelt. Nahe am Äquator, etwa auf fünf Grad nördlicher Breite, trennt der ostwärts fließende Äquatoriale Gegenstrom die Strömungssysteme des Nord- und Südpazifiks, schickt aber den Großteil seiner Wassermassen in den Nordäquatorialstrom.
Der Südpazifik wird vom sich gegen den Uhrzeigersinn drehenden, zentralen Südwirbel beherrscht. Er umfasst im Wesentlichen den Südäquatorialstrom, der nach Osten und Süden strömt, und den Südpazifischen Strom, der nach Westen fließt. Im äußersten Süden befindet sich der Antarktische Zirkumpolarstrom, der ringförmig den ganzen südlichen Erdball umfließt und in dem die Wasser des Pazifischen, des Atlantischen und des Indischen Ozeans zusammenfließen. Der Antarktische Zirkumpolarstrom ist die wichtigste Quelle der Tiefenströmungen des Pazifiks. Von ihm aus fließt der breite, kalte Humboldt- oder Perustrom entlang der südamerikanischen Küste nach Norden und mündet schließlich im Südäquatorialstrom. Ein besonderes Phänomen im Pazifischen Ozean ist El Niño, eine Erscheinung mit klimatischen Auswirkungen von globaler Dimension.
Windsysteme
Zu den großen Windsystemen des Pazifischen Ozeans zählen die beiden Westwindzonen, die jeweils etwa zwischen 30 und 60 Grad nördlicher bzw. südlicher Breite von West nach Ost wehen. Die Stärke dieser Winde variiert je nach Jahreszeit. Der stürmische, in seiner Intensität starken Schwankungen unterworfene Westwind bringt mitunter starke Niederschläge. Zwischen den Westwindzonen wehen die gleichmäßiger ausgeprägten Passatwinde, die auf der Nordhalbkugel aus dem Nordosten und auf der Südhalbkugel aus dem Südosten kommen. Über weite Abschnitte des Jahres sind die unter dem Einfluss der Passate stehenden Gebiete von Trockenheit gekennzeichnet. Starke tropische Wirbelstürme, die im westlichen Pazifischen Ozean Taifune und in den südlichen und östlichen Bereichen des Weltmeeres Hurrikans genannt werden, können im Spätsommer und Frühherbst auftreten. Im Bereich des Äquators befindet sich der Kalmengürtel, wo leichte Winde vorherrschen, die jahreszeitlich jedoch reichhaltige Niederschläge liefern können. In den höchsten Breiten des Pazifiks haben die Winde kaum direkte Auswirkungen auf das Klima und die Wasserströmungen.
1.3.2 Atlantischer Ozean,
nach dem Pazifischen Ozean (Pazifik) zweitgrößter Ozean der Erde. Der Abschnitt nördlich des Äquators wird als Nordatlantik, der südlich des Äquators als Südatlantik bezeichnet. Der Name des Ozeans ist von Atlas abgeleitet, einem der Titanen aus der griechischen Mythologie.
Ausdehnung und Größe
Der Atlantische Ozean erstreckt sich vom Nordpolarmeer im Norden bis zur Antarktis im Süden und von der Ostküste des amerikanischen Kontinents bis zur Westküste Europas und Afrikas. Die Fläche beträgt etwa 84 Millionen Quadratkilometer. Zählt man die Randmeere Golf von Mexiko, Karibisches Meer (Karibik), Nordpolarmeer, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer und Schwarzes Meer dazu, so ergibt sich eine Gesamtfläche von ungefähr 106 Millionen Quadratkilometern. Die Grenze zwischen Nordatlantik und Nordpolarmeer verläuft entlang einiger untermeerischer Bergketten, die sich zwischen den Landflächen der Baffin-Insel, Grönlands und Islands befinden. Deutlicher ist die Grenze zum Mittelmeer bei der Straße von Gibraltar und zum Karibischen Meer entlang des Bogens der Antillen. Die Grenze des Südatlantiks zum Indischen Ozean verläuft durch den 20. Grad östlicher Länge. An seiner Westseite trennt ihn eine Linie, die von Kap Hoorn zur antarktischen Halbinsel verläuft, vom Pazifischen Ozean.
Geologie: Entstehung und Struktur
Die Bildung des Beckens des Atlantischen Ozeans setzte im Jura, vor etwa 150 Millionen Jahren ein, als sich eine Spalte im Kontinent Gondwana auftat, die zur Trennung Südamerikas und Afrikas führte. Das Auseinanderdriften der beiden Kontinente setzt sich noch heute mit einer Geschwindigkeit von mehreren Zentimetern pro Jahr entlang des Mittelatlantischen Rückens fort. Der Mittelatlantische Rücken ist ein Bestandteil des Mittelozeanischen Rückensystems, das die Erde umschließt. Er verläuft von Nord nach Süd etwa in der Mitte zwischen den Kontinenten, annähernd parallel zu deren Küsten. Bei einer Breite von etwa 1 500 Kilometern hat er eine zerklüftete Oberfläche und wird häufig von Vulkanausbrüchen und Erdbeben erschüttert. Die Bergkette erhebt sich zwischen einem und drei Kilometer über den Meeresgrund. Untermeerische Bergketten und Erhebungen, die sich in West-Ost- Richtung zwischen den Kontinentalschelfen (küstennahe Meeresgebiete mit einer maximalen Wassertiefe von 200 Metern) und dem Mittelatlantischen Rücken erstrecken, teilen den östlichen und westlichen Meeresgrund in eine Reihe von Tiefseebecken ein. Westlich des Mittelatlantischen Rückens sind dies Nordamerikanisches, Brasilianisches sowie Argentinisches Becken. Auf der östlichen Seite sind es Westeuropäisches, Kanarisches und Kapverdisches Becken, Sierra-Leone- Becken, Guineabecken, Angolabecken, Kapbecken und Agulhasbecken. Die mittlere Tiefe des Atlantischen Ozeans beträgt 3 844 Meter bzw.
3 293 Meter (mit Nebenmeeren). Der größte Tiefe befindet sich mit 9 219 Metern im Puerto-Rico-Graben in der Milwaukee-Tiefe.
Inseln
Die meisten größeren Inseln im Atlantischen Ozean liegen nahe dem Festland, wie
Neufundland, die Britischen Inseln und die Falkland-Inseln. Inseln vulkanischen Ursprungs, wie viele der Antillen, sind im Atlantik weniger verbreitet wie im Pazifik. Madeira, die Kanarischen Inseln und Kap Verde sind Gipfel untermeerischer Bergketten. Die Azoren, Ascension und die Inselgruppe Tristan da Cunha sind über den Meeresspiegel ragende Gipfel des Bergsystems des Mittelatlantischen Rückens. Auch Island ist das Ergebnis von Vulkaneruptionen im Mittelatlantischen Rücken.
Strömungen
Das Zirkulationssystem des Atlantischen Ozeans gliedert sich in ein Nordatlantisches und ein Südatlantisches Strömungssystem. Diese entstehen vor allem durch Windeinwirkung (besonders durch die Passate), aber auch durch die Drehung der Erde. Die Strömungen des Nordatlantiks, zu denen Nordäquatorialstrom, Karibenstrom, Antillenstrom, Floridastrom, Kanarenstrom und Golfstrom zählen, fließen überwiegend im Uhrzeigersinn. Die Strömungen des Südatlantiks, von denen Südäquatorialstrom, Brasilstrom und Benguelastrom die bedeutendsten sind, bewegen sich meist entgegen dem Uhrzeigersinn. In den Atlantischen Ozean münden einige bedeutende Flüsse, u. a. Sankt-Lorenz-Strom, Mississippi, Orinoco, Amazonas, Paraná, Kongo, Niger, Loire. Trotz des umfangreichen Eintrags von Süßwasser ist das Atlantikwasser etwas salzhaltiger als das Wasser des Pazifischen und des Indischen Ozeans, was vor allem am hohen Salzgehalt des durch die Straße von Gibraltar abfließenden Mittelmeerwassers liegt.
Temperaturen
Das Oberflächenwasser des Atlantischen Ozeans hat in den äquatornahen Bereichen eine Temperatur von 27 bis 28 °C. Polwärts davon nehmen die Temperaturen schnell ab, bis es schließlich mit dem kalten Wasser der polaren Bereiche (-1 °C) zusammentrifft. Der Golfstrom bewirkt an der Ostseite des Nordatlantiks höhere Temperaturen als auf der Westseite in gleicher Breitenlage. So liegen die mittleren Temperaturen in Nordeuropa wesentlich höher als in Gebieten gleicher geographischer Breite in Nordamerika.
1.3.3 Indischer Ozean,
das kleinste und geologisch jüngste der drei großen Weltmeere. Der Indische Ozean ist im Küstenbereich stark gegliedert und umfasst mehrere Nebenmeere.
Grenzen und Größe
Der Indische Ozean wird im Westen von Afrika, im Norden von Asien, im Osten von
Australien und den zu Australien und Asien gehörenden Inseln und im Süden von der Antarktis begrenzt. Die Grenze zum Atlantischen Ozean im Südwesten verläuft auf einer etwa 4 000 Kilometer langen Linie entlang des 20. Grades östlicher Länge, die vom Kap Agulhas an der Südspitze Afrikas bis zur Antarktis reicht. Als Grenze zum Pazifischen Ozean gilt im Südosten der Meridian durch die Südspitze der Insel Tasmanien bei etwa 147 Grad östlicher Länge. Im Nordosten bilden die Malaccahalbinsel, die Sunda-Inseln von Sumatra bis Timor sowie die Nordspitze Australiens den Grenzbereich zum Pazifik.
Die Fläche des Indischen Ozeans beträgt etwa 74,1 Millionen Quadratkilometer; dies entspricht annähernd der Gesamtfläche der beiden Kontinente Asien und Afrika. Im
Allgemeinen werden ein nördlicher und ein südlicher Indischer Ozean mit dem Äquator als Grenze unterschieden. Nach Norden hin wird der Ozean durch den Indischen Subkontinent in den Golf von Bengalen im Osten und in das Arabische Meer im Westen geteilt. Das Arabische Meer teilt sich nach Norden wiederum in zwei Arme, den Persischen Golf im Osten und das Rote Meer im Westen. Auch in den anderen Randbereichen gibt es Buchten und Meeresstraßen, wie etwa die Große Australische Bucht oder die Straße von Moçambique.
Im Indischen Ozean befinden sich zahlreiche Inseln, die größten sind Madagaskar und Sumatra, zu den kleineren zählen z. B. die Malediven und Mauritius. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Inseln untermeerischen Rücken aufgesetzt. Wichtige Zuflüsse vom afrikanischen Kontinent sind Limpopo und Sambesi, vom asiatischen Festland Irawadi, Brahmaputra, Ganges, Indus und Schatt el Arab. Gelegentlich kommt es über dem Ozean zu Wirbelstürmen. Eine klimatische Besonderheit ist der jahreszeitlich wechselnde Monsun.
Geologische Entstehung und Struktur
Die Bildung des Indischen Ozeans begann mit dem Zerfall des Urkontinents Pangäa und der Abtrennung des Gebiets, aus dem später Australien, Indien und die Antarktis entstanden. Die Tiefsee wird durch ein System von mittelozanischen Rücken in mehrere Großbecken gegliedert. Dies sind das Zentralindische Becken im Nordosten, das Somalibecken im Westen und das Südwestindische Becken im Süden. Über niedrigere Rücken und Schwellen stehen diese Großbecken mit mehreren Nebenbecken wie dem Arabischen Becken, dem Madagaskarbecken oder dem Atlantisch-Indischen Subpolarbecken in Verbindung.
Die mittlere Tiefe des Indischen Ozeans beträgt etwa 3 840 Meter; die mit 7 455 Metern tiefste bisher gemessene Stelle markiert der Sundagraben vor der Südküste der indonesischen Insel Java. Die den Kontinenten vorgelagerten Schelfgebiete nehmen in manchen Regionen ausgedehnte Flächen ein. Vor allem im Persischen Golf sowie an Abschnitten der Küste Australiens ist der Kontinentalschelf breit.
Strömungen
Die Meeresströmungen entsprechen mit Ausnahme der küstennahen Strömungen den vorherrschenden Windsystemen; in weiten Teilen des Indischen Ozeans herrscht ein auffallender jahreszeitlicher Wechsel von Wind- und Strömungsrichtung vor. Zur Zeit des aus Nordosten wehenden Wintermonsuns ist das äquatoriale Stromsystem ähnlich strukturiert wie das der anderen Weltmeere; es setzt sich aus Nordäquatorialstrom, Äquatorialem Gegenstrom und Südäquatorialstrom zusammen. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass der Äquatoriale Gegenstrom aufgrund des Übergreifens des Nordostmonsuns auf die Südhalbkugel südlich des Äquators verläuft. Im Sommer ändert sich die Hauptwindrichtung; der Südwestmonsun dominiert das Klima und ist auch für den Verlauf der Meeresströmungen von Bedeutung. Er veranlasst z. B. den vor der ostafrikanischen Küste fließenden Somalistrom zur Änderung der Richtung nach Norden.
Wassertemperatur und Salzgehalt
Während im südlichen Teil des Indischen Ozeans entsprechend der Land-Meer-Verteilung die Isothermen (Linien gleicher Temperatur) überwiegend parallel zu den Breitenkreisen verlaufen, variieren die Temperaturen im nördlichen Teil stärker. Dies liegt auch an der stark gegliederten Küste und dem Vorhandensein mehrerer Randmeere, in denen die Temperaturen aufgrund geringerer Zirkulation niedriger sind. So ist die Sommertemperatur der oberflächennahen Wasserschichten im Persischen Golf mit 32 °C etwa um 4 °C höher als in den anderen Gebieten nördlich des Äquators. Eine Ausnahme bildet der Somalistrom, in dem kalte Auftriebswasser zu Abkühlung führen.
Besonders hohe Salzgehalte verzeichnen das Rote Meer und der Persische Golf; aufgrund der hohen Verdunstungsraten liegen die Salzgehalte hier um 40 Promille. Im Golf von Bengalen sind sie wegen höherer Niederschläge und dem Eintrag von Süßwasser im Bereich der Mündungen großer Ströme mit rund 33 Promille deutlich niedriger. Wie die Wassertemperaturen zeigen auch die Salzgehalte südlich des Äquators höhere Konstanz; sie betragen in den meisten Gebieten um 34 Promille.
2. Bedeutung der Meere im Wasser-, Klima- und Energiehaushalt der Erde
2.1 Die Regelung des CO2-Haushalts
Zwischen Ozean und Atmosphäre herrschen komplexe Wechselbeziehungen. Vor allem regeln die Meere den CO2 Haushalt.
Jährlich werden etwa 100 Milliarden Tonnen CO2 zwischen der Atmosphäre und den Meeren ausgetauscht.
Der Ozean enthält etwa 60 mal soviel Kohlendioxid wie die Atmosphäre. Heute bleibt etwa die Hälfte des
Kohlendioxids, das die Menschen durch fossile Energienutzung und Waldvernichtung freisetzen, in der Atmosphäre. Ein Großteil der anderen Hälfte wird von den Meeren (bzw. Algen) gebunden. Gewaltige Mengen Kohlenstoff sinken darüber hinaus als wasserunlösliche Chemikalien zum
Meeresgrund. Bakterien entscheiden , welcher Teil des ungeheuren Kohlenstoffreservoirs im Meerwasser in
Treibhausgas umgewandelt wird. Käme auch nur eine Bakterie auf die Idee, auch nur 10 % des gelösten Kohlenstoffes oder der schwer zu knackenden Verbindungen in CO2 zu verwandeln, würde die Erde zum Dampfkochtopf. Der Kohlenstoffspeicher Ozean wirkt, wenn auch in einem langwierigen Prozess, dem Treibhauseffekt entgegen und verzögert die globale Erwärmung.
2.2 die gegenseitige Abhängigkeit von Ozean und Klima
Die gewaltigen globalen Warm- und Kaltströmungen eines weltweiten Strömungssystems, das sich wie ein Förderband um die Erde zieht, stabilisieren und bestimmen das Wetter. Die Weltmeere bestimmen das Klima an Land. Sie transportieren Wärme aus den Tropen polwärts und Kälte von dort Richtung Äquator. Mit ihrer gewaltigen Masse speichern sie wie ein thermischer Schwamm riesige Mengen Energie und dämpfen Temperaturextreme. Allein die obersten 3 Meter Meerwasser bergen soviel Wärme wie die gesamte Atmosphäre. Vollgetankt mit karibischer Wärme, beschert z.B. der Golfstrom nicht nur Westeuropa ein mildes Klima. (Die Heizung Europas gibt dort eine Wärmemenge an die Luft ab, die der Leistung von 400.000 großen Atomkraftwerken entspricht.)
Ozeane reagieren wenn auch sehr träge auf äußere Veränderungen: Sie beeinflussen somit nicht nur das Weltklima, sondern das Klima wirkt umgekehrt auch auf das Meer - ein Effekt, der wiederum Folgen für das globale Klima hat: Die Erwärmung der Atmosphäre durch den Treibhauseffekt könnte die Strömungen einschläfern:
Antrieb der Strömungen ist das Gefälle im Salzgehalt der Meere. Doch dieser Motor ist sehr anfällig für Klimaänderungen: Süßes Schmelzwasser von Gletschern kann ihn lahmlegen und die Strömungsriesen stoppen.
Schon die Umkehrung einer einzigen Strömung führt zu gewaltigen Klimaänderungen + globalen Naturkatastrophen (Beispiel: El Nino - Phänomen 1998, riesige Waldbrände in Indonesien, Malaysia usw., Dürrekatastrophen in der Sahelzone usw.).
3. Bedeutung für den Menschen
3.1 Pazifischer Ozean
Ein Großteil der Fauna und Flora des Pazifischen Ozeans konzentriert sich an seinen Rändern. Nährstoffreiches Wasser des Antarktischen Zirkumpolarstromes kommt vor allem im Humboldtstrom vor den Küsten Chiles und Perus an die Oberfläche. Das große Vorkommen von Anchovetas (Südamerikanische Sardellen) in diesem Gebiet ist eine der bedeutenden Weltnahrungsreserven. Dort befindet sich auch der industrielle Guanoabbau, der die stickstoffreichen Exkremente der Meeresvögel - den Guano - nutzt, wobei die Vögel sich wiederum von Anchovetas ernähren. Auch im Nordwestpazifik, zu dem das Japanische Meer und das Ochotskische Meer gehören, befindet sich ein wichtiges Fischfanggebiet. Der Reichtum des Pazifischen Ozeans an Korallenriffen mit ihrem vielfältigen Tier- und Pflanzenleben findet seinen deutlichsten Ausdruck im Großen Barrierriff vor der Nordwestküste Australiens, das sich über eine Länge von über 2 000 Kilometern erstreckt. Die großen Mineralienvorkommen im Pazifik beginnt man seit einigen Jahrzehnten verstärkt abzubauen. Auf den Kontinentalschelfen von Kalifornien, Alaska, China und Indonesien befinden sich große Erdöllager. Durch die Tiefseeforschung entdeckte man außerdem, dass große Gebiete des Ozeangrundes mit so genannten Manganknollen bedeckt sind, kartoffelgroßen Ablagerungen von Eisen und Manganoxiden, die manchmal auch Kupfer, Cobalt oder Nickel enthalten. Abbaumöglichkeiten für diese Lager werden momentan untersucht. Der Panamákanal stellt den wichtigsten Schifffahrtsweg zum Atlantischen Ozean dar; eine vielgenutzte Verbindung zum Indischen Ozean bildet die Malaccastraße.
3.2 Atlantischer Ozean
Im Atlantischen Ozean gibt es einige der weltweit ertragreichsten Fischgründe. Diese liegen vorwiegend im Bereich der Kontinentalschelfe und der untermeerischen Bergketten nahe den Britischen Inseln, Island, Kanada (hier vor allem die Grand Banks bei Neufundland) und dem Nordosten der USA. Auch Gebiete, in denen nährstoffreiches Wasser aus tieferen Regionen an die Oberfläche strömt, haben ein reichhaltiges Meeresleben aufzuweisen, wie beispielsweise die Gegend um die Walfischbucht vor der Küste Namibias. Die wichtigsten Fangfische im Atlantik sind Hering, Sardelle, Sardine, Kabeljau, Flunder und Barsch. Thunfisch wird in zunehmendem Maß vor Nordwestafrika und dem Nordosten Südamerikas gefangen. Die Fangquoten liegen im Atlantischen Ozean erheblich höher als in anderen Ozeanen. Ein interessantes Beispiel für pflanzliches Leben im Atlantik gibt es in der Sargasso-See, die zwischen den Antillen und den Azoren liegt und im Norden und Westen vom Golfstrom umschlossen wird. Dort treiben riesige Flächen braunen Beerentanges (Sargassum) auf dem vergleichsweise ruhigen Oberflächenwasser. Zu den Mineralerzen, die im Atlantischen Ozean gefördert werden, gehören Titan, Zirconium und Monazit, die vor der Ostküste Floridas gewonnen werden. Vor der Äquatorküste Afrikas werden Eisenerz und Zinnerz gefördert. Die Kontinentalschelfe des Atlantiks sind reich an fossilen Brennstoffen. Große Mengen Erdöl werden in der Nordsee und im Karabischen Meer sowie im Golf von Mexiko gewonnen. Geringere Mengen werden vor der afrikanischen Küste im Golf von Guinea gefördert.
3.3 Indischer Ozean
Die Fischerei spielt im Indischen Ozean eine wesentlich geringere Rolle als dies im Atlantischen oder im Pazifischen Ozean der Fall ist. Sie beschränkt sich vorwiegend auf lokale Küstenfischerei. Von herausragender Bedeutung ist dagegen die Förderung von Erdöl. Im Persischen Golf befinden sich einige der ergiebigsten Lagerstätten; der Wohlstand einiger Anrainerstaaten auf der Arabischen Halbinsel basiert auf diesem Rohstoff. Allerdings beeinträchtigten Umweltkatastrophen wie etwa während des 2. Golfkrieges die ökologische Situation der Region nachhaltig.
4. Gefährdung und Schutz der Ozeane
Nachdem die Meere Jahrmillionen intakt waren, zerstört der Mensch sie nun innerhalb kürzester Zeit: Die Menschen missbrauchen die Meere als Abfallkippe, Jauchegrube, Ölsumpf, Sonder- und Atommülldeponie sowie als Endlager für Giftgase und Kampfstoffe. Sie Rotten eine Fischart nach der anderen aus und blasen dermaßen viel Kohlendioxid in die Luft, dass die daraus resultierende Erderwärmung die mächtige, aber sehr sensible Maschinerie der Meere durcheinanderbringt.
Die Meere sind heute zum Teil überfischt, verstrahlt, verdreckt und ausgebeutet. Schwarze Ölfilme, rote Algenteppiche, weiße tote Korallenriffe, gelbe Schlammlawinen und braune Abwasserströme sind auf Satellitenbildern zu sehen.
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 1998 nicht umsonst zum ,,Jahr der Meere" erklärt.
Die Leichtfertigkeit der Menschen resultiert vielleicht auch daraus, dass Meere nicht zu ihrem Wahrnehmungsbereich gehören. Sie sehen nicht, was sie in den Tiefen des Meeres anrichten und nicht was sie in den letzten Jahrzehnten angerichtet haben. Vielen, z.B. den schnorchelnden Touristen, fehlt außerdem die Vergleichsmöglichkeit zu den intakten Unterwasserlandschaften von vor 30 Jahren. Vieles wurde bereits zerstört, ohne das wir es kennen gelernt haben.
Die Zerstörung der Ozeane erfolgt hauptsächlich durch ihre Verschmutzung und Ausbeutung.
Die Meere werden regelrecht als Müllkippe benutzt und durch Abfälle unterschiedlichster Art belastet:
- Abwasser
- Verschmutzungen bei der Gewinnung von Rohstoffen (Erdöl, Erdgas, mineralische Rohstoffe) über Chemikalien,
- Sondermüll
- Nährstoffe
- radioaktiven Stoffen usw.
Abwasser
Der meiste Unrat kommt aus Abwasserkanälen und Kläranlagen-Ausläufen, die ihre Fracht über Flüsse ins Meer schicken.
Noch immer gelangen Abwässer von rund 39 Millionen Menschen in den Nordsee-
Anrainerstaaten völlig unbehandelt in die Flüsse und in die Nordsee. Tonnenweise gelangen schwer abbaubare chemische Stoffe in dieses Endlager.
Die Industrie hat inzwischen über 100.00 verschiedene chemische Substanzen in Umlauf gebracht - davon ist gerade mal ein Prozent näher erforscht Bei einem Großteil ist völlig unbekannt, wie sie sich langfristig in der Umwelt verhalten.
Ölpest
Schätzungsweise 2,5 Millionen Tonnen Öl gelangen jährlich in die Ozeane. Durchschnittlich nur 4 % davon gehen auf das Konto von Havarien.
Ein weiterer Teil gerät beim Normalbetrieb von Schiffen und Bohrinseln ins Wasser, die ihre Abfälle und Abwässer ungeklärt ins Meer geben.
6500 Bohrinseln, 100.000 Tanker und andere Ozeanriesen verschmutzen die Weltmeere mit Millionen Tonnen Öl.
Folge ist die Ölpest. Sie beeinträchtigt den Gasaustausch mit dem Luftraum sowie anderer Lebensfunktionen des Biotops Wasser erheblich.
Alltägliche Verschmutzung mit Öl am Beispiel Nordsee: Nach der Entdeckung der Erdöl- und Erdgasvorkommen in den 60er und 70er Jahren hat sich die Nordsee in ein riesiges Industriegebiet verwandelt. Heute fördern 416 Anlagen jährlich rund 205 Millionen Tonnen Erdöl und etwa 92 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die Öl- und Gasförderung verschmutzt bereits im alltäglichen Normalbetrieb das Meer. 1992 gelangten nach Angaben der internationalen Kommission zur Verhütung von Meeresverschmutzung (PARCOM) von den 416 Anlagen rund 100.000 Tonnen Chemikalien und 14.000 Tonnen Erdöl in die See.
Ein Teil der Ölverseuchung ist Unfällen bei der Förderung zuzuschreiben.
Obwohl jedes Jahr Unfälle auf den Plattformen vorkommen, planen die Betreiber der Offshore-Anlagen in Zukunft mit noch riskanteren Verfahren Öl zu fördern.
Die nächste Gefahrenquelle für die Umwelt ist der Transport von Rohöl: Ein Fünftel der
Öltanker ist reif für den Schrott, sie sind damit schwimmende Zeitbomben.
Dem Gewicht nach gerechnet nehmen 90 % des kompletten Welthandels den (billigen) Weg über die Meere. Davon werden mehr als eine Milliarde Tonnen Erdöl jährlich transportiert. Vor 10 Jahren ist die Exxon Valdez an einem Riff in Alaska gestrandet und hat rund 40.000 Tonnen Rohöl verloren. Nur 20 - 30 % sind davon entfernt worden. Der größte Teil ist noch immer an den Stränden vor allem unter den Steinen an den Kiesstränden. Trotz alledem wurden kaum Konsequenzen aus der Havarie und den Unglücken der letzten Jahre gezogen.
Strengere Regeln und Sicherheitsauflagen, wie Doppelhüllen der Tanker, müssen durchgesetzt und v.a. schneller in Kraft treten.
Von Naturschutzorganisationen wird ein Schrittweiser Ausstieg aus dem fossilen Brennstoff Erdöl und keine weiteren Erschließungen neuer Ölfelder gefordert. Allein der Verbrauch aller bisher bekannten Vorkommen würde eine Kohlendioxid-Menge freisetzen, die für das Erdklima nicht mehr verkraftbar wäre.
Atommüll
Ozeane als Müllkippe der Atomindustrie
Hochradioaktive Abfälle werden in die Ozeane geleitet, versenkt, vergraben etc.
Die 3 europäischen Wiederaufbereitungsanlagen leiten große Mengen radioaktiven
Abwassers in die Meere. Flüssiger Atommüll wird direkt ins Meer geleitet. Allein z.B. die Wiederaufbereitungsanlage Sellafield leitet jeden Tag neun Millionen Liter radioaktives Abwasser in die Irische See. Die radioaktiven Substanzen verteilen sich weiträumig im Atlantik und gelangen auch nach 1-2 Jahren in die Nordsee und nach ca. 5 Jahren in die Ostsee. Krabben, Hummer, Muscheln und sogar Tauben in der Nähe der Anlagen überschreiten Grenzwerte für Nahrungsmittel. Erhöhte Blutkrebsraten beim Menschen, der am Ende der Nahrungskette steht, sind die Folge.
Der Dreck der angeblich sauberen deutschen Atomkraftwerke wird weitab der deutschen Öffentlichkeit in den Ärmelkanal und die irische See geleitet. Viele deutsche Atomstromproduzenten sind somit maßgeblich mitverantwortlich für die radioaktive Umweltverseuchung.
Dutzende Atomreaktoren rosten auf dem Grund der Weltmeere. Auch heute plädieren manche Experten noch dafür, brisante hochradioaktive Abfälle in den Schlammebenen im 5000 m tiefen Meeresboden zu vergraben. Inzwischen untersagt die ,,London Convention", der zahlreiche Staaten weltweit beigetreten sind das Versenken von Atommüll im Meer. Und seit 1996 liegt eine Resolution der Mitgliedsländer vor, nach der auch das Vergraben unter dem Meeresgrund verboten werden soll. Diese ist allerdings noch nicht ratifiziert.
Das Versenken von Schrott, Kriegsmüll, Industriemüll-Fässern:
Die Böden der Ozeane sind seit jeher Friedhöfe oder Schrottplatz der besonderen Art: Schrott/Kriegsmüll/Industriemüll-Fässer werden versenkt und ,,entsorgt". In der Nordsee stehen in den kommenden 10 Jahren rund 75 der bestehenden OffshoreAnlagen zur Verschrottung an. Die Brent Spar war nur ein Präzedenzfall.
57.435 Schiffwracks auf dem Meeresgrund werden gelistet. Darunter nicht nur die Titanic sondern auch heiße Eisen wie die Trümmer von Atom-U-Booten und ganze Kriegsflotten.
Die hohe See galt lange Zeit als ideale Endstation für manche Relikte. Nach dem 2. Weltkrieg kippten Militärs im großen Stil deutsche Munition - darunter auch Giftgasgranaten - in die Ostsee. Außerdem wurden nach Angaben des Hamburger Meeresforschers Hjalmar Thiel insgesamt 137.000 Tonnen chemischer Waffen im Nordatlantik versenkt. Auch in Friedensperioden rutschten brisante Abfälle auf den Meeresgrund: Bis 1982 wurden mehr als 200.000 Fässer schwachradioaktiver Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie westlich vor Nordspanien in über 5000 Meter Tiefe ,,entsorgt".
Erst seit 1993 sind das Versenken radioaktiven Abfalls, die Verklappung und Hochseeverbrennung von Industriemüll prinzipiell verboten - natürlich bietet die Politik auch hier Ausnahmen, wie z.B. Militärfahrzeuge. Das Portugal 1994 ein Transportschiff mit 2200 Tonnen Munition vor der eigenen Küste versenkt hat, war somit Rechtens. Außerdem sind nicht alle Meeresanrainer dem Vertrag beigetreten. Z.B. Israel: Bis Anfang 1999 ließ die Düngefabrik Haifa Chemicals jährlich 60.000 Tonnen eines hochgiftigen Gemischs mit Quecksilber, Blei, Cadmium, Arsen und Chrom in internationale Gewässern verklappen.
Die größte Gefahr für die maritimen Ökosysteme könnte indes auch das strikteste Abkommen gegen Müllversenkung nicht bannen. Ob Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, Pestizide, Phosphat und Nitrat - drei Viertel der Schadstoff-Fracht im Meer sind der alltäglichen Verschmutzung zuzuschreiben.
Verschmutzung über die Luft:
Ein weiterer Teil des Schadstoffeintrags erfolgt über die Luft, wenn Abgase von Autos, Ölheizungsanlagn und Chemieküchen abregnen oder Gase aus der Atmosphäre mit den Wassermassen in die Tiefe abtauchen.
Die folge der Schadstoffeinbringung, die Schädigung der Lebewesen, ist kaum zu überschauen.
Meerestiere nehmen die Gifte auf, oder es lagert sich mit den Sedimenten auf dem Meeresgrund ab. Die hormonell wirksame Chemikalien verursachen Verhaltens- und Fortpflanzungsstörungen, Immunschwächen und Krebs, sogenannte Langzeiteffekte. Der Überschuß an Nährstoffen vor allem durch die Schadstoffeinleitung (Eutrophierung) führt zur einer Vermehrung von Mikroorganismen, Bakterien und damit zur Algenvermehrung bzw. Algenplage. Diese bewirkt einen Sauerstoffmangel für Meerestiere und -pflanzen.
Wobei aber die Algenplage das Killeralge im Mittelmeer auf das konkrete Einschleppen soziologiefremder Lebewesen zurückzuführen ist.
Diese sogenannte Killeralge (taxifolia) ist z.B. aus dem ozeanographischem Institut in Monte Carlo entwichen. Da sie keine Freßfeinde hat zerstört sie unaufhaltsam Sedonia-Wiesen die Lebensgrundlage für sehr viele Arten sind.
Sie hat das Ökosystem Mittelmeer aus dem Gleichgewicht gebracht und ein Überspringen in den Atlantik und in die Tropen droht, wo sehr günstige Lebensbedingungen herrschen. (Gegenmaßnahme: Einsatz (ebenfalls Artfremder) Südseeschnecken, die nur Taxifolia fressen. Nebenwirkungen allerdings nicht kalkulierbar)
Schwermetalle , Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide), nicht abbaubare organische
Verbindungen usw. reichern sich in den Nahrungsketten an. Viele Meerestiere sind z.B. bis zu 7000 mal stärker mit dem Gift TBT belastet, als das Wasser in dem sie leben. (TBT = Gift, daß bei Herstellung von Schiffsanstrichen verwendet wird.) Dies kann zu erheblichen Mißbildungen, Verhaltens-, Wachstums- und Entwicklungsstörungen führen.
Insbesondere Muscheln filtern giftige Bestandteile . Sie sind Teil der Nahrungskette und werden wieder von Vögeln und anderen Tieren gefressen. Deshalb sind das Brutverhalten und die Bruterfolge vieler Vogelarten stark beeinträchtigt.
Über die Nahrungskette gelangen die Schadstoffe schließlich auch zum Menschen
Eine weitere Folge des Schadstoffeintrags sind regelrechte Epidemien V.a. ungereinigte Abwässer schleppen Krankheitserreger ein. Krankheitsepidemien unter der Meeresoberfläche nehmen dramatisch zu. Sie bedrohen die Artenvielfalt an Küsten und auf hoher See und könnten auch den Menschen gefährden. Meere sind Brutkästen für Cholera und Botulismus.
Viele Arten sind dem ,,Stress der Meere" (den Epidemien) bereits zum Opfer gefallen. Ein bisher unbekannter Erreger löschte z.B. die Art des karibischen Seeigels in den 80er Jahren praktisch aus. Es war eine der ersten gut untersuchten Unterwasser-Epidemien. Viren dezimierten die Anzahl der Seehunde in der Antarktis, Nordwesteuropa, Westafrika und dem Baikalsee . Viren wurden auch den Tümmlern vor der Küste von Nord-Ost-Irland, Delfinen im westlichen Mittelmeer und Sardinen in den Gewässern vor Südaustralien zum Verhängnis. Bakterien zehren an Floridas und Puerto Ricos Korallen. In der Karibik leiden die Korallen unter Pilzen und einem ,,Konsortium" von Mikroben. Die Pilzarten werden mit der Erde ins Meer gespült.
Schuld sind manchmal auch Krankheiten, die sich von einer Art auf die andere übertragen, etwa die Staupe, die von den Schlittenhunden der Antarktis und den sibirischen Haushunden auf Seehunde übersprangen. Das Massensterben der Sardinen vor Australien ließ sich auf ein Herpes-Virus aus dem importierten Futtermittel für Fischfarmen zurückführen.
Die Verunreinigung des Meerwassers und des Meeresbodens sowie der Strände erfolgt durch feste, flüssige oder gasförmige Schadstoffe. Sämtliche Verunreinigungen von Luft, Erdboden und Gewässern summieren sich in der Meeresverschmutzung; die Aufnahmefähikeit der
Meere ist wie die der Binnengewässer aber begrenzt, ebenso das Selbstreinigungsvermögen. (Die größte Schmutzmenge kommt mit den Flüssen ins Meer.)
Wegen mangelnder weiträumiger Durchmischung der Wasserschichten erfolgt ein Abbau der Schadstoffe, soweit das noch möglich ist, relativ langsam . Außer den Küstengewässern sind v.a. die verhältnismäßig abgeschlossenen und nicht sehr tiefen Meere gefährdet wie z.B. die Nord- und Ostsee und auch das Mittelmeer (Nordsee im Durchschnitt nur 70m tief, im Vergleich zum Atlantik, 3858 m) Dort ist die Zerstörung deshalb so weit fortgeschritten, weil es praktisch Binnenmeere sind, die sehr austauscharm sind und riesige Abwassereinzugsgebiete haben. Mittelmeer = Einzugsgebiet von 550Mio. Menschen
In der Nordsee beträgt die gesamte durch Öl und Chemikalienrückstände verschmutzte Fläche inzwischen bis zu 8.000 Quadtratkilometer.
Die gesamte Ostsee und große Teile des Mittelmeeres sind bereits so zerstört, daß sie Jahrhunderte brauchten um sich einigermaßen zu erholen, wobei z.B. die Gifte im Ostseeschlamm niemals wieder abgebaut werden. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten stehen weltweit vor dem Aussterben.
Nicht nur der Lebensraum der Meereslebewesen wird zerstört, sondern diese selber werden ausgebeutet.
Ein wichtiger Punkt bei der Verschmutzung der Meere ist auch der Tourismus: Unsere Interaktion mit den Weltmeeren erreicht ihren Höhepunkt an den 595.814 km langen Küstenstreifen der Erde: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung - über 2,7 Milliarden Menschen - lebt innerhalb einer Entfernung von 100 km von der Küste. Die Küstengebiete sind dynamische Regionen und die meisten sind für Wirtschaft und Umwelt von großer Bedeutung. Wir nutzen bzw. benutzen sie in vielerlei Hinsicht: Fischerei, Aquakultur, Mineralextraktion, Industrieentwicklung, Energieerzeugung, Tourismus und Freizeitgestaltung, und natürlich Abfallentsorgung.
409 Mio. Touristen am Mittelmeer (davon allerdings großer Teil sowieso aus dem Einzugsgebiet). Neben der hohen Verschmutzung der Küstengewässer ist vor allem der
,,Störungsdruck" auf Fauna (die Störung beim Laichen) durch Motor-Glieder, Motorboote etc. die Folge.
Die Verschmutzung, Zerstörung, Ausbeutung der Ozeane ist ein Beispiel für den ungeheuren Leichtsinn der Politik. Die Dimensionen, Risiken und Auswirkungen dieses Leichtsinns sind in keinster Weise einschätzbar/kalkulierbar.
Der Profit der Minderheiten hat immer noch die größte Einwirkung auf die Politik. Politiker müssen endlich den Mut haben, sich gegen die kurzsichtigen Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Einem Abkommen zum Schutz der Meere gegen jede Verschmutzung durch Abwässer oder Abfälle traten bisher zahlreiche Industriestaaten bei; eine nennenswerte Verringerung der Meeresverschmutzung wurde aber bisher nicht erreicht.
Der zerstörerische Umgang mit der Nordsee ist nur ein Beispiel für die rücksichtslose Ausbeutung der Natur. Viel zu leicht gerät in Vergessenheit, daß intakte und gesunde Ökosysteme kein Luxus, sondern lebensnotwendig sind.
Fischstäbchen für Europa
Die Einführung von Fangquoten sei kein Weg zum Schutz der Meeresfauna, küstennahe Zuchtstationen könnten dagegen eine Alternative sein. Als Ursache wird die Markt- und
Konkurrenzwirtschaft gesehen. Die Meeresforscherin Elisabeth Mann-Borghese, Tochter von Thomas Mann, beklagt den Raubbau: "Die Marktwirtschaft ist krank".
Sehr zweideutige Auswirkungen hat der Einsatz von Fabrikschiffen, z.B. vor den Küsten
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Bedeutung der Ozeane für die Erde und den Menschen?
Die Ozeane sind lebenswichtig für unseren Planeten, da sie über 70% der Erdoberfläche bedecken und den größten Lebensraum und die größte Biomasse darstellen. Sie sind auch entscheidend für die Regelung des CO2-Haushaltes, die Stabilisierung des Klimas und die Bereitstellung von Nahrungsmitteln. Die Ozeane bestimmen das Schicksal unseres Planeten. Sterben die Ozeane, bedeutet es das Ende aller Ökosysteme.
Wie sind die Ozeane entstanden?
Die heutige Verteilung von Land und Meer ist eine geologische Momentaufnahme. Alte Ozeane sind verschwunden und neue sind entstanden durch die Drift der Kontinentalplatten im Verlauf der Erdgeschichte. An den mittelozeanischen Rücken tritt basaltische Schmelze aus, die zu ozeanischer Kruste erstarrt. Der Meeresboden breitet sich von diesem Zentrum aus und wird schließlich in Subduktionszonen wieder verschluckt.
Welche sind die drei großen Weltmeere und was zeichnet sie aus?
Die drei großen Weltmeere sind der Pazifische Ozean, der Atlantische Ozean und der Indische Ozean. Der Pazifik ist der größte und tiefste, der Atlantik der zweitgrößte und der Indische Ozean der kleinste und geologisch jüngste. Jeder Ozean hat seine eigenen spezifischen geologischen Strukturen, Strömungssysteme und klimatischen Bedingungen.
Wie regeln die Meere den CO2-Haushalt der Erde?
Die Meere tauschen jährlich etwa 100 Milliarden Tonnen CO2 mit der Atmosphäre aus und enthalten etwa 60-mal so viel Kohlendioxid wie die Atmosphäre. Sie binden einen Großteil des Kohlendioxids, das durch menschliche Aktivitäten freigesetzt wird, und speichern gewaltige Mengen Kohlenstoff am Meeresgrund.
Wie beeinflussen die Ozeane das Klima?
Die Weltmeere bestimmen das Klima an Land. Sie transportieren Wärme aus den Tropen polwärts und Kälte von dort Richtung Äquator. Mit ihrer gewaltigen Masse speichern sie wie ein thermischer Schwamm riesige Mengen Energie und dämpfen Temperaturextreme. Die Ozeane beeinflussen nicht nur das Weltklima, sondern das Klima wirkt umgekehrt auch auf das Meer - ein Effekt, der wiederum Folgen für das globale Klima hat.
Welche Bedeutung haben die Ozeane für den Menschen in Bezug auf Fischerei und Rohstoffgewinnung?
Die Ozeane sind reich an Fischbeständen, die als wichtige Nahrungsquelle dienen. Zudem werden im Meer zahlreiche Mineralien, Erdöl und Erdgas gefördert. Die Förderung dieser Rohstoffe kann jedoch erhebliche Umweltbelastungen verursachen.
Welche Gefahren bedrohen die Ozeane?
Die Ozeane sind durch Verschmutzung, Überfischung, die Einleitung von Abwässern und Atommüll sowie die Ausbeutung von Rohstoffen stark gefährdet. Diese Gefahren bedrohen die Artenvielfalt, die Gesundheit der Ökosysteme und letztendlich auch die Lebensgrundlage des Menschen.
Wie erfolgt die Verschmutzung der Meere?
Die Verschmutzung der Meere erfolgt hauptsächlich durch Abwässer, Verschmutzungen bei der Rohstoffgewinnung, Sondermüll, Nährstoffe und radioaktive Stoffe. Ölverschmutzung, z.B. durch Tankerunglücke oder den Betrieb von Bohrinseln, stellt ebenfalls eine erhebliche Gefahr dar.
Was sind die Folgen der Verschmutzung für die Meereslebewesen?
Die Schadstoffe im Meerwasser und den Sedimenten reichern sich in den Nahrungsketten an und verursachen Verhaltens- und Fortpflanzungsstörungen, Immunschwächen, Krebs und Mißbildungen bei Meerestieren. Algenplagen, die durch Nährstoffüberschuss entstehen, führen zu Sauerstoffmangel und zum Absterben von Meeresorganismen.
Was kann getan werden, um die Ozeane zu schützen?
Um die Ozeane zu schützen, sind Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung, zur nachhaltigen Fischerei, zum Ausstieg aus der Atomenergie und zur Einschränkung der Rohstoffgewinnung erforderlich. Internationale Abkommen und ein Umdenken in der Politik sind unerlässlich, um die Meere zu erhalten und ihre Zerstörung aufzuhalten.
Welche Rolle spielt der Tourismus bei der Verschmutzung der Meere?
Der Tourismus trägt zur Verschmutzung der Küstengewässer und zur Störung der Meeresfauna bei, insbesondere durch Motorboote und andere Aktivitäten. Ein nachhaltiger Tourismus, der die Umwelt schont und die lokale Bevölkerung einbezieht, ist daher wichtig.
Was sind die Auswirkungen der Überfischung der Meere?
Durch das Überfischen der Ozeane sind bereits 60% der Fischarten ausgestorben. Wenn wir nicht endlich beginnen, die Meere wirklich zu schützen, dann wird die Artenvielfalt durch die Überfischung noch weiter ausgedünnt.
- Quote paper
- Daniel Herzog (Author), 2001, Die drei großen Weltmeere. Entstehung, Gefährdung, Schutz und ihre Bedeutung für den Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105365