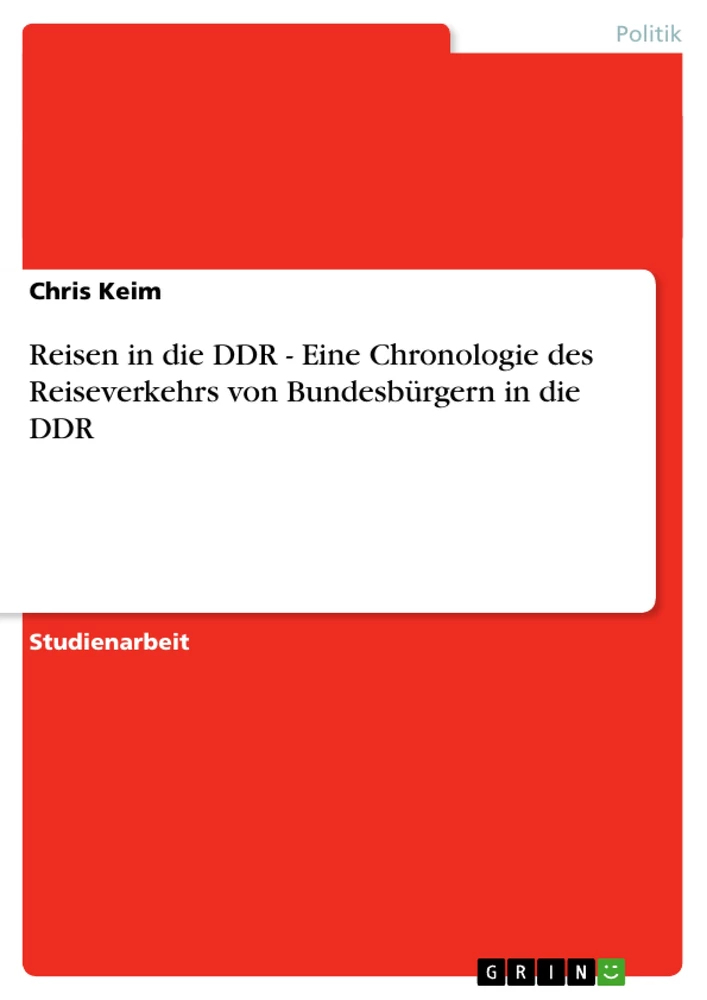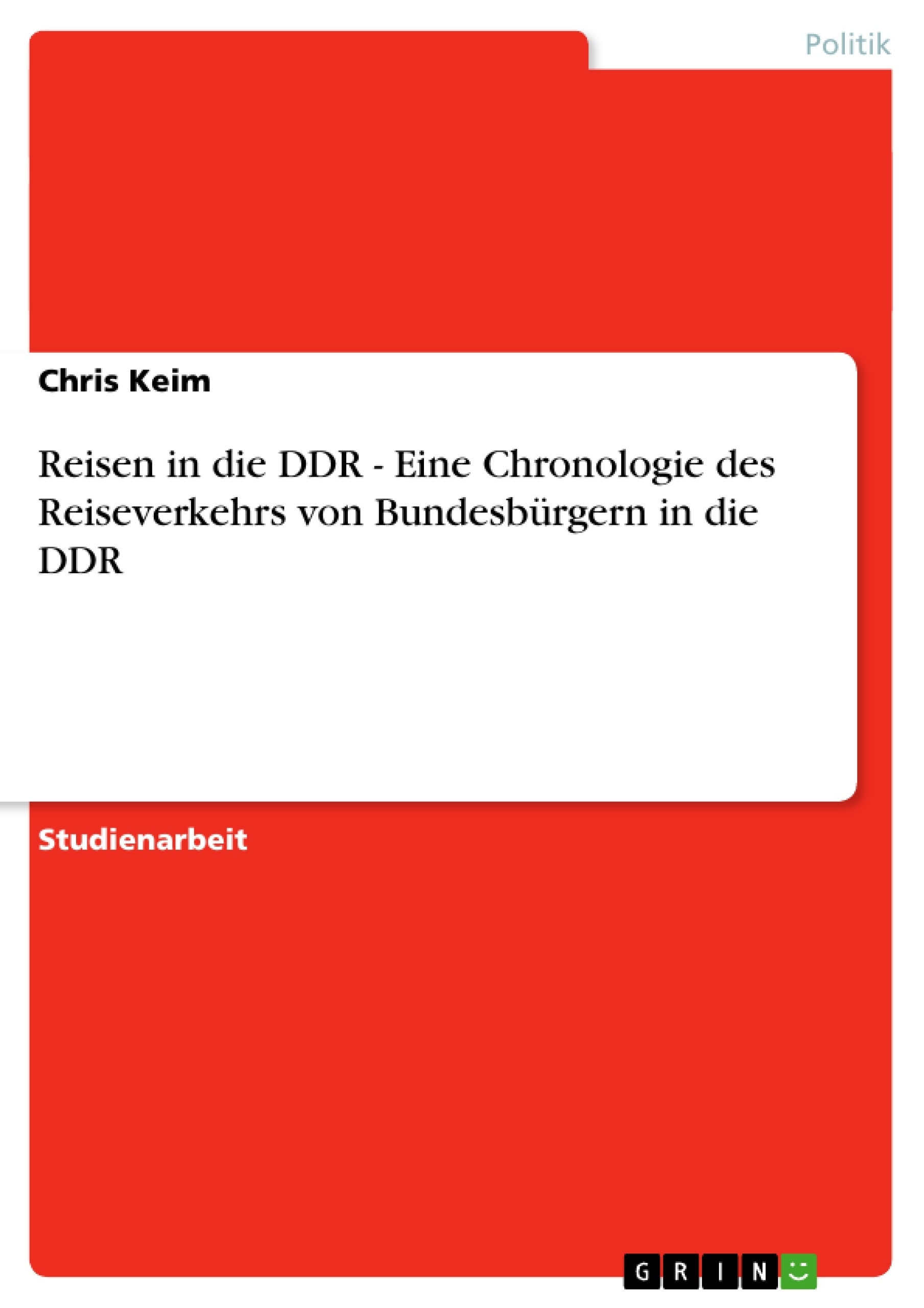Eine intrigueierende Reise in die Vergangenheit erwartet Sie, wenn wir die komplexen und oft widersprüchlichen Einreiseregelungen der DDR für Bundesbürger erkunden. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet die Entwicklung des Reiseverkehrs von den unmittelbaren Nachkriegsjahren bis zum Fall der Mauer, wobei der Fokus auf den Mechanismen liegt, die den innerdeutschen Tourismus prägten. Entdecken Sie, wie Interzonenpässe, das Grundgesetz und schließlich der Mauerbau selbst die Bewegungsfreiheit einschränkten und den Alltag der Menschen beiderseits der Grenze beeinflussten. Erfahren Sie mehr über die „Politik der menschlichen Erleichterung“ und die Bedeutung der Passierscheinabkommen, die kurzzeitige Besuche ermöglichten, sowie die Einführung des berüchtigten Mindestumtausches, der für viele Westdeutsche ein finanzielles Hindernis darstellte. Die Untersuchung der Verträge zum deutsch-deutschen Reiseverkehr, darunter das Viermächte-Abkommen, der Grundlagenvertrag und der Verkehrsvertrag, enthüllt die politischen und wirtschaftlichen Interessen, die hinter den Kulissen wirkten. Analysiert werden die Motive der DDR-Regierung, die zwischen dem Wunsch nach Deviseneinnahmen und der Angst vor ideologischer Unterwanderung schwankte. Es wird ebenso die Rolle der Bundesregierung beleuchtet, die stets um Reiseerleichterungen bemüht war, um die Verbindung zwischen den Deutschen im Osten und Westen aufrechtzuerhalten. Die letzten Jahre der DDR, geprägt von Gorbatschows Reformen und dem wachsenden Druck der Bevölkerung, zeigen einen schrittweisen Wandel in den Einreisebestimmungen. Diese Arbeit bietet nicht nur einen detaillierten Überblick über die historischen Fakten, sondern wirft auch ein Licht auf die menschlichen Schicksale und die ideologischen Grabenkämpfe, die den deutsch-deutschen Reiseverkehr zu einem Spiegelbild der Teilung Deutschlands machten. Tauchen Sie ein in eine Zeit, in der jeder Besuch eine politische Aussage war und jede Reise eine Herausforderung darstellte, und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die komplexen Beziehungen zwischen Ost und West. Der Leser erhält ein umfassendes Bild der Einreisebestimmungen, ihrer Auswirkungen auf die Reisenden und der zugrunde liegenden politischen und wirtschaftlichen Motive beider deutscher Staaten.
1 Inhalt
1 INHALT
2 EINLEITUNG
3 ENTWICKLUNG DES REISEVERKEHRS IN DIE DDR
3.1 ZWISCHEN DEM ZWEITEN WELTKRIEG UND DEM MAUERBAU
3.1.1 INTERZONENPÄSSE
3.1.2 AUSWIRKUNG DES GRUNDGESETZES
3.1.3 DER MAUERBAU
3.2 DIE PHASE DER „POLITIK DER MENSCHLICHEN ERLEICHTERUNG“
3.2.1 PASSIERSCHEINABKOMMEN
3.3 MINDESTUMTAUSCH
3.4 EINREISEREGELUNGEN IN DIE DDR NACH 1980
3.4.1 MÖGLICHE INTERESSEN DER DDR AN WESTBESUCHERN
3.4.2 REGELUNGEN IN DEN LETZTEN JAHREN DER DDR
4 VERTRÄGE ZUM DEUTSCH- DEUTSCHEN REISEVERKEHR
4.1 VIERMÄCHTE- ABKOMMEN
4.2 GRUNDLAGENVERTRAG
4.2.1 VERKEHRSVERTRAG
5 ZUSAMMENFASSUNG
6 LITERATUR
2 Einleitung
Aus meiner Kindheit sind mir manche Szenen von Besuchen mit der Familie in der DDR noch heute allgegenwärtig. Angefangen von den langen Reisevorbereitungen, den genauen Belehrungen der Eltern um zu verhindern, dass die Kinder nur keine Bücher oder Kassetten mit auf die Reise nehmen. Bis hin zu den stundenlangen Grenzkontrollen, die Anmeldung bei der örtlichen Dienststelle der Volkspolizei und all die völlig andersartigen Eindrücke. Dazu die Beschwerden vom Vater über all das viele Geld, dass er tauschen musste und mit dem er jetzt nichts anfangen kann alses zu verschenken.
Durch meinen Besuch des Seminars über die Geschichte der DDR wurden all diese Erinnerungen in mir wachgerufen. Daraus entwickelte sich mein Interesse an einer wissenschaftlichen Betrachtung dieses Themas, sprich des Reiseverkehrs zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
Dieses Thema in all seiner Ausführlichkeit zu bearbeiten würde zweifelsohne den Rahmen einer wissenschaftlichen Hausarbeit sprengen. Infolgedessen reduzierte ich den Inhalt dieser Arbeit auf eine chronologische Betrachtung der Einreiseregelungen für den Besucherverkehr in die DDR. Der Fokus der Betrachtung liegt auf der Zeit der ersten Hälfte des Bestehens der DDR. Dabei werden einzelne Regelungen, wie der verpflichtende Mindestumtausch und deren Auswirkungen auf die Besucherzahlen beschrieben.
Am Rande finden dabei Hintergründe der Geschehnisse, sowie Thesen und Mutmaßungen über die Interessen der beiden Staaten an einer großzügigen oder regressiven Besuchsregelung, Platz. Danach beschreibe ich kurz den für das Thema relevanten Inhalt des ViermächteAbkommens und des Grundlagen- bzw. des Verkehrsvertrages.
3 Entwicklung des Reiseverkehrs in die DDR
Bevor einzelne Aspekte im Zusammenhang des Reiseverkehrs von Bundesbürgern in die DDR genauer betrachtet werden, möchte ich kurz die geschichtliche Entwicklung des innerdeutschen Grenzverkehrs aufzeigen. Das folgende Kapitel ist naheliegenderweise chronologisch aufgebaut und nach Zeitabschnitten, die eine bestimmte Phase der prozesshaften Entwicklung beschreiben, eingeteilt.
3.1 Zwischen dem zweiten Weltkrieg und dem Mauerbau
Die Kapitulation des Deutschen Reiches vor den Siegermächten hatte 1945 die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen, und damit das fast gänzliche Erliegen des Reiseverkehrs der Deutschen, zur Folge. Dies betraf nicht nur den Reiseverkehr zwischen der sowjetischen und den westlichen Zonen, sondern auch Reisen innerhalb der Westzonen.
3.1.1 Interzonenpässe
Ab Ende 1945 begannen die Alliierten damit, sogenannte „Interzonenpässe“1 auszustellen, die den Besuch einer anderen Besatzungszone erlaubten. Auf der Vertrauensbasis aufbauend, die zu dieser Zeit noch zwischen den Besatzern bestand, stellte dabei die Militärregierung, die für den Wohnort des Antragstellers zuständig war, diese Pässe aus, die von den anderen betref- fenden Militärregierungen anerkannt wurde. Innerhalb der westlichen Besatzungszonen fielen die Reisebeschränkungen für Deutsche, durch die Vereinigung der britischen , französischen und amerikanischen Zonen zur Trizone, weg. Für den Reiseverkehr mit der Sowjetzone und nach Berlin blieb die Regelung der Interzonenpässe nach wie vor bestehen. Während der Ber- lin- Blockade der Jahre 1948/49 kam der Reiseverkehr über einen längeren Zeitraum völlig zum Erliegen. Grund dafür war, dass die Interzonenpässe von der sowjetischen Seite nicht mehr anerkannt wurden, was sich mit Beendigung der Blockade im Frühjahr 19492 wieder änderte.
3.1.2 Auswirkung des Grundgesetzes
Im Jahr 1949 wurde mit der Gründung der Bundesrepublik und der Ratifizierung des Grund- gesetzes jedem deutschen Bürger das Recht auf Freizügigkeit gewährt. „Soweit sie in der Bundesrepublik wohnten, bedurfte es für sie keiner besonderen Genehmigung, wenn sie in die
- inzwischen ebenfalls gegründeten - DDR reisen wollten. Soweit sie in der DDR wohnten, verlangte die Bundesrepublik keinerlei besondere Dokumente oder Genehmigungen, wenn sie in die Bundesrepublik kamen.“3 Innerhalb Berlins blieb diese Reisefreizügigkeit bis zum Ar- beiteraufstand am 17. Juni 1953 bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt fuhren noch die öffentli- chen Verkehrsmittel über die Zonengrenzen hinweg und viele Straßen verliefen barrierefrei zwischen den Zonen. Berlin nahm somit wiederum eine Sonderrolle ein. Hier konnten sich Bürger der Bundesrepublik und der DDR ohne Beschränkung im Ost - oder auch im Westteil der Stadt treffen.
Für das Gebiet der restlichen DDR dagegen wurde die im Zusammenhang mit dem Grundge- setz stehende Reisefreiheit schon nach wenigen Monaten beschnitten. Anfang der 50er Jahre wurde dort die Aufenthaltsgenehmigung eingeführt, „die für Besucher aus der Bundesrepu- blik Deutschland und aus West- Berlin Voraussetzung für Besuchsreisen waren“4. Zur Ertei- lung der Aufenthaltsgenehmigung mußten die zu Besuchenden bei der zuständigen Dienst- stelle der Volkspolizei für ihre Westbesucher einen Antrag stellen. Nur diese Aufenthaltsge- nehmigung erlaubte zusammen mit dem Paß den Grenzübertritt. Reisen in die DDR waren für westdeutsche Bürger nur möglich, wenn es sich um Verwandtschaftsbesuche handelte.5 Auch die Wahl der Verkehrsmittel für die DDR- Besucher wurde vorgeschrieben. Im Regelfall durften Besucher nur mit der Bahn in den Osten reisen. Die Verbindungen über die Grenze hinweg können als mangelhaft beschrieben werden.
In der Broschüre „Reisen in die DDR“ von der Friedrich Ebert Stiftung werden diese Vor- gänge folgendermaßen kommentiert: „Damit hatte sich die DDR zum Herrn des Verfahren gemacht, wer zu Besuch kommen konnte oder nicht“6. Die DDR- Regierung konnte somit problemlos die Besuchszahlen von Westdeutschen steuern. In diesen Jahren wurde der Besu- cherverkehr seit der Einführung der Aufenthaltsgenehmigung immer mehr eingeschränkt.
Genaue Daten über die Reisen von Bundesbürgern in die DDR liegen mir leider erst ab dem Jahre 1967 vor7.
Hintergrund dieser Einschränkung des Reiseverkehrs waren meiner Meinung nach vor allem die wirtschaftlichen Zusammenhänge dieser Tage in der DDR, die neben anderen Gründen in ihrer Konsequenz zur Totalschließung der Grenzen durch den Mauerbau führten. Die DDR- Führung um Walter Ulbricht musste eingestehen, dass der Fünf- Jahresplan mit dem Ziel der wirtschaftlichen Überrundung der BRD bis 1961 nicht eingehalten werden konnte. Durch seine Umwandlung in einen Sieben- Jahresplan wurde die wirtschaftliche Misere den DDR- Bürgern offenbart. Der Vergleich mit der aufblühenden Wirtschaft Westdeutschlands fiel für die DDR negativ aus.8 In dieser Zeit der Konsolidierung des Einparteienstaates, der Umwand- lung landwirtschaftlicher Betriebe in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) und des Personenkultes um Ulbricht war das Vertrauen der Bürger in die sozialisti- sche Ideologie immens wichtig.9 Der Verfestigung der sozialistischen Ideologie gegenläufig waren aus meiner Sicht die zahlreichen westdeutschen Reisenden, die die wirtschaftlichen Erfolge der Bundesrepublik, auch durch die mitgebrachten Waren, verkörperten und die eige- nen Schwierigkeiten erkennbar werden ließen. Ein naheliegender Schritt der DDR- Regierung war daher die Einführung von Reiseerschwernissen zur Eindämmung der Besucherströme in die DDR.
3.1.3 Der Mauerbau
Durch den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 und die totale Befestigung der Gren- zen zwischen den deutschen Staaten wurde jegliche Form der Kommunikation zwischen der DDR und der BRD für einige Zeit gänzlich unterbunden.10 Neben dem vordringlichsten Ef- fekt, den der Mauerbau für das DDR Regime erzielen sollte, der Unterbindung der Flucht von DDR Bürgern in den Westen und der Zementierung des Anspruchs auf einen eigenen Staat, löste die Abriegelung eine weitere, von Seiten der Regierung nicht unbeabsichtigte Reaktion aus. Der Reiseverkehr kam einige Monate vollständig zum Erliegen. Dadurch wurde ebenso der Zustrom der begehrten Westwaren in die DDR eingeschränkt. Die regierenden Sozialisten erhofften sich dadurch Unterstützung in ihrer ideologischen Erziehung der DDR- Bürger. So sollte jenen doch nahe gebracht werden, dass die DDR schon bald „eine konsequent durch- konstruierte kommunistische Welt sein würde, in der eine unvorstellbare Fülle von Waren und Dienstleistungen zum allgemeinen Nutzen zur Verfügung stehen ... würde“11. In dieser Ideologie wurden Bürger der Bundesrepublik als eine „vergleichsweise recht ungebildete Be- völkerung, die keineswegs in der Lage wäre, die neuzeitliche Technik auf allen Gebieten zu meistern“12, beschrieben. Dass die Realität eine andere war, wurde den sozialistischen Bür- gern durch die qualitative Hochwertigkeit und das große Angebot von Westprodukten offen- bar. Die Versorgung der DDR- Bürger mit Westwaren von Verwandten und Freunden erfolg- te in den Monaten der totalen Abriegelung der Grenzen durch den Paketverkehr, der in dieser Zeit spürbar anstieg.13
3.2 Die Phase der „ Politik der menschlichen Erleichterung “
Ein Bestreben der bundesrepublikanischen Regierung unter Ludwig Erhard war es in diesen brisanten Zeiten, mit der ständigen Bedrohung der militärischen Eskalation des Ost- WestKonflikts, die Folgen der Teilung für die Menschen zu mildern.
3.2.1 Passierscheinabkommen
Im Zuge dieser „Politik der menschlichen Erleichterung“14, auf die von Berlin aus der regie- rende Bürgermeister Willy Brandt ebenfalls drängte, kam es mit Zustimmung der Bundesre- gierung am 17. Dezember 1963 zu einem ersten Regierungsabkommen zwischen der DDR und dem Senat von West- Berlin über die Ausstellung von Passierscheinen für West- Berliner zum Besuch Ostberlins. „Damit öffneten sich den Westberlinern 28 Monate nach dem Bau der Mauer wieder, wenn auch personell und zeitlich begrenzt, die Übergänge zum Ostteil ih- rer Stadt“15. Die ersten Passierscheine wurden für die Weihnachtstage des Jahres 1963 ausge- stellt. Sie erlaubten Westberlinern den Besuch von Verwandten in Ostberlin. Nachdem der Versuch der DDR- Regierung, Passierscheinstellen in zwei S- Bahnhöfen zu eröffnen durch die Alliierten unterbunden wurde, entstanden zur Ausgabe der Passierscheine in den Westber- liner Bezirken 12 Büros. Dort nahmen Angestellte der Ostberliner Poststellen Anträge entge- gen und gaben die Passierscheine aus. Da tausende Antragsteller in eisiger Kälte vor den Bü- ros warten mussten, wurde nach Verhandlungen der beiden deutschen Staaten die Zahl der Postangestellten „von 83 auf 260 erhöht ... Nach offiziellen Angaben der DDR wurden insge- samt 1 318 519 Passierscheine für Besuche im Ostteil der Stadt ausgegeben.“16 Da das be- schriebene Passierscheinabkommen nur für einen begrenzten Zeitraum ausgehandelt war, folgten in den kommenden Jahren weitere Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Regierungen.17 Resultat war das Zustandekommen drei weiterer Passierscheinabkommen. Im Jahre 1955 scheiterten die Bemühungen des Berliner Senats, für den Herbst und Winter des Jahres ein neues Passierscheinabkommen auszuhandeln an „grundlegenden politischen Mei- nungsverschiedenheiten“18.
An dieser Stelle kann die nicht untersuchte These aufgestellt werden , dass die DDR- Regierung in das Passierscheinabkommen einwilligte, um durch den zu erwartenden wieder einsetzenden Besucherstrom und die damit eingeführten Westwaren die Versorgungslage zu stabilisieren. Denn zu dieser Zeit musste sich das Zentralkomitee der SED eingestehen, „dass die Versorgungslage trotz der nach dem Mauerbau abgegebenen Versprechungen nicht grundlegend verbessert werden konnte. Die Versorgungskrise hatte 1962 dramatische Ausmaße angenommen, inzwischen waren selbst Grundnahrungsmittel nicht mehr immer vorrätig, für Brot wurden wieder Schwarzmarktpreise verlangt“19.
3.3 Mindestumtausch
Für DDR- Reisende aus Westberlin verlangten die Ostberliner Behörden im Dezember 1964 erstmals im Rahmen des Passierscheinabkommens einen verbindlichen Mindestumtausch von 3.- DM pro Person und Tag. Dieser Betrag musste im Verhältnis 1:1 umgewechselt werden. Ein Rücktausch oder eine Ausfuhr des Pflichtumtausches ... <war> nicht gestattet.“20 Die Umtauschsumme wurde im Juli 1968 auf 5.- DM erhöht, wobei Rentner und Kinder von dieser Pflicht befreit waren.21
Ab November 1964 wurde die verbindliche Mindestumtauschsumme pro Person und Tag auf 10.- DM angehoben. Reiseerleichterungen wurden im Gegenzug durch das Inkrafttreten des Verkehrsvertrages vom 17.10.1972 wirksam. „Einwohnern des Bundesgebietes wird jetzt eine Reise in die DDR nicht nur zum Besuch von Verwandten, sondern auch von Bekannten, und zwar einmal oder mehrmals bis zu einer Dauer von insgesamt 30 Tagen im Jahr erlaubt.“22 Auch Touristenbesuche wurden durch die Bestimmungen des Verkehrsvertrages erstmals seit dem Mauerbau wieder möglich. Weitere Erleichterungen im Reiseverkehr brachte das Inkrafttreten des Grundlagenvertrags mit sich. Die Neuregelungen bezogen sich hier vorrangig auf Reisen im grenznahen Verkehr und in Berlin.23
Im Jahr 1973 erfolgte die Verdoppelung der Summe des verpflichtenden Mindestumtausches auf 20.-DM.24 „Gleichzeitig wurden die Vergünstigungen für Jugendliche und Rentner aufge- hoben. Begründet wurde dies mit wirtschaftlichen Argumenten. Die Massen von Besuchern, die nach den Reiseerleichterungen in die DDR strömten, müssten versorgt werden, wozu Im- porte von Lebensmitteln notwendig seien.“25 Hier kann wie an früherer Stelle wiederum ver- mutet werden, dass die Einführung dieser Reiseerschwernisse eine gezielte Aktion der DDR- Führung zur Eindämmung der westlichen Besucherströme war. Wie aus der unten abgebilde- ten Grafik deutlich wird, erlebte der Reiseverkehr im Jahre 1973 einen deutlichen Einbruch. Damit verbunden schrumpfte natürlich auch die Masse der mitgebrachten Westwaren, die scheinbar nur schwerlich in die Philosophie des Arbeiter- und Bauernstaates zu integrieren waren. Des- weiteren könnten als Begründung der Aktion „devisenpolitische Überlegungen der Regierung der DDR“26 angeführt werden. Hinterfragt werden müsste bei dieser These jedoch das Verhältnis vom vorhersehbaren Rückgang der Reisezahlen und den höheren pro Kopf Einnahmen.
Diese neuen Regelungen stießen verständlicherweise auf deutliche Kritik bei der Bundesre- gierung, die nicht zuletzt aus propagandistischen Gründen an einem regen Reiseverkehr in die DDR interessiert war. Durch ihre Bemühungen wurde der Betrag 1974 auf 13 Mark gekürzt, Jugendliche unter 16 Jahren und Rentner wurden wiederum durch die Härtefallklausel vom
Umtausch befreit.27 Die vorangegangenen Reiseerschwernisse wurden von der Bundesregie- rung „als krasser Verstoß gegen den Geist des erst wenige Monate zuvor in Kraft getretenen Grundlagenvertrags“28 gewertet. Der Inhalt des Grundlagenvertrags wird weiter unten genau- er beschrieben.
Abbildung 1: Reisen von Bundesbürgern in die DDR29
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus der Abbildung wird deutlich, dass die Rücknahme der Reiseerschwernisse einen deutli- chen Anstieg des Reiseaufkommens im Jahre 1975 zur Folge hatte. Gleichzeitig erfuhr die Regelung zur Mitnahme des eigenen PKW eine deutliche Liberalisierung. So mussten Rei- sende, die mit dem Auto aus der Bundesrepublik in die DDR einreisen wollten diesen Wunsch nicht mehr gesondert begründen. Hier kann wiederum vermutet werden, dass diese Liberalisierung nicht aus dem Interesse der DDR- Regierung an einer Reiseerleichterung für Westbürger entsprang. Vielmehr wurde ein Weg gefunden, die durch die Senkung des Zwangsumtausches niedrigeren Deviseneinnahmen wieder zu steigern. Denn gleichzeitig mit der Öffnung der Grenzen für Westautos wurde eine Straßenbenutzungsgebühr30 verlangt. Die bundesrepublikanische Regierung versuchte jedoch ihren Bürgern die Reisen in die DDR nicht durch das Entstehen neuer Kosten weiter zu erschweren und handelte deshalb mit der SED- Regierung die Zahlung einer Pauschale zur Straßenbenutzungsgebühr aus.
Einen weiteren deutlichen Einbruch erlebte die Zahl der DDR- Reisenden im Jahr 1980. Grund dafür war die radikale Erhöhung des Pflichtumtausches von 13.- auf „25.- DM pro Tag“31. Die Härtefallklausel für Jugendliche und Rentner wurde ebenfalls wieder aufgehoben. Aus der oben angeführten Abbildung wird deutlich, dass die Reisezahlen 1979 erstmals die 3,5 Millionenmarke überschritten hatten. Im ersten Jahr der Erhöhung des Zwangsumtausches fiel die Zahl der Reisenden aus der Bundesrepublik auf 2 Mio. zurück. Die DDR- Führung gab für diese Neuregelungen ökonomische Gründe an. Dagegenzuhalten ist, dass der eintre- tende Rückgang der Reisezahlen und die kürzere Aufenthaltsdauer die Devisengewinne der DDR aus den Tagessätzen weitgehend aufhob. Zusätzlich ging der Umsatz in den Intershop- läden zurück, die vorher stark von Westbesuchern frequentiert waren. Als andere Begründung für diese drastischen Reiseerschwernisse konnte ich in der mir vorliegenden Literatur ledig- lich die Andeutung finden, dass die Ausmaße des deutsch- deutschen Reiseverkehrs der DDR- Führung „wohl unheimlich geworden waren“32.
Die deutsche Bundesregierung unter Helmut Schmidt war in den folgenden Monaten bestrebt, die Verschärfungen im Reiseverkehr, die ebenso die deutsch- deutschen Beziehungen negativ beeinflussten, durch Verhandlungen mit der DDR- Regierung zu lockern. Nach anfänglicher Weigerung die Regelung zu ändern erreichte die Regierung Kohl erste Zugeständnisse Hone- ckers. 1983 wurden Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren (früher unter 16 Jahren) vom Mindestumtausch befreit. Am 25. Juli 1984 wurde der Pflichtumtausch von Alters- Invaliden und Unfallrentnern auf 15.- DM pro Tag gekürzt. Gleichzeitig wurde das Aufenthaltsrecht für Deutsche aus der Bundesrepublik in der DDR von ehemals 30 auf 45 Tage im Jahr erwei- tert.33 Die Besucherzahlen stiegen in den folgenden Jahren kontinuierlich an, im Jahr 1985 reisten schon 4,7 Mio. Bundesbürger in die DDR.34 Auf Grund der linearen Entwicklung, die nicht mehr durch Erschwernisse der Einreisebedingungen unterbrochen wurde, verzichte ich
auf die genauere Wiedergabe der betreffenden Daten. Interessant in diesem Zusammenhang scheint mir noch der Hinweis zu sein, dass in den statistischen Jahrbüchern der DDR, die in ihrer Gründlichkeit alljährlich unvorstellbare Datenmengen publizierten, keinerlei Eintragung über die Zahlen von Reisenden aus der BRD in die DDR zu finden sind.35
3.4 Einreiseregelungen in die DDR nach 1980
Ab Anfang der 1980er Jahre war die DDR von einer anhaltenden Wirtschaftskrise betroffen in deren Zusammenhang meiner Meinung nach auch einige Erleichterungen im deutsch- deut- schen Reiseverkehr dieser Jahre zu sehen sind. So berichtet etwa Ludwig Geisel, der im Kon- text kirchlicher Hilfslieferungen in die DDR in enger Beziehung zu den dortigen Entschei- dungsträgern stand, von Überlegungen der DDR- Führung, den Reiseverkehr zu intensivieren, um so die Einfuhr von in der DDR knappen Gütern durch die Besucher zu steigern.36 Begrün- det wird meine These auch durch die Einschätzungen nicht exakt benannter Quelle aus der SED. Hier wurde darüber beraten, wie man auf die knappen Kaffeevorräte und die erwogene Preiserhöhung reagieren sollte. „Auf eine Kontingentierung beim Verkauf von Röstkaffee im Einzelhandel ist zu verzichten, da eingeschätzt werden kann, dass durch die Erhöhung des Kaffeepreises um ca. 100% ein Rückgang des Kaffeeverbrauchs um ca. 25 bis 30 % zu erwar- ten ist. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass durch diese Maßnahmen eine Zunahme der Ver- sorgung der DDR- Bevölkerung durch andere Quellen, wie zum Beispiel den grenzüber- schreitenden Päckchen- und Paketverkehr ... erfolgen wird.“37
3.4.1 Mögliche Interessen der DDR an Westbesuchern
Unterstellt werden kann also, dass Reiseerleichterungen nicht als primäres Ziel der DDRPolitik anzusehen sind, was durch die vorrangig betriebene Abgrenzungspolitik bestätigt wird. Zugeständnisse in diesem Gebiet sollten daher eher als notwendiges Übel aus Sicht der DDR- Führung betrachtet werden. Als primäres Interesse könnten demzufolge die oben beschriebene Einfuhr knapper Güter und die Deviseneinnahmen durch den Warenverkehr, die 1987 stolze „1,6 Milliarden DM“38 betrugen, angesehen werden.
Die Beweggründe, die zu den Reiseerleichterungen und der gegenseitigen Annäherung der beiden deutschen Staaten führte, auf das Interesse der DDR an der Rohstoffversorgung und den Deviseneinnahmen durch Bundesbürger zu reduzieren wäre jedoch vereinfacht. Westliche Meinungsäußerungen in dieser Richtung „von Gegnern der gutnachbarschaftlichen Beziehun- gen zur DDR“ wurden vom zuständigen Bundesministerium als „vulgär materialistisches Denken“ bezeichnet, das vom „Fehlen jeder Solidarität mit den Deutschen in der DDR“39 gekennzeichnet sei. Meiner Interpretation folgend kann aus dieser Verurteilung ebenso das Interesse der Bundesregierung an einem regen grenzüberschreitenden Verkehr erkannt wer- den. Eine gewichtige Rolle spielt dabei mit Sicherheit die Überzeugung der DDR- Bevölke- rung von den Vorzügen des kapitalistischen Systems, sichtbar an dem in die DDR exportier- ten westlichen Warenangebot. Die Gegner von deutsch- deutschen Regelungen, die den Rei- severkehr erleichtern wurden als Verräter an den eigenen Landsleuten dargestellt.
Die Gründe, die die DDR- Regierung zu den Zugeständnissen im Reiseverkehr und der damit einhergehenden Intensivierung des deutsch- deutschen Verhältnisses bewegten, müssen neben dem genannten materialistischen Interesse um einige Punkte ergänzt werden. Nach Meinung der Friedrich Ebert Stiftung40 bestand ein Interesse der sozialistischen Regierung an
- der Herauslösung aus der Isolierung. Durch die internationale Anerkennung wollte die
DDR weltweit politisch handlungsfähig werden.
- der Friedenssicherung, die von der DDR schon aus ihrer geopolitischen Lage ange- strebt werden musste.
- dem Abbau von Minderwertigkeitskomplexen durch die Selbstdarstellung gegenüber Westbesuchern.
- der Ventilfunktion, die den angestauten Druck bei östlichen Jugendlichen, die seit dem
Mauerbau von der westlichen Welt abgeschlossen waren, nehmen sollte.
Auch bei diesen Ausführungen ist die westliche Sichtweise wiederum nicht zu leugnen. So würde ein Mitglied der DDR- Regierung die Behauptung des Vorhandenseins eines jahrzehn- telang andauernden Minderwertigkeitskomplexes wohl kaum unwidersprochen stehen lassen. Dieser interessante Gesichtspunkt kann in dieser Arbeit leider nicht weiter verfolgt werden, da nun wieder die weitere Entwicklung des Reiseverkehrs aus der Bundesrepublik in die DDR in den Fokus unserer Betrachtung rücken soll.
3.4.2 Regelungen in den letzten Jahren der DDR
Ein historischer Prozess in den Beziehungen der beiden deutschen Staaten wurde im März 1985 durch die Wahl Michael Gorbatschows als Generalsekretär der KPdSU eingeleitet. Ge- gen den Widerstand mächtiger Akteure der DDR- Führung gewann Gorbatschow mit seiner Politik zusehends mehr Anhänger in der DDR. Dass seine durch die Schlagworte „Perestroi- ka“ und „Glasnost“ in die Geschichte eingegangenen Reformbemühungen auch eine Annähe- rung an den Westen bedeuteten, wurde unter anderem durch Reiseerleichterungen im deutsch- deutschen Reiseverkehr sichtbar.
Als Reiseerleichterung können in diesem Zusammenhang neben den Härtefallregelungen41, die bestimmte Personengruppen vom Mindestumtausch befreiten, auch die „Erleichterungen für den touristischen Reiseverkehr in die DDR“42 aus dem Frühjahr 1989 gerechnet werden. Mit diesen Regelungen wurden erstmals Touristenvisa für Bundesbürger, die über ein Reise- büro gebucht hatten für das gesamte Gebiet der DDR gültig. Dadurch erhielten die Touristen die Möglichkeit zu spontanen Ausflügen in der weiteren Umgebung ihres Hotels ohne bei der Volkspolizei zusätzlich Anträge für eine Erweiterung der Aufenthaltsgenehmigung zu stellen. Bisher galt es nur für den Bezirk in dem der Tourist übernachtete. Somit wurden touristische Reisen den Besuchen bei Verwandten oder Bekannten gleichgestellt. Grundlage für diese Neuregelungen waren vorausgegangene Gespräche beim Besuch des SED- Generalsekretärs Honecker im September 1987 in Bonn. In einem gemeinsamen Kommuniqué wurde damals vereinbart, „Möglichkeiten für eine schrittweise Entwicklung des touristischen Reiseverkehrs zu schaffen“43.
Bewohner Westberlins konnten ab Anfang 1989 die Einreiseerlaubnis in die DDR direkt an den Grenzübergangsstellen erhalten. Der früher vorgeschriebene Stempel aus den Besucher- büros in Westberlin war nun nicht mehr Voraussetzung für den Grenzübertritt. Gleichzeitig wurde die Gültigkeit der Mehrfachberechtigungsscheine verlängert, die Übernachtungsrege-lung und die Dauer von Wochenendreisen ausgedehnt. Für Bewohner der Bundesrepublik wurde das Gültigkeitsgebiet für die Regelungen des grenznahen Verkehrs vergrößert.44
Parallel zu diesen Geschehnissen wurden auf der Konferenz zur Sicherheit und Zusammenar- beit in Europa (KSZE) einige Vereinbarungen getroffen, die zu einer „Verbesserung der Rah- menbedingungen“45 im Zusammenhang mit dem Reiseverkehr in die DDR führen sollten. Dazu gehörten:
- Der Ausbau der Infrastruktur für den Tourismus, speziell der Übernachtungsmöglich- keiten
- Die Abschaffung der „Diskriminierung ausländischer Touristen bei der Preisbildung“
- Vereinfachung der An- und Abreiseformalitäten
- Schaffung gemeinsamer Vorhaben im Tourismusbereich
- Erleichterung der Einrichtung von Städtepartnerschaften46
Einige dieser Vorgaben wurden in den folgenden Wochen, teilweise auch gegen den Wider- stand der DDR- Regierung in die Wege geleitet. Das galt insbesondere für Vereinbarungen, die den deutsch- deutschen Reiseverkehr betrafen. Darunter zählten insbesondere „Maßnah- men zur schrittweisen Abschaffung bestehender Mindestumtauschvorschriften“ und der Er- möglichung des „Rücktausch nicht benötigter Reisemittel“47. Die Umsetzung dieser Regelun- gen wurde natürlich durch die Ereignisse des Herbst 1989 überflüssig. Da durch Geschehnisse um die Flüchtlingsströme über Drittländer, die Grenzöffnung und schließlich die Wiederver- einigung in rasantem Tempo ein völlig neuer Prozess in Gang gesetzt wurde, kann die Be- trachtung der geschichtlichen Entwicklung des deutsch- deutschen Reiseverkehrs an dieser Stelle abgeschlossen werden.
Anschließend möchte ich noch für den Reiseverkehr von Bundesbürgern in die DDR bedeu- tende Verträge anhand ihrer, das Thema dieser Arbeit betreffenden Inhalte, genauer betrach- ten.
4 Verträge zum deutsch- deutschen Reiseverkehr
Anhand ihres für das Thema dieser Arbeit relevanten Inhaltes werden im Folgenden einige für den deutsch- deutschen Reiseverkehr wichtigen Verträge zwischen den beiden deutschen Staaten und Regelungen der DDR kurz beschrieben.
4.1 Vierm ä chte- Abkommen
Der amtierende US- amerikanische Präsident Nixon nahm bei einem Besuch in Westberlin die sich Ende der 60er Jahre zuspitzenden Konflikte zwischen der DDR- Führung und der Bundesregierung zum Anlass um die vier Siegermächte zum gemeinsamen Handeln gegen diese „nicht zufriedenstellende Situation“48 aufzurufen. Als Ergebnis resultierte aus den darauf folgenden mehrmonatigen Verhandlungen das Inkrafttreten des , in der DDR als Vierseitiges Abkommen bezeichneten, Viermächte- Abkommens am 03.06.1972.
Inhalt dieses Abkommens war unter anderem „Bestimmungen, die den Westsektor Berlins betreffen“. Darin wurde festgehalten, dass „Personen mit ständigem Wohnsitz in den West- sektoren Berlins ... in die Gebiete der Deutschen Demokratischen Republik ... aus humanitä- ren, familiären , religiösen, kulturellen oder kommerziellen Gründen, oder als Touristen .. reisen und sie besuchen können ... und zwar unter Bedingungen, die denen vergleichbar sind, die für andere in diese Gebiete einreisende Personen gelten.“49 In einer Erklärung der Bundes- regierung vom 3. September 1971 wurden die Auswirkungen des Viermächte- Abkommens auf den Reiseverkehr folgendermaßen interpretiert: „Die Bewegungsfreiheit der Einwohner von Berlin (West) wird vergrößert werden. Sie werden wieder den Ostteil der Stadt wie auch die DDR besuchen können.“50 Konkrete Regelungen betreffend der Reisen zwischen den Sektoren sollten von den zuständigen deutschen Behörden vereinbart werden. Auf diesen Grundlagen entstand eine Besuchsregelung für Ostern und Pfingsten 1972 in welcher neben Erleichterungen im Transitverkehr auch die Grenzübertrittsmodalitäten für „Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin“51 geregelt waren. Großartige Neuerungen brachten diese Regelungen jedoch nicht hervor. Es handelte sich dabei vielmehr um die Umsetzung der im Viermächte- Abkommen versprochenen Erleichterungen. Verdeutlichen möchte ich, dass sich
das Viermächteabkommen und die daraus resultierenden Regelungen lediglich auf die Bürger Westberlins, nicht jedoch auf Bürger der restlichen Bundesrepublik bezogen. Reiseerleichternde Vorschriften für Bürger des gesamten Bundesgebietes resultierten aus dem im Folgenden beschriebenen Grundlagenvertrag und dem Verkehrsvertrag, der aus den Verhandlungen zum Grundlagenvertrag hervorging.
4.2 Grundlagenvertrag
Am 21.06.1973 trat der „Vertrag über die Grundlagen der Beziehung zwischen der Bundesre- publik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik“52 in Kraft. In Teilen der Literatur ist auch die Bezeichnung Grundvertrag gängig. Nach den Worten Willy Brandts sollte dieser Vertrag „die Beziehung zwischen den beiden Staaten in Deutschland regeln, die Verbindung zwischen der Bevölkerung der beiden Staaten verbessern und dazu beitragen, bestehende Benachteiligungen zu verbessern“53. Danach sollten „die Vertragsparteien gut- nachbarliche Beziehungen zueinander entwickeln auf der Grundlage der Gleichberechti- gung“54. Fundamentale Regelungen des Grundlagenvertrages wie die gegenseitige Anerken- nung der Grenzen, der Souveränität beider Staaten oder der territorialen Integrität und des Gewaltverzichts bleiben in dieser Betrachtung außen vor. Dem Thema dieser Arbeit folgend ist hier der Punkt welcher zur Verbesserung der Verbindung der Bevölkerung beider Staaten interessant.
In Artikel 7 des Grundlagenvertrages wird die Bereitschaft beider deutscher Staaten angekün- digt, Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehung zu treffen.55 Zu diesen Regelungen zählt unter anderem auch das Ressort des Verkehrs, welches den Grenzübertritt mit ein- schließt. Im Zuge der Umsetzung dieser Regelungen teilte der Staatssekretär beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Dr. Kohl, dem Bundesminister für besondere Auf- gaben, Egon Bahr, die Öffnung von vier „Straßengrenzübergangsstellen an der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland für den Personenverkehr“56 mit. Dieser Vorgang bedeutete eine deutliche Erleichterung für die Bundesbürger im Reiseverkehr mit der DDR. Eine weitere Folge aus dem Grundlagenvertrag war die Gelegenheit für Bewohner des grenznahen Be-reichs der BRD „zu Tagesaufenthalten im grenznahen Bereich der DDR“57. Diesen Reiseer- leichterungen gegenläufig war die radikale Erhöhung der Pflichtumtauschsumme, die mit den darauf folgenden Einbrüchen in den Reisezahlen bereits in einem vorigen Kapitel besprochen wurden.
4.2.1 Verkehrsvertrag
Aufbauend auf den Verhandlungen zum noch nicht in Kraft getretenen Grundlagenvertrag brachte der Verkehrsvertrag von 1972 „eine rechtliche Klärung des Grenzübergangs zwischen beiden Staaten“58. So konnten im Zusammenhang mit dem Verkehrsvertrag weitere wichtige Erleichterungen für den Reise- und Besucherverkehr erreicht werden. Die im Verkehrsvertrag getroffenen Regelungen führten zu einer Ausweitung der Reiseerlaubnis für Besuche bei Be- kannten, nachdem zuvor nur Reisen zu Verwandten in dringenden Familienangelegenheiten erlaubt waren. „Auf Antrag von Verwandten und Bekannten aus der DDR genehmigten die zuständigen DDR- Behörden Besuchern aus der Bundesrepublik Deutschland jährlich einmal oder mehrmals die Einreise bis zu einer Dauer von insgesamt 30 Tagen.“59
Diese Regelungen bedeuteten zum ersten Mal in der Geschichte der beiden jungen deutschen Staaten eine Einreiseerlaubnis in die DDR für Bürger aus allen Teilen der Bundesrepublik aus privaten Gründen. Voraussetzung war lediglich eine Einladung der zuständigen Organe der DDR aus religiösen, kulturellen oder sportlichen Gründen. Erstmals konnten Touristenreisen infolge der Vereinbarungen zwischen Reisebüros der Bundesrepublik Deutschland und Rei- sebüros der DDR unternommen werden. Neu war außerdem, dass die Aufenthaltsgenehmi- gung jetzt in der Regel für das gesamte Gebiet der DDR galt. Früher durften sich Besucher aus der BRD nur in den in der Aufenthaltsgenehmigung bewilligten Kreisen der DDR aufhal- ten.60
5 Zusammenfassung
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde die Entwicklung des Reiseverkehrs in die DDR be- schrieben. Anfänglich durch Interzonenpässe, später durch das im Grundgesetz festgeschrie- bene Recht auf Freizügigkeit entwickelte sich in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg ein reger Besuchsverkehr zwischen den vier Besatzungszonen bzw. den zwei deutschen Staaten. Un- terbrochen wurde diese Entwicklung durch den Mauerbau, der den Besucherverkehr zum Erliegen brachte. In der Phase der Politik der menschlichen Erleichterung kamen verschiedene Passierscheinabkommen zustande, die Besuche für wenige Tage zuließen. Weitere Reiserleichterungen wurden durch die Regelungen des Viermächte- Abkommen umgesetzt. Dabei erfolgte die Einführung des Mindestumtausches, dessen Höhe im Laufe der Jahre stark differierte. Neuregelungen wie zum Beispiel die Verdoppelung des Mindestumtausches 1973 schlugen sich deutlich bei den Besucherzahlen nieder. Der Grundlagen- und der Verkehrsvertrag brachten weitere erleichternde Änderungen für den Besucherverkehr von der BRD in die DDR mit sich. In den 80er Jahren wurde der Reiseverkehr von der Bundesrepublik in die DDR durch die westlich orientierte Politik Gorbatschows, die auch in den Reihen der DDR- Führung Veränderungen brachte, beeinflusst. Ende der 80er Jahre kündigten sich weitreichende Veränderungen bezüglich des Reiseverkehrs an, die jedoch durch die bekannte geschichtliche Entwicklung, die zur Öffnung der Grenzen führte, überflüssig wurden.
Die Interessen der DDR- Regierung an einer restriktiven bzw. großzügigen Besucherregelung sollten nicht nur im finanziell- materiellen Bereich gesehen werden. Weitere mögliche Grün- de wurden in der Arbeit benannt. Vor allem ein ideologisches Interesse am regen Besuchs- verkehr auf der einen und am geringen Besucheraufkommen auf der anderen Seite, kann mei- ner Meinung nach beiden deutschen Staaten unterstellt werden. In diesem Zusammenhang wäre eine Überprüfung der aufgestellten und wiedergegebenen Thesen sinnvoll. Leider muss- te ich darauf verzichten, da dieser Punkt allein Inhalt einer separaten Hausarbeit darstellen könnte. Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch ein intensiverer Blick auf die politi- schen Zusammenhänge, die zu den jeweiligen Verschärfungen oder Erleichterungen im Rei- severkehr führten, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit und mit dem mir vorliegenden Mate- rial nicht möglich scheint.
6 Literatur
Baumann, Michael: Innerdeutscher Tourismus. In: Deutschland Archiv. Zeitschrift für Fragen der DDR und der Deutschlandpolitik. 5/1990, S. 750 - 756.
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.): DDR Handbuch. Bonn 1985, 3. Auflage.
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.): DDR Handbuch. Bonn 1979, 2. Auflage.
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.): Die Entwicklung der Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repu- blik 1969 - 1976. Bonn 1977.
Deutscher Taschenbuch Verlag (Hrsg.): dtv-Lexikon. Verschiedene Bände. München 1999.
Deutschland Archiv. Zeitschrift für Fragen der DDR und der Deutschlandpolitik. Verschiede- ne Veröffentlichungen in den Heften 3/1972 - 9/1989.
Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.): Reisen in die DDR - Realitäten, Argumente. Bonn 1985. Geißel, Ludwig: Unterhändler der Menschlichkeit. Stuttgart 1991.
Kampinsky, Annette: „Nieder mit den Alu- Chips“. Die private Einfuhr von Westwaren in die DDR. In: Deutschland Archiv. Zeitschrift für Fragen der DDR und der Deutschland- politik. 5/2000, S. 750 - 760.
Panskus, Hartmut(Hrsg.): Zweimal Deutschland. Fakten und Funde zur geteilten Lage der Nation. München 1986.
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Verträge, Abkommen und Verein- barungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati- schen Republik. Bonn 1973.
Statistisches Amt der DDR (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik ’90. Berlin 1990.
[...]
1 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung1985, S. 16
2 Vgl. etwa Deutscher Taschenbuchverlag (Hrsg.) 1999, Band 4, S. 96f
3 Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 17
4 Ebd. S. 17
5 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 634
6 Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 17
7 Vgl.: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S.634
8 Vgl.: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 1176 ff
9 Vgl.: Deutschland Archiv 5/2000 S. 754 f
10 Vgl.: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 152
11 Deutschlandarchiv 5/2000, S. 755
12 Ebd. S.755
13 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 19
14 Bundeszentrale für politische Aufklärung (Hrsg.) 4/1991, S. 10
15 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 795
16 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 796
17 Vgl.: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1977, S. 35
18 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 769
19 Deutschlandarchiv 5/2000, S. 755
20 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 25
21 Vgl.: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 796
22 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 201
23 Vgl.: ebd. S. 202
24 Vgl.: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 634
25 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 25
26 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 1150
27 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 26
28 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1979, S. 1150
29 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 15 und Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 634
30 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 26
31 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 634
32 Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 26
33 Vgl.: Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 27 f
34 Vgl.: List 1986, S. 45
35 Vgl. etwa Statistisches Amt der DDR 1990
36 Vgl.: Geißel 1991, S.236 ff
37 Deutschland Archiv 5/2000, S. 757 f
38 Deutscher Taschenbuchverlag 1999, Band 4, S. 94
39 Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 33
40 Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 33
41 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 634
42 Deutschland Archiv 9/1989, S. 1064
43 Ebd. S. 1064
44 Vgl.: Deutschland Archiv 9/1989, S. 1065
45 Deutschland Archiv 5/1990, s. 753
46 Vgl.: Deutschland Archiv 5/1990, S. 754
47 Ebd. S. 754
48 Bundesministerium für innerdeutsche Zusammenarbeit 1985, S. 170
49 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1973, S. 333
50 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1973, S. 368
51 Deutschland Archiv3/1972, S. 329
52 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1973, S. 17
53 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1985, S. 579
54 Deutscher Taschenbuchverlag 1999, Band 7, S. 221
55 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1973, S. 20
56 Ebd. S. 32
57 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1977, S. 34
58 Friedrich Ebert Stiftung 1985, S. 20
59 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1977, s. 34
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Abhandlung über den Reiseverkehr in die DDR?
Diese Abhandlung behandelt die Entwicklung des Reiseverkehrs in die Deutsche Demokratische Republik (DDR), insbesondere für Bürger der Bundesrepublik Deutschland (BRD). Sie beleuchtet die Zeit von nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Mauerfall und der Wiedervereinigung Deutschlands.
Welche Themen werden in der Abhandlung behandelt?
Die Abhandlung behandelt die Entwicklung des innerdeutschen Grenzverkehrs, Interzonenpässe, die Auswirkungen des Grundgesetzes auf die Reisefreiheit, den Mauerbau und dessen Folgen, die "Politik der menschlichen Erleichterung" und Passierscheinabkommen, den Mindestumtausch und dessen Veränderungen, sowie Einreiseregelungen in die DDR nach 1980. Darüber hinaus werden Verträge wie das Viermächte-Abkommen und der Grundlagenvertrag im Hinblick auf den Reiseverkehr analysiert.
Was waren Interzonenpässe und welche Rolle spielten sie?
Interzonenpässe wurden ab Ende 1945 von den Alliierten ausgestellt und erlaubten den Besuch einer anderen Besatzungszone. Sie waren ein frühes Mittel zur Regelung des Reiseverkehrs zwischen den Zonen, bevor dieser durch politische Entwicklungen und den Mauerbau stark eingeschränkt wurde.
Wie beeinflusste das Grundgesetz die Reisefreiheit?
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierte jedem Bürger das Recht auf Freizügigkeit. Dies bedeutete theoretisch, dass Bürger der BRD ohne besondere Genehmigung in die DDR reisen konnten und umgekehrt. Allerdings wurde diese Freiheit in der DDR bald eingeschränkt.
Welche Auswirkungen hatte der Mauerbau auf den Reiseverkehr?
Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 führte zur fast vollständigen Unterbrechung jeglicher Kommunikation zwischen der DDR und der BRD, einschließlich des Reiseverkehrs. Er symbolisierte die Teilung Deutschlands und die restriktive Politik der DDR-Regierung.
Was versteht man unter der "Politik der menschlichen Erleichterung"?
Die "Politik der menschlichen Erleichterung" war ein Bestreben der Bundesregierung unter Ludwig Erhard, die Folgen der Teilung Deutschlands für die Menschen zu mildern. Ein Ergebnis dieser Politik waren die Passierscheinabkommen, die West-Berlinern den Besuch Ost-Berlins ermöglichten.
Was waren Passierscheinabkommen?
Passierscheinabkommen waren Regierungsabkommen zwischen der DDR und dem Senat von West-Berlin über die Ausstellung von Passierscheinen für West-Berliner zum Besuch Ostberlins. Sie ermöglichten nach dem Mauerbau erstmals wieder Besuche, jedoch unter strengen Auflagen.
Was war der Mindestumtausch und wie hat er sich entwickelt?
Der Mindestumtausch war eine von der DDR erhobene Pflicht, wonach Besucher aus der BRD einen bestimmten Betrag (anfangs 3 DM, später bis zu 25 DM) in DDR-Mark umtauschen mussten. Die Höhe des Mindestumtausches variierte im Laufe der Zeit und hatte einen direkten Einfluss auf die Besucherzahlen.
Welche Rolle spielten das Viermächte-Abkommen und der Grundlagenvertrag im Reiseverkehr?
Das Viermächte-Abkommen regelte unter anderem den Reiseverkehr von West-Berlinern in die DDR. Der Grundlagenvertrag schuf die Basis für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der BRD und der DDR und ermöglichte Reiseerleichterungen, insbesondere für Bewohner der grenznahen Bereiche.
Welche Interessen hatte die DDR an Westbesuchern?
Die DDR hatte verschiedene Interessen an Westbesuchern, darunter Deviseneinnahmen durch den Mindestumtausch und den Warenverkehr, die Einfuhr knapper Güter durch die Besucher sowie das Bestreben nach internationaler Anerkennung und Friedenssicherung. Es gab auch ideologische Aspekte, die sowohl für als auch gegen einen regen Reiseverkehr sprachen.
Welche Faktoren führten zu den Reiseerleichterungen in den 1980er Jahren?
Die Reiseerleichterungen in den 1980er Jahren wurden unter anderem durch die Wirtschaftskrise in der DDR, die Politik Gorbatschows in der Sowjetunion und den Druck der Bundesregierung beeinflusst. Es gab Überlegungen, den Reiseverkehr zu intensivieren, um die Versorgungslage in der DDR zu verbessern.
Wie endete die Entwicklung des Reiseverkehrs in die DDR?
Die Entwicklung des Reiseverkehrs in die DDR endete mit dem Fall der Berliner Mauer und der anschließenden Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Die bis dahin geltenden Regelungen und Beschränkungen wurden obsolet.
- Quote paper
- Chris Keim (Author), 2001, Reisen in die DDR - Eine Chronologie des Reiseverkehrs von Bundesbürgern in die DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105351