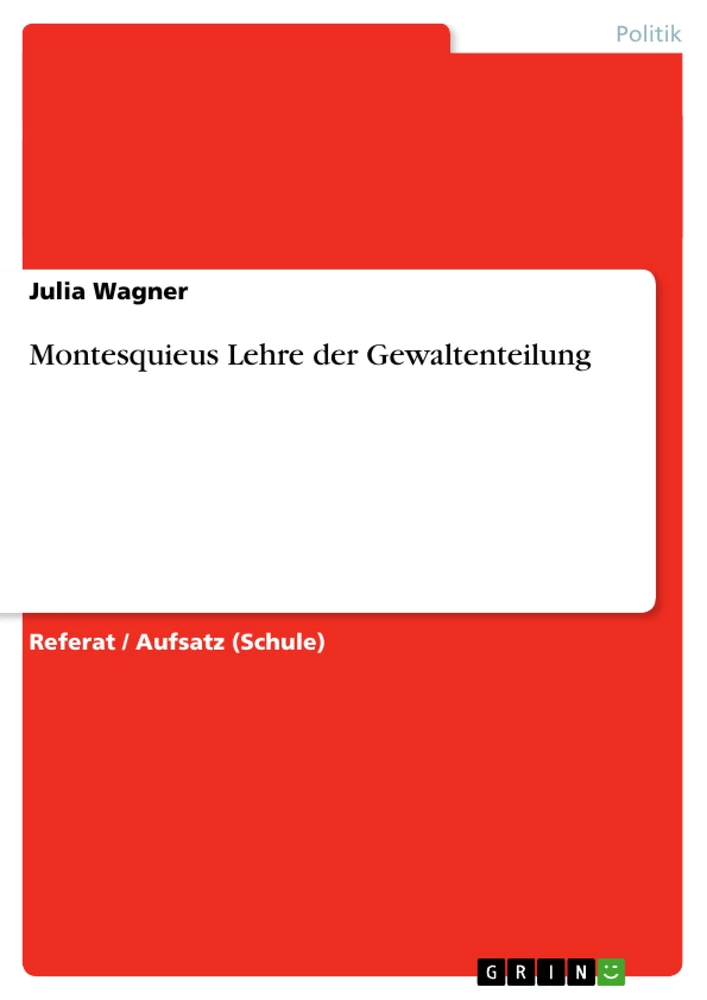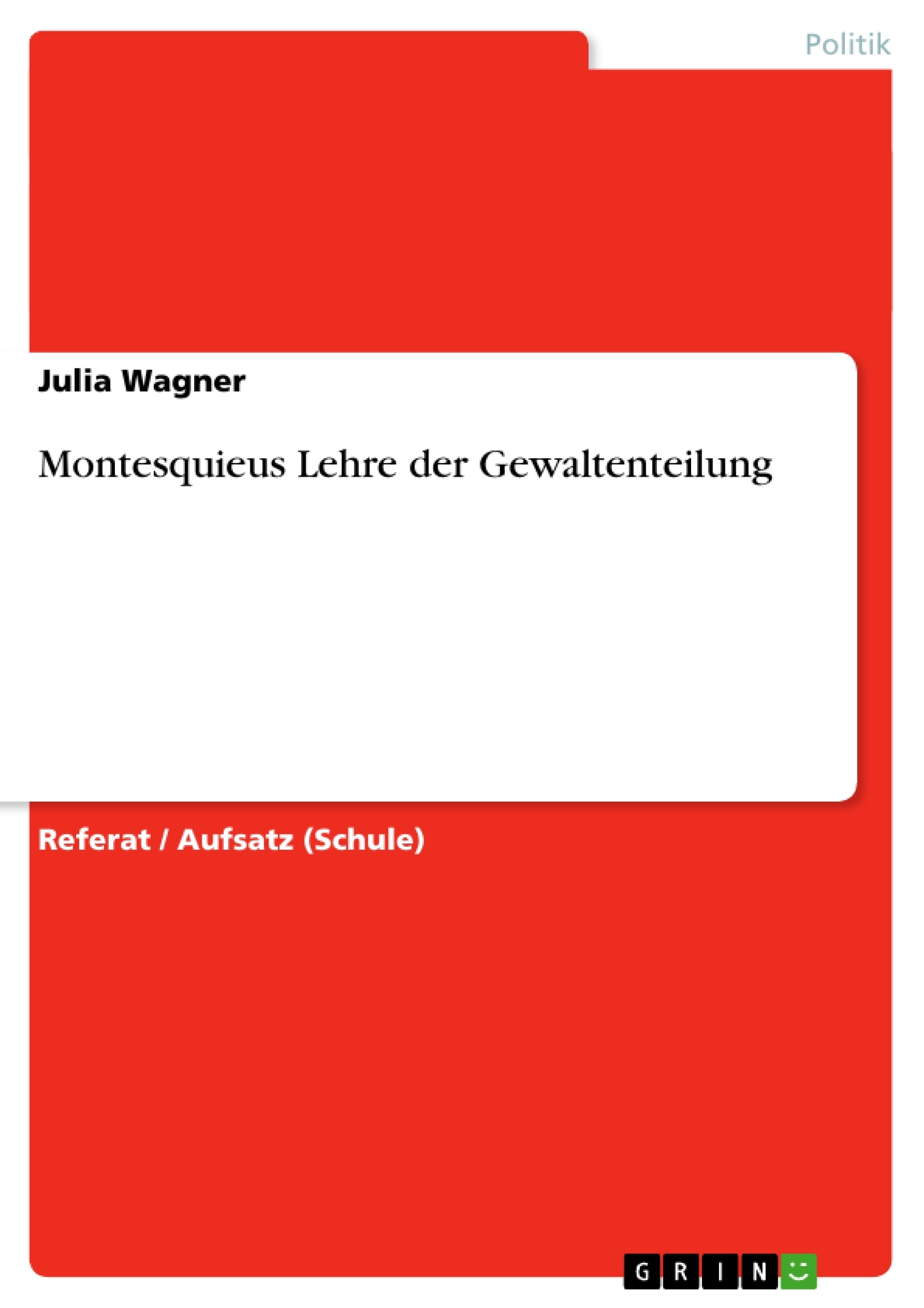Was wäre, wenn die Grundfesten unserer modernen Gesellschaft auf den Ideen eines Mannes ruhen, der vor Jahrhunderten lebte? Tauchen Sie ein in das faszinierende Leben und das revolutionäre Denken von Baron de Montesquieu, einem der einflussreichsten Köpfe der Aufklärung. Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet Montesquieus Werdegang, von seiner Kindheit in Frankreich über seine ersten politischen Erfahrungen bis hin zur Veröffentlichung seiner bahnbrechenden Werke. Entdecken Sie die Entstehung der "Persischen Briefe", einer satirischen Kritik an der französischen Gesellschaft aus der Perspektive eines Fremden, und verfolgen Sie Montesquieus Reisen durch Europa, die seine politischen und philosophischen Ansichten nachhaltig prägten. Im Zentrum steht eine detaillierte Untersuchung seines Hauptwerks "Vom Geist der Gesetze", einer umfassenden Abhandlung über Staatsformen, Gesetze und den Einfluss von Klima, Religion und Sitten auf die Gesellschaft. Ergründen Sie Montesquieus Ablehnung des Despotismus und sein leidenschaftliches Plädoyer für die Gewaltenteilung als Garant für Freiheit und Stabilität. Verstehen Sie die komplexen Zusammenhänge zwischen Gesetzgebung, Rechtsprechung und ausführender Gewalt, und wie diese sich gegenseitig kontrollieren sollen, um Machtmissbrauch zu verhindern. Analysieren Sie Montesquieus Vergleich mit England und seine kritische Auseinandersetzung mit den dortigen politischen Verhältnissen. Erfahren Sie mehr über die nachhaltigen Auswirkungen seiner Lehren auf die Verfassungen der Vereinigten Staaten von Amerika und Europas, insbesondere Deutschlands. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für politische Philosophie, Geschichte und die Ursprünge unserer modernen Demokratie interessieren. Es bietet einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt eines Visionärs, dessen Ideen bis heute relevant sind und unsere politische Landschaft prägen. Tauchen Sie ein in die Welt des 18. Jahrhunderts und entdecken Sie, wie Montesquieu die Grundlagen für eine gerechtere und freiere Gesellschaft legte – ein Vermächtnis, das bis heute nachwirkt und zum Nachdenken anregt.
Inhaltsübersicht
1 Einleitung
2 Das Leben und die Grundansichten des Montesquieu
2.1 Kindheit und Jugend
2.2 Erste politische Erfahrungen
2.3 Die Entwicklung einiger Studien und Werke
2.4 Die „Persischen Briefe“
2.5 Ein Anwalt auf Reisen
2.6 Seine größte Veröffentlichung
3 Das Hauptwerk des Baron
3.1 Ablehnung des Despotismus
3.2 Berücksichtigung aller Umstände
3.3 Verschiedene Gesetzesbegriffe
3.4 Der allgemeine Geist
3.5 Typische Staatsformen
3.6 Begriff der Freiheit
4 Gewaltenteilung
4.1 Die Grundsätze
4.2 Verteilung der Mächte
4.3 Zweck der Trennung
4.4 Im Vergleich mit England
4.5 Auswirkung der Lehre
5 Persönliche Stellungnahme
6 Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Baron de Montesquieu gilt als einer der originellsten Köpfe seiner Epoche. Seine Lehre, wie auch die von anderen Theoretikern, haben die Gedanken der Menschen im Bezug auf die Politik besonders vor und in der Zeit der französischen Revolution nachhaltig beeinflußt. Das kann man auch anhand der Beschlüsse der Nationalversammlung und schließlich an der daraus resultierenden ersten französischen Verfassung von 1791 sehen. Diese enthielt die Gewaltenteilung zwischen der parlamentarischen Legislative, Exekutive des Monarchen und unabhängiger Judikative als grundgesetzlichen Charakter. Im Deutschen Reich wurde die Trennung der Gewalten erst 1919 verwirklicht, ist aber heute noch in unserem Grundgesetz fest verankert und kann keinesfalls abgeändert werden. Ebenso erfuhr die britische Regierung durch einige Artikel im Buch „Vom Geist der Gesetze“ Veränderungen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land ohne monarchischer Tradition, wäre ohne Montesquieus System der Gewaltenteilung gar nicht vorhanden. Er wurde dafür in den USA sehr gefeiert und oft zitiert. Weiterhin brachten die Forschungen des Baron in der Soziologie1 einige Fortschritte, denn sein Gedankengut über die verschiedenen Lebensweisen und Eigenarten der Menschen wurde übernommen und weiterentwickelt. Heutzutage ist sein Name in vielen Büchern zu finden und einige Gelehrte berufen sich immer noch auf ihn. Es lohnt sich also, einmal einen näheren Blick auf diesen Menschen und seine Lehren zu werfen.
2. Das Leben und die Grundansichten des Montesquieu
2.1 Kindheit und Jugend
Am 18. Januar 1689 wurde Charles-Louis de Secondat de La Brède de Montesquieu auf dem Schloß La Brède in der Nähe von Bordeaux in Frankreich als ältester Sohn einer Familie, die dem geadelten Bürgertum angehörte, geboren. Sein Urgroßvater väterlicherseits wurde 1606 vom König Heinrich IV zum Baron gemacht. Mütterlicherseits stammte Montesquieus Familie von jeher aus dem englischen Adel. Seine Mutter Marie Françoise de Pesnel erhielt ein reichhaltiges Erbe, unter anderem auch das Schloß, auf dem ihr Sohn geboren wurde. Dies alles brachte sie mit in die Ehe mit Jacques de Secondat, der um dem Priesterberuf zu entgehen, in Ungarn dem Militär diente. Trotz dem Besitztum der Familie sollte der Sproß dennoch immer an seine Verpflichtungen gegenüber den Armen erinnert werden. Man kann sagen, dass beide verschiedenen Familientraditionen seinen Charakter und sein Handeln prägten. Bereits als er sieben Jahre alt war, starb seine Mutter und der junge Adlige wurde vier Jahre darauf auf ein Internat der Oratorianer in Juilly bei Paris gebracht und von Weltpriestern streng erzogen. Neben den üblichen Fächern wie Latein, Französisch, Geschichte, Mathematik und Geographie wurde er auch im Fechten und Tanzen und modernen Naturwissenschaften unterrichtet und erhielt einen Einblick in die Philosophie.
2.2 Erste politische Erfahrungen
Nach der Schule studierte der Franzose Rechtswissenschaft in Bordeaux und erhielt 1708 das Lizentiat, den akademischen Grad. Die folgenden fünf Jahre hielt er sich in Paris auf und beschäftigte sich unter anderem mit naturwissenschaftlichen Experimenten und nahm an den Sitzungen einiger Akademien teil, was ihn sehr anregte. Als 1713 Montesquieus Vater starb, kehrte er heim und wurde verantwortlich für seinen Bruder und seine zwei Schwestern. Kurz darauf heiratete er die Calvinistin Jeanne de Latrigue und erbte 1716 von seinem kinderlosen Onkel Jean Baptiste de Secondat die Baronie1 und einen Sitz im Parlament von Bordeaux, den sein Großvater einst selbst gekauft hatte. Eigentlich war dieses Parlament damals nur ein Gericht, doch seine politische Macht wuchs mehr und mehr. Man trug die Gesetze des Königs ein und kontrollierte sie, sogar so sehr, dass die Parlamente zum Widerstand gegen seine uneingeschränkte Herrschaft wurden. Als „Président à mortier“2 war der Anwalt nur ein paar Jahre nicht sehr erfolgreich, aber mit großer Ernsthaftigkeit gerade zu der Zeit im Amt, als diese Körperschaft nach dem Tod Ludwigs XIV an Bedeutung gewann. Die Erfahrungen, die er als Richter sammeln konnte, sollten später seinem Hauptwerk „Vom Geist der Gesetze“ zugute kommen. Vor allem muß man aber bemerken, dass der Schriftsteller so direkt an der Politik teilnahm und als Mitglied solch einer Körperschaft persönlich tätig wurde, was auf sein bisheriges Denken einige Auswirkungen hatte. Mittlerweile wurde er zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Bordeaux und hielt sogar selbst Vorträge.
2.3 Die Entwicklung einiger Studien und Werke
Weil sich Montesquieu sehr für Geschichte, außergewöhnliche Ereignisse in der Gesellschaft und Geographie interessierte, besorgte er sich mit Erlaubnis der Stadt Informationen aus der ganzen Welt, die auch in seinen späteren Werken eine große Verwendung fanden.
Der Schriftsteller lebte zur Zeit der Aufklärung und war auch ein wichtiger Vertreter dieser neuen Geistesbewegung, die sich gegen viele althergebrachte Weisheiten, Aberglauben und fanatische Religiosität wehrte. Den französischen Aufklärer Voltaire nannte er seinen Freund. Der Religion trat Montesquieu mit Nüchternheit, Vernunft und seinem rationalen Geist entgegen und untersuchte eher, inwiefern sie als Stütze der Gesellschaft diente und welchen Zweck sie in der Politik hatte, anstatt sich auf die Suche nach Gott in seinem eigenen Leben zu machen. Er benutzte wie andere Aufklärer seinen gesunden Menschenverstand und vertraute in den Fortschritt. Desweiteren machte der Soziologe seine von den Hochschulen sehr angesehenen Studien der Naturwissenschaften und Lebensvorgänge im Organismus von Pflanzen betreffend im Jahre 1721 publik.
2.4 Die „Persischen Briefe“
In Montesquieus Augen war die Welt ein Mechanismus, bei dem Ursache und Wirkung einen festen Zusammenhang hatten, den man genaustens erforschen mußte, wenn auch mit Hilfe einer gewissen Portion Skepsis. Gleich darauf veröffentlichte er angeregt durch den Kontakt mit einigen bedeutenden Wissenschaftlern noch im selben Jahr sein erstes literarisches Werk, die „Lettres persanes“. Diese Schriften wurden anonym in Amsterdam herausgegeben und erreichten ungeahnten Erfolg. Die „Persischen Briefe“ enthielten einen kritischen Bericht über das eigene Land aus der Sicht eines Fremden. Diese Idee war allerdings nicht neu, denn schon andere Schriftsteller benutzten fremde Nationalitäten, um aus der Ferne anonym ihr eigenes Land zu kritisieren. Montesquieus politisches Denken war vor allem von der Ablehnung des Despotismus, des Systems der Gewaltherrschaft, geleitet1, was auch daher kam, dass er mit dem Untergang der Monarchie groß geworden war. Seine Abneigung wurde in den Briefen durch die Schreiber Usbek, Rhedi und Rica deutlich, und obwohl er diese Herrschaftsform eher den Asiaten zuordnete, wurde auch der Absolutismus unter Ludwig XIV in Frankreich einbezogen und scharf kritisiert.
Weil die persische Art der Regierung bei den Franzosen hoch angesehen war, lag auf der Hand, dass es sie sehr interessierte, wie ein Perser ihre Heimat sah und dies war im Vergleich zwischen Abend- und Morgenland gut zu erkennen, speziell was die Rechts- und Staatsformen und die Lebensweise des Volkes anging. Alles, was bisher als alleine bewahrheitet existierte, wurde plötzlich mit anderen Dingen verglichen, wie zum Beispiel die Bibel mit dem Koran. Doch die besagten Schriften beinhalteten nicht nur Tadel an der Monarchie, allen Europäern, den Franzosen im Besonderen und der katholischen Glaubenslehre, sondern auch die Vorstellung einer Idealgesellschaft.
„Ein Thema, das in den Persischen Briefen ausführlich (...) behandelt wird, ist Montesquieus Ablehnung der Hobbesschen Lehre von der wechselseitigen Ungebundenheit der Individuen im Naturzustand und von der Gesellschaftsbildung der Menschen aus ursprünglicher Isoliertheit.“2 Der Historiker konnte sich nicht damit zufrieden geben, dass der Mensch sozusagen nur aus Verlangen und Trieben bestehen sollte, so wie es Hobbes als Naturzustand ansah, sondern sprach den menschlichen Lebewesen von vorne herein gute Eigenschaften wie Gesellschaftsfähigkeit zu. Der Verfasser des Buches, das nur ein Vorspiel seines Hauptwerkes war, blieb natürlich nicht lange unbekannt und Montesquieu erntete allerlei Bewunderung, erfuhr aber auch die Ablehnung der Jesuiten.
2.5 Ein Anwalt auf Reisen
Ab 1722 hielt sich Montesquieu wieder für drei Jahre in Paris auf, hielt in einigen Clubs Vorlesungen aus seinen Schriften, knüpfte neue Freundschaften mit gleichgesinnten Berühmtheiten und gab eine Menge Geld für das genüßliche Leben dort aus, bis er wieder nach Bordeaux reiste. Hier angekommen verkaufte er sein Amt, aus Geldmangel und um mehr freie Zeit zu haben.
Der Philosoph erweiterte seine Untersuchungen, brachte noch einige kleinere politische und staatsphilosophische Stücke heraus und reiste durch Österreich, Ungarn, Italien, Deutschland, die Schweiz und Holland. Der 1728 in die „Académie Française“ aufgenommene Schriftsteller geriet ins Nachdenken und sein Interesse für wichtige Persönlichkeiten im Handel , der Landwirtschaft und anderen Bereichen wurde geweckt. 1729 lernte er nach Frankreich das politische Leben und die Gesellschaft in England, wohin er durch seinen Freund Lord Chesterfield gelangte, kennen. Als Adliger und dank der „Lettres persanes“ war er auch in London angesehen und wurde 1730 zum Mitglied der „Royal Society“. In diesem Land, dessen Freiheit er bewunderte, verweilte er wiederum drei Jahre, bis es ihn noch einmal in die Heimat zog.
2.6 Seine größte Veröffentlichung
1734 erschien noch ein wichtiges Werk, die „Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence“1, dass ein Beweis dafür war, wie sehr sich Montesquieu mit der Geschichte der Römer beschäftigte, bevor er die Arbeit am Werk „De l’esprit des lois“ wieder aufnahm. 1748 erschien diese Schöpfung nach vierzehn anstrengenden Jahren als prächtige Ausgabe anonym in Genf und erntete erneut großen Erfolg, was nicht zuletzt an Montequieus brillanter Schreibweise lag. Jedoch gab es auch unterschiedliche Reaktionen darauf, so fand zum Beispiel Katharina II. großen Gefallen daran, während der Autor von strenggläubigen Christen angegriffen wurde. Einige Philosophen meinten sogar, das Werk sei parteiisch und sollte die Aristokratie unterstützen. 1750 wehrte Montesquieu sich gegen diese und andere Aussagen mit einer Gegenschrift. Persönlich schrieb Montesquieu für die Enzyklopädie nur einen Textabschnitt über Geschmack, aber eigentlich wurden auch andere Abschnitte dieser Wissenssammlung durch seine Staatstheorien indirekt beeinflußt.
Der weltoffene Schriftsteller, der sich jedoch stets auf seine Heimat besann, starb am 10. Februar 1755 im Alter von 66 Jahren in Paris und hinterließ der Nachwelt zahlreiche bedeutende Schriften.
3. Das Hauptwerk des Baron
3.1 Ablehnung des Despotismus
Obwohl sich Montesquieus politisches Denken eben durch die zahlreichen Erlebnisse und die Gewinnung neuer Eindrücke veränderte, blieb jedoch sein Hauptanliegen (neben dem naturwissenschaftlichen Interesse), die Ablehnung der Gewaltherrschaft, die er vor allem in Asien und Frankreich vergegenwärtigt sah, erhalten.
Der Schriftsteller sah als Grund für die Existenz dieser Herrschaft, dass in einem Staat die Macht in keinem Fall ausgeglichen zwischen dem Herrscher und seinen Untertanen verteilt sein könnte, da dies auf Dauer schwer zu realisieren sei. Weil ein Teil der beiden genannten immer mächtiger war, mußte der andere leiden, und das war oft das Volk. Diese Theorie wurde bereits in den „Persischen Briefen“ erwähnt, wie auch die Begründung, dass es in England wegen der ungeduldigen Gemütsart des dortigen Volkes nicht zum Despotismus kam. Der Theoretiker gab außerdem an, dass die Angst des Volkes vor Feinden oftmals selbst zu Diktaturen führe, da so ein innerer Zwang entstehe und dieser Zwang eine politische Freiheit immer ausschließen würde.
3.2 Berücksichtigung aller Umstände
„Vom Geist der Gesetze“ war das erste literarische Werk seiner Art, das zur damaligen Zeit erschien. Dieses Meisterwerk spiegelt den schöpferischen Geist seines Verfassers wider. Es beinhaltet hauptsächlich die Untersuchung, inwieweit das Staatswesen, juristische Einrichtungen, die Politik, die Produktionsmöglichkeiten, die natürlichen Gewohnheiten und geographisch bedingten und kulturellen Lebensweisen aller Nationalitäten miteinander in Verbindung stehen. Außerdem wird darin auch ein Blick auf den Glauben und die verschiedenen Persönlichkeiten der Menschen geworfen. Der Autor beäugt also sozusagen sowohl passive, wie auch aktive Umstände in den Ländern, um deren geschichtlichen Hintergründe, Ursprung und Folgen in Bezug auf die Entstehung der Verfassungen und Herrschaftsformen zu erforschen.
3.3 Verschiedene Gesetzesbegriffe
Am Anfang des Buches ist zugleich eine Definition zu finden : „Die Gesetze sind (...) die notwendigen Beziehungen, die aus dem Wesen der Dinge hervorgehen.“1 Und die Gesetze sind es auch, die im Buchtitel und den vielen enthaltenen Überschriften immer wieder auftauchen und generell eine entscheidende Rolle spielen, indem gegenseitige Abhängigkeiten aufgezeigt werden.
Zum einen schreibt Montesquieu von positiven Gesetzen der Vergangenheit und Gegenwart der Menschen. Es werden verschiedene Rechte des Abend- und Morgenlandes kurzgefaßt behandelt und verglichen. Auch macht der Theoretiker den Sinn des Rechts und der Schaffung neuer Gesetze zur Erhaltung der Ordnung eines Staates deutlich. Zum anderen spricht Montesquieu in seinem Hauptwerk von den negativen Gesetzen, nach denen die positiven gewertet werden. Dabei sieht er die Gesetze der Natur nicht mit gestrengem Auge, sondern versucht die Wirklichkeit der Dinge wahrzunehmen. Um dies zu verwirklichen sind eine genaue Beobachtung der Vielfältigkeit, ein Blick für das Außergewöhnliche, der Bedacht auf das Wohl der Menschheit und Toleranz von dem Philosophen gefragt.
Der dritte und letzte Gesetzesbegriff ist jedoch naturwissenschaftlich, modern und so ein völlig anderer. Hier wird die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung erläutert und versucht dies auf die menschliche Welt zu reflektieren.
Durch die Vermischung dieser drei genannten Gesetzesbegriffe im Werk „De l’esprit des lois“ kann der Leser allerdings nicht genau zuordnen, welcher Begriff jeweils vom Verfasser angesprochen wird. Montesquieu sieht die drei Begriffe nämlich als voneinander abhängig an.
3.4 Der allgemeine Geist
Montesquieu war nicht davon überzeugt, dass menschliche Organisationen von äußeren Umständen wie Klima abhängig sind. Er dachte sogar im Gegenteil, dass man gegen diese Einwirkungen etwas unternehmen kann. In einem Buch des Werkes „Vom Geist der Gesetze“ wird die Soziologie Montesquieus wie folgt zusammengefaßt: „Mehrere Dinge regieren die Menschen: das Klima, die Religion, die Gesetze, die Regierungsgrundsätze, die Beispiele der Vergangenheit, die Sitten, die Verhaltensweisen; daraus bildet sich ein esprit général.“1 Dieser hier genannte allgemeine Geist entwickelt sich aus dem Zusammenwirken einer Vielzahl verschiedener Faktoren und ist sehr robust. Die politische Theorie wird später auf den Punkt gebracht und es wird deutlich, dass der Schriftsteller danach trachtete, dass alles miteinander in Verbindung steht oder wenigstens ein kleiner Bezug der Dinge zueinander zu erkennen ist. Das Hauptwerk des Montesquieu beruht größtenteils auf Tatsachen und ist als Anleitung für Staatsmänner gedacht. Es macht auf politische Umstände aufmerksam und fordert zu mehr Menschlichkeit, Ausgleich und gegenseitigem Gleichgewicht auf.
3.5 Typische Staatsformen
Der Historiker betrachtet die außergewöhnlichen Ereignisse der Geschichte nicht nur detailliert, sondern sucht auch Gemeinsamkeiten, um sie zu typisieren. Anhand der einzelnen Typen wird ein besserer Überblick gewonnen. So wird auch bei den Staatsformen verfahren und man kann sagen, dass das Hauptwerk an Überlieferungen und Bräuche gebunden ist, jedenfalls soweit wie in den vielen Büchern der Staat und die Politik immer wieder betont werden.
Als typische Staatsformen gelten hier die Monarchie, wo eine Einzelperson die Macht hat, aber diese durch festgelegte Gesetze eingeschränkt wird und ohne Hilfe des Adels nicht funktioniert, die Despotie, wo ein Einzelner nach Lust und Laune herrscht, und die Republik, in der das Volk die Souveränität besitzt. Die Republik wird noch einmal geteilt in eine Herrschaft des Adels und in eine Herrschaft des Volkes. Nach der Meinung des Autors war letzteres eher ein kleiner Staat mit viel Landwirtschaft, was damals viele vertraten. Diese Einstellung änderte sich erst, als man auch immer mehr nach den Vereinigten Staaten von Amerika schaute.
Um diese Grundformen genau zu unterscheiden, benötigte Montesquieu die Information, wie viele Leute die Herrschaftsgewalt des Staates besitzen und welche Art der Regierung existiert. Das half ihm dabei, die europäischen Monarchien, wo Montesquieu auf eigene Erfahrungen zurückgriff, die altertümlichen Republiken, die er nur in der Antike als Ideal wiederfand, und den Despotismus in Asien begreifen zu können und diesen Staatsformen Grundsätze zuzuordnen. So stellte er fest, dass die Republik vor allem von Tugenden wie Heimatliebe, Bescheidenheit, Selbstlosigkeit, Mäßigung und Gleichberechtigung lebt, die Herrschaft eines Königs oder Kaisers als erstes Ehrgeiz, der von der Position der Person ausgehen kann, erfordert und die Gewaltherrschaft nie ohne große Angst vorstellbar wäre.
Das bedeutet also, dass alles auch mit den Untertanen und dem Umfang des jeweiligen Landes zu tun hat, und hier wieder eine große Abhängigkeit der Dinge voneinander auftaucht.
3.6 Begriff der Freiheit
Natürlich ist „Vom Geist der Gesetze“ nicht vollkommen objektiv, sondern beinhaltet auch die Meinung des Verfassers, der eben der absolute Gegner von Despotie und Befürworter der Freiheit war. Freiheit bedeutete aber bei ihm keinesfalls tun, zu was man gerade Lust hat, sondern ruhiges und sicheres Zusammenleben der Bürger mit dem Anspruch auf gewisse Rechte und innerhalb von Gesetzen: „Politische Freiheit besteht nicht darin, zu tun, was man will. In einem Staat (...) in dem es Gesetze gibt, kann die Freiheit nur darin bestehen, das zu tun, was man wollen soll, und nicht gezwungen zu sein, zu tun, was man nicht wollen soll.“1 Das kann nur in ausgeglichenen Regierungen, wo kein Machtmißbrauch stattfindet, der Fall sein und wird erzielt, indem alle bedeutenden Bevölkerungsschichten an der Herrschaft beteiligt sind und so die Mächte sich gegenseitig beschränken. Als bestes Beispiel diente dabei immer noch England, dessen auszeichnendes Charakteristikum die politische Ungebundenheit war und das dem Reisenden damals sehr vertraut wurde. Er benutzte die aktuelle, freiheitsbezweckende Verfassung dieses Landes, um sie zu verallgemeinern und ein Ideal zu entwickeln, dessen wichtigster Bestandteil die Trennung der Gewalten wurde.
4. Gewaltenteilung
4.1 Die Grundsätze
Es gibt drei Staatsfunktionen, die nach Montesquieu unbedingt geteilt werden müssen, und zwar nicht nur organisatorisch, sondern auch sozial. Das sind die Legislative, die für die Gesetzgebung und Abschaffung von Gesetzen existiert, die Judikative, die in Streitfällen oder bei Verbrechen richtet und die Exekutive als ausführende Gewalt, die auch Krieg oder Frieden stiftet und somit die innere und äußere Sicherheit aufrechterhalten soll.
Nach dem Philosophen müssen wirklich alle ganz voneinander getrennt von verschiedenen Gesellschaftsgruppen ausgeführt werden, um dem Machtmißbrauch von Herrschern vorzubeugen und dem Volk die Freiheit im Sinne von Rechtssicherheit zu garantieren, indem sich die staatlichen Mächte durch ihre Aufteilung auch gegenseitig kontrollieren können. So teilt Montesquieu jeder in der Gesellschaft und Politik bedeutsamen Macht eine spezielle Funktion zu, die jeweils wiederum die anderen Mächte beschränkt, so dass ein Ausgleich erlangt wird. Durch diesen Ausgleich der jeweiligen Gegenmächte sind die Gewalten eigentlich widersprüchlicher Weise auf eine Art doch miteinander verbunden, jedoch wie schon beschrieben nur zur Hemmung, also im rein negativen Sinne. Das ist unbedingt erforderlich, da eben nur Gegenmächte die Mächte beschränken können und nicht Weltanschauungen, Wertungen oder etwa die Religion.
4.2 Verteilung der Mächte
Seiner neuen Lehre nach ist der Monarch für die Exekutive am geeignetsten, da er so alleine schnell vollziehen kann. Er erhält aber auch ein Vetorecht bei der Gesetzgebung, gemäß der Idee des gegenseitigen Ausgleichs. Das Volk, womit jedoch nur Bürger gemeint sind, die auch in der Lage dazu sind und nicht „in einem solchen Zustand der Niedrigkeit leben, dass ihnen die allgemeine Anschauung keinen eigenen Willen zuerkennt“1, soll Repräsentanten wählen, die seinen Willen vertreten und mitsamt den Adligen die Legislative in die Hand nehmen. So liegt es an der Legislative, da sie aus zwei Häusern besteht, für die Interessen der Aristokratie genauso wie des Bürgertums einzutreten. Die Repräsentanten des Volkes sollen eine Art Interessengemeinschaft mit ihren Wählern bilden, damit ihre Entscheidungen auch vernünftig im Sinne des Gemeinwohls der Nation und unter Einhaltung der Menschenrechte gefällt werden können und aus den Gewählten keine Elite entsteht. Außerdem sind die Abgeordneten, die das Volk vertreten, und die Adligen eher verhandlungsfähig und in der Lage, entsprechend über Gesetze zu diskutieren und abzustimmen. Laut Auffassung des Baron ist das Volk leider weder in großen noch in kleineren Staaten dazu in der Lage, diese Legislative selbst direkt zu verrichten, was am Idealsten wäre, und so seien Repräsentanten für die Trennung der Gewalten dringend notwendig. Der Grundgedanke ist zudem, dass einem Machtmißbrauch vorgegriffen wird, indem die Repräsentanten und eben der Adel auch die Exekutive kontrollieren und umgekehrt. Legislative und Exekutive haben gleiches Gewicht. Die Judikative sollte der Justiz zugeschrieben werden, womit Gewaltherrschaft verhindert, aber hier kein spezieller Stand der Bevölkerung vertreten wird, da die Richter sozial nicht anders sind als die Beschuldigten.
4.3 Zweck der Trennung
Durch diese Teilung werden natürlich auch verschiedene soziale Interessen vertreten.
Montesquieu befürwortet zwar eine Monarchie, schränkt durch Gewaltenteilung die Macht des Königs allerdings ein, um das Wohl des Volkes in den Vordergrund zu stellen und absolutistische Absichten zu unterbinden. Ohne die Trennung ist die Freiheit der Bürger auf Dauer gefährdet, da sie nicht auf die Sicherheit im Land vertrauen können. Dabei sollte jeder sich soweit geschützt und in Ruhe gelassen fühlen können, dass er keinen anderen Mitbürger aus irgendwelchen Gründen fürchten muß. Die Souveränität im Staat liegt in der Einheit aller drei Gewalten, was eine Einigung derer voraussetzt. Es ist also erst einmal wichtig sich abzustimmen, bevor es zum Handeln kommt. Der bedeutendste Vertreter des europäischen Konstitutionalismus stellt so die Sicherheit der einzelnen Menschen über das Handeln der Herrschenden. Er behauptet außerdem, dass schon wenn nur zwei Gewalten, wie zum Beispiel Legislative und Exekutive, von der gleichen Person oder Körperschaft ausgeführt werden würden, die Balance der Kräfte zerstört sei und vollkommene Willkür und Tyrannei herrsche. Es müßte wenigstens die Rechtsprechung von Volk oder einem Gericht unabhängig ausgeführt werden, damit man noch von einer Monarchie sprechen kann und es nicht zur Gewaltherrschaft führt. Bei der Vereinigung von allen drei Gewalten sei alles total verloren.
4.4 Im Vergleich mit England
Solch eine Trennung der Gewalten gab es jedoch im England des 18. Jahrhunderts noch nicht. Das System der Volksvertretung im Parlament war noch nicht richtig ausgeprägt und der König besaß noch sehr viel Macht. Er konnte die Minister ernennen, wie er wollte, ( mußte die Wahl aber vom Parlament bestätigen lassen), und kontrollierte außerdem das Militär und die Beziehungen zum Ausland selbst. Im Gegensatz dazu hatte der König aber kein Vetorecht und so kann man eigentlich sagen, dass die größte Macht dennoch dem Parlament zugestanden war.
Montesquieu kritisierte England auch, denn „Korruption war mehr als alles andere der Hebel der englischen Politik“1. So sah der Baron in diesem Land das Geld immer wichtiger werden und die Tugenden der Menschen wie Freiheitsliebe in den Hintergrund verschwinden. Diese Tatsachen entsprachen natürlich nicht seinen Grundeinstellungen und so blickte der Theoretiker über diese Fakten hinweg, um eben seine Ideologie zu entwickeln. Er wollte schließlich ein Verfassungsprinzip entwickeln, das überall zur Anwendung kommen könnte und so war es auch nicht notwendig, Realitäten aus England widerzuspiegeln.
4.5 Auswirkung der Lehre
Im Vergleich zu John Lockes Lehre, nach der es nur Legislative und Exekutive gibt, die getrennt werden müssen, erscheint Montesquieus Verteilung der drei Gewalten, also der Judikative miteingeschlossen, bereits sehr fortschrittlich und hatte auf die Politik des westlichen Erdteils einen eindrucksvollen Effekt. Die konstitutionelle Monarchie, also eine Monarchie mit Verfassung, war die hervorstechende Eigenschaft für die Verfassung in Deutschland, die im 19. Jahrhundert entstand.
„Bis heute zählt die Unabhängigkeit der Justiz zu den staatsrechtlichen Grundsätzen der liberalen Demokratien.“1 Doch Legislative und Exekutive sind in Ländern, die eine Regierung mit Parlament besitzen, zu denen heute unter anderem auch Deutschland und England zählen, nicht getrennt, sondern werden von einer einzigen politischen Vereinigung zusammen ausgeführt. Ganz egal wie verschieden man aus heutiger Sicht Montesquieus Theorien beurteilt, seine Ansichten über die Freiheit sind immer noch bewahrheitet und es gibt sie nur dort, wo ein Ausgleich der Mächte existiert und Menschen mit unterschiedlicher Weltanschauung friedlich zusammenleben können.
5. Persönliche Stellungnahme
Wie aus einigen Quellen hervorgeht, besitzt das Buch „Vom Geist der Gesetze“ wohl kaum Struktur und es erscheint nicht ganz einfach, den Gedanken des sozialwissenschaftlichen Forschers zu folgen, wenn er seine Lehren etwas verstrickt schildert. Dies mag allerlei Gelehrte zu Kritik anregen, doch bleibt es eher unbedeutend, wenn man bedenkt, wieviel Einfluß Montesquieu ausübte und welche Veränderungen das mit sich brachte.
Er war als Aufklärer ein Freund der Menschen, der sich für das Recht auf Freiheit und die Gerechtigkeit im Staat einsetzte. Seine Theorie entwickelte er aus geschichtlichen Tatsachen und konzipierte etwas vollkommen Neues, was es in dieser Form vorher noch nicht gab. So bewies er mit seinen Veröffentlichungen auch viel Mut und man kann wohl sagen, dass Montesquieu eine sehr bewundernswerte Person seiner Zeit darstellt. Sein Name ist heute noch aktuell und das ist auch mit der Beweis für seine großen Leistungen. Es sind Leistungen, die von einem Menschen vollbracht wurden, ohne den unsere Gesellschaft heute vielleicht noch ein bißchen anders aussehen würde...
6. Literaturverzeichnis
Fetscher, I., Münkler, H., Pipers Handbuch der politischen Ideen 3 1 Neumann, F., Demokr. U. autor. Staat,S. 178
Forsthoff, E., Geschichte in Quellen, Band 3
Informationen zur politischen Bildung 165- Demokratie 1992
Maier, H., Rausch, H., Denzer, H., Klassiker des politischen Denkens II
Neumann, F., Demokratischer und autoritärer Staat
Nohlen, D., Lexikon der Politik, Band 1, Politische Theorien
[...]
1 Wissenschaft von Entwicklung, Ursprung u. Gefüge der menschl. Gesellschaft
1 Adelstitel: Baron de Montesquieu
2 Wörtliche Übersetzung: Präsident mit der Mütze; Vizepräsident des oberen Gerichts
1 Darauf werde ich in 3.1 noch näher eingehen.
2 Maier, H., Rausch, H. u. Denzer, H., Klassik. d. pol. Denk. II, S.48
1 Maier, H., Rausch, H. u. Denzer, H., a. a. O., S.49
1 vgl. Fetcher, I. u. Münkler, H., a. a. O., S.445
1 Maier, H., Rausch, H. u. Denzer, H., a. a. O., S.56
1 vgl. Fetcher, I. u. Münkler, a. a. O., S.450
1 Forsthoff, E., Geschichte in Quellen, Band 3, S. 714-718
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über Montesquieu?
Der Text ist eine umfassende Inhaltsübersicht und Analyse der Lehren und des Lebens von Baron de Montesquieu, insbesondere seines Hauptwerks "Vom Geist der Gesetze". Er behandelt Montesquieus Ablehnung des Despotismus, seine Betrachtung verschiedener Umstände, unterschiedliche Gesetzesbegriffe, den Begriff des allgemeinen Geistes, typische Staatsformen und seinen Begriff der Freiheit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gewaltenteilung und deren Grundsätzen, Verteilung der Mächte, Zweck der Trennung, Vergleich mit England und Auswirkungen der Lehre.
Was sind die Hauptthemen in Montesquieus Werk?
Die Hauptthemen umfassen die Ablehnung des Despotismus, die Bedeutung der Berücksichtigung aller Umstände bei der Gesetzgebung, verschiedene Gesetzesbegriffe (positive, negative und naturwissenschaftliche), der Einfluss des "allgemeinen Geistes" einer Nation, die Analyse typischer Staatsformen (Monarchie, Despotie, Republik) und der Begriff der Freiheit als ruhiges und sicheres Zusammenleben innerhalb von Gesetzen.
Was beinhaltet die Gewaltenteilungslehre von Montesquieu?
Montesquieu argumentiert für eine strikte Trennung der drei Staatsgewalten: Legislative (Gesetzgebung), Exekutive (ausführende Gewalt) und Judikative (Rechtsprechung). Er betont, dass diese Gewalten nicht nur organisatorisch, sondern auch sozial getrennt sein müssen, um Machtmissbrauch zu verhindern und die Freiheit der Bürger zu gewährleisten. Jede Gewalt soll die anderen kontrollieren und ausgleichen.
Wie vergleicht Montesquieu die Gewaltenteilung mit England?
Obwohl Montesquieu England für seine politische Ungebundenheit bewunderte, kritisierte er auch Aspekte wie Korruption und den wachsenden Einfluss von Geld. Er nutzte England als Beispiel, um seine Idealvorstellung einer Gewaltenteilung zu entwickeln, ging aber über die tatsächlichen Gegebenheiten in England hinaus, um ein allgemeingültiges Verfassungsprinzip zu schaffen.
Welche Bedeutung hat Montesquieu für die moderne Politik?
Montesquieus Lehre von der Gewaltenteilung hat die Politik des westlichen Erdteils maßgeblich beeinflusst. Sie ist ein grundlegendes Prinzip liberaler Demokratien und findet sich in Verfassungen vieler Länder wieder. Seine Ansichten über die Freiheit und die Notwendigkeit eines Ausgleichs der Mächte sind auch heute noch relevant.
Was waren Montesquieus "Persische Briefe"?
Die "Persischen Briefe" waren Montesquieus erstes literarisches Werk, veröffentlicht unter Pseudonym. Sie enthielten eine kritische Auseinandersetzung mit Frankreich und Europa aus der Perspektive fiktiver persischer Reisender. Sie kritisierten den Despotismus und Absolutismus und präsentierten Ideen einer Idealgesellschaft.
Wie waren Montesquieus persönliche und berufliche Erfahrungen?
Montesquieu wurde als Sohn einer adligen Familie geboren und studierte Rechtswissenschaften. Er war Mitglied des Parlaments von Bordeaux und sammelte dort politische Erfahrungen. Er reiste durch Europa, um verschiedene politische Systeme und Gesellschaften kennenzulernen. Diese Erfahrungen prägten sein Denken und flossen in seine Werke ein.
- Quote paper
- Julia Wagner (Author), 2001, Montesquieus Lehre der Gewaltenteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105329