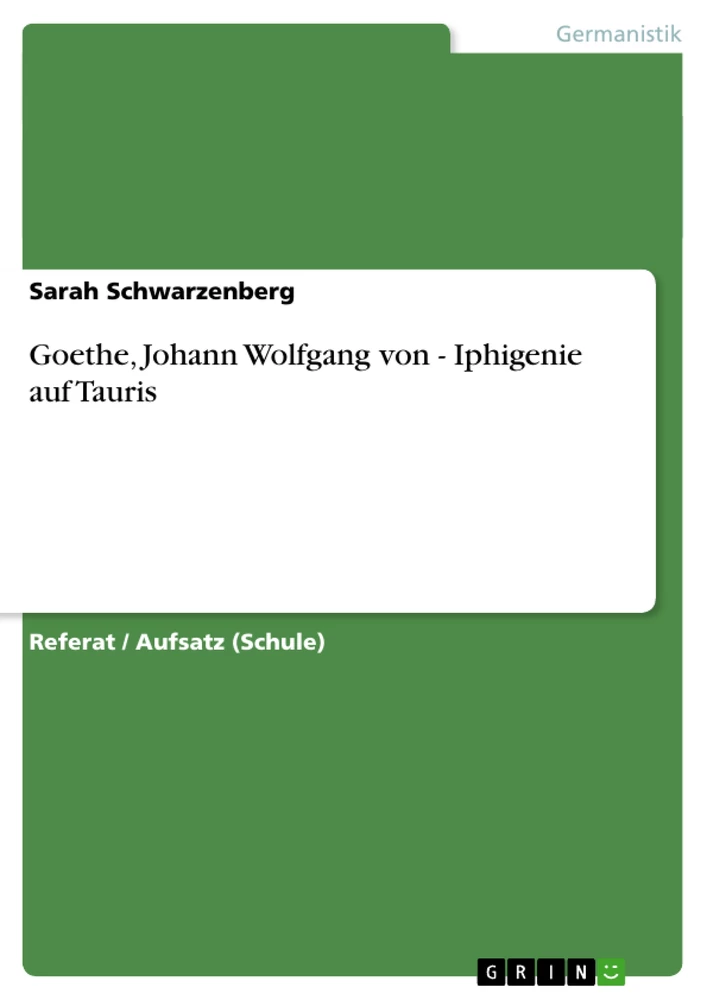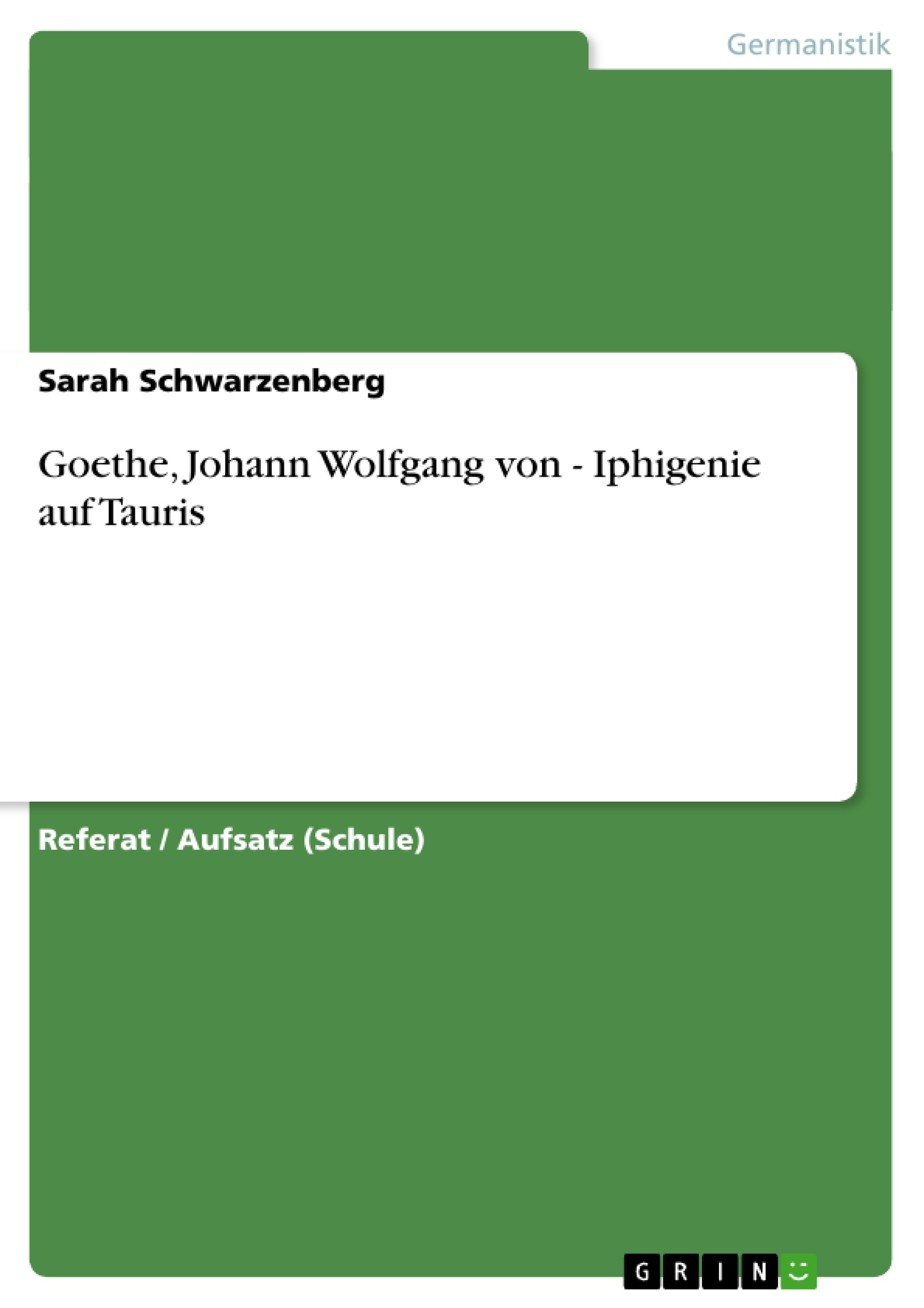Stellen Sie sich vor, eine Priesterin auf einer fernen Insel, gefangen zwischen göttlichem Dienst und dem Schmerz der Entwurzelung, entdeckt, dass das Schicksal noch dunklere Pläne schmiedet. Johann Wolfgang von Goethes "Iphigenie auf Tauris" ist mehr als nur ein Drama; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Idealen der Klassik, der menschlichen Natur und der Möglichkeit zur inneren Läuterung. Iphigenie, entrissen ihrer Heimat und dem Opfertod geweiht, findet sich als Hüterin eines Tempels auf Tauris wieder, wo sie widerwillig einem barbarischen Brauch dient. Als ihr Bruder Orest, geplagt von Schuld und Wahnsinn nach einem Muttermord, auf der Insel strandet, gerät Iphigenie in einen moralischen Konflikt. Soll sie ihre Pflicht erfüllen oder ihrem Bruder zur Flucht verhelfen? Goethes Meisterwerk, basierend auf dem griechischen Mythos von Aischylos und Euripides, entfaltet ein komplexes Geflecht aus familiären Verpflichtungen, göttlichen Gesetzen und dem Streben nach Humanität. Die "Iphigenie" thematisiert die Entwicklung des Individuums zur "schönen Seele" im Sinne des klassischen Menschenideals, die Harmonie zwischen Pflicht und Neigung, und die Kraft der Wahrheit als Weg zur Erlösung. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob in einer von Konflikten und Eigeninteressen geprägten Welt die Ideale der Aufklärung – Vernunft, Selbstbestimmung und Humanität – überhaupt Bestand haben können. Die klaren Blankverse und Jamben, die Einheit von Ort, Zeit und Handlung, sowie die intensive Charakterzeichnung machen dieses Drama zu einem zeitlosen Zeugnis der deutschen Klassik und zu einer bewegenden Reflexion über Schuld, Sühne und die Möglichkeit menschlicher Größe. Entdecken Sie die subtile Wortwahl Goethes, die den griechischen Einfluss widerspiegelt, und lassen Sie sich von den zu Sentenzen gewordenen Versen inspirieren. "Iphigenie auf Tauris" ist ein Schlüsselwerk, das die humanistische Weltanschauung der Klassik exemplarisch verkörpert und bis heute nichts von seiner Relevanz verloren hat. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Götter und Menschen, Mythos und Aufklärung in einem harmonischen Zusammenspiel verschmelzen und die Frage nach der Möglichkeit eines selbstbestimmten, ethisch verantwortlichen Lebens neu gestellt wird. Erleben Sie, wie Iphigenies Mut zur Wahrheit nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das von Orest und König Thoas entscheidend wandelt.
Gliederung:
I. Definition des klassischen Ideals
II. Drama: Iphigenie auf Tauris
1. Stoff der Antike
2. Personenkonstellation
3. Zusammenfassung des Inhalt
4. Form & Aufbau
5. Sprache & Wortwahl
III. Bedeutung des Dramas für die Klassik
1. Aufklärerischer Gehalt
2. Exemplarische Darstellung des klassischen Humanitätideals
a)Grundproblematik des Dramas
b)Lösung der Konflikte durch das klassische Menschenideals
c)Iphigenie als Verkörperung des Ideals der sittlichen Vollkommenheit (konstruiertes Drama)
Quellen: Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris, Reclam, 19751, Stuttgart Hrsg. Hermann Stadler: Texte & Methoden, Cornelsen, 19941, Berlin Wolf Wucherpfennig: Geschichte der deutschen Literatur, Ernst Klett Verlag, 19963, Stuttgart
I. Definition des klassischen Ideals (Humanität)
Weiterentwicklung des Menschenbildes der Aufklärung und des Sturm & Drang zum Ideal des humanistischen Menschen
~ Entwicklung des Individuums zur harmonischen Persönlichkeit, d.h. die Vorstellung eines Individuums in der Gesellschaft
~ höchste Stufe der Humanität, d.h. das klassische Menschenideal:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
➔ Ideal der „schönen Seele“
➔ äußere Erscheinung: „Grazie/ Anmut“
II. Drama: Iphigenie auf Tauris
1. Stoff der Antike: griechischer Mythos
- Aischylos: Orestie (500 v. Chr.)
- Euripides: Iphigenie bei den Taurern (5./6. Jhdt. v. Chr.)
2. Personenkonstellation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Inhalt
- Vorgeschichte:
~ zeitl. Hintergrund: Trojanischer Krieg
~ griech. Flotte unter der Führung König Agamemnons wird in Aulis von der Jagdgöttin Artemis durch eine Windstille von der Fahrt nach Troja abgehalten
~ im Gegenzug zur freien Fahrt fordert Artemis die Opferung Agamemnons Tocher Iphigenie
~ heimliche Rettung Iphigeniens bei der Opferzeremonie durch Artemis, die sie in einer Wolke nach Tauris bringt (alle anderen glauben, Iphigenie sei geopfert worden)
~ während I.s Abwesenheit: Mord ihres Bruders Orest an ihrer gemeinsamen Mutter Klytämnestra aus Wut über deren Gattenmord an Agamemnon
→ Verfolgungswahn Orests (Erinnyen)
- Einsetzen des Dramas
-Exposition (Entstehung des Problems)-
~ Iphigenie verrichtet fortan den Tempeldienst in Artemis‘ Tempel auf Tauris unter der Herrschaft von König Thoas → Sehnsucht nach der Heimat
~ sanftmütige Iphigenie schafft es barbarischen König aufgrund dessen Zuneigung zu ihr zu überreden, die Fremdenopfer abzuschaffen
→ Heiratsantrag, jedoch Ablehnung I.s ➔ Zorn Thoas‘
➔ Befehl zu Wiederaufnahme der Fremdenopferung
-Steigerung (Verkomplizierung des Problems)-
~ I.s Bruder Orest kommt mit seinem Gefährte Pylades im
Auftrag Apolls nach Tauris,um seinen Muttermord durch die Heimführung der Schwester zu sühnen.
(Missverständnis: Orest deutete „Heimführung der
Schwester“ zunächst falsch als den Raub des Kultbilds der Artemis,der Schwester Apolls, nicht die Heimführung seiner Schwester Iphigenie, von der er dachte, sie sei tot.) ~ werden von Thoas‘ Männern gefangen genommen, sollen geopfert werden
- Höhepunkt (Scheinbare Lösung des Problems)- ~ I. erfährt von Pylades von den Geschehnissen in ihrer
Abwesenheit (Fall Trojas, Morde in ihrer Familie), dass der von ihr zu opfernde Gefangene ihr Bruder Orest ist ~ Planung der Flucht sowie des Raubs des Kultbilds der Artemis
- retardierendes Moment (Verzögerung der Lösung des Problems)
~ jedoch Zwiespalt I.s: einerseits Wunsch nach Rettung, andererseits Mahnung des Gewissens zur Erfüllung ihrer Pflicht als Priesterin sowie der Verpflichtung gegenüber Thoas
~ fortschreitende Heilung Orests vom Wahnsinn (Hoffnung)
- Katastrophe (Lösung des Problems)-
~ Erfahren Thoas‘ vom Fluchtplan der drei (Verlust des Glaubens an das Gute im Menschen)
→ Befehl I. zu ihm zu bringen
~ nach anfänglichem Ausweichen I.s: Offenbarung des Fluchtplans
→ Legen des Schicksals aller in Thoas‘ Hände ( Sieg der reinen Seele)
~ Vermittlung I.s führt zur Verhinderung eines Duells zwischen Orest & Thoas
~ nach Eliminierung des letzten Hindernisses: Auflösung des Missverständnisses betreffend der „Heimführung der Schwester“
→ Erlaubnis Thoas‘ zur Rückkehr der drei nach Griechenland
4. Form & Aufbau des Dramas
- Kombination aus Blankvers und Jamben
- Aufbau des klassischen Dramas:
~ 5 Akte entsprechen Exposition, Steigerung, Wendepunkt, retardierende Moment & Katastrophe des Konflikts
~ Einheit von Ort (immer Hain vor Artemis´ Tempel), Zeit (ein Tag) & Handlung
- szenisch-theatralisches Werk, d.h. Entfaltung des Konflikts in Monolog & Dialog → Einbeziehen des Publikums
5. Wortwahl Goethes im Drama
- deutlich griech. Einfluss durch griech. Spracheigenheiten spürbar
~ Wortzusammenfassungen von Adjektiven oder Adverbien mit Partizipien:
Bsp.: „vielwillkommen“ (V.803)
~ Wortspiele (typisch für griech. Tragödiendichter) Bsp.: „eine Schandtat schändlich rächen“ (V.709)
- zu Sentenzen gewordene Verse des Dramas:
~ „Kann uns zum Vaterland die Fremde werden?“ (V.76) ~ „Ein edler Mann wird durch das Wort der Frau weit geführt.“ (V.213)
~ „Du sprichst ein großes Wort gelassen aus.“ (V.307)
III. Bedeutung des Dramas für die Klassik
1. Aufklärerischer Gehalt des Dramas:
(Erscheinung des Dramas kurz nach Kants „Kritik der reinen Vernunft“, 1781, und „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, 1784)
- Verdeutlichung des antiken Konflikts zwischen Götterspruch und menschlicher Selbstständigkeit (oft als Hybris verstanden) → Appell zu Eigenverantwortlichkeit des Menschen & Loslösung von Fremdbestimmung
→ Infragestellung der Machtstellung von Fürsten & Göttern
➔Humanisierung des griechischen Mythos´
- Umsetzung des Gedanken in die Klassik:
Idee der allseitigen Harmonie zwischen ~ Göttern & Menschen
~ Regenten & Regierten ~ Mythos & Aufklärung
→ Umsetzung der Antike in die moderne Zeit
2. Exemplarische Darstellung des klassischen Humanitätideals
a) Grundproblematik des Dramas:
- Thoas: einerseits barbarischer (Fremdenopfer) und pflichtbewusster(Nachkommen,Schutz desGötterbilds) König, andererseits Zuneigung zu Iphigenie
- Orest: einerseits Herbeisehnen des erlösenden Sühnetods, andererseits Wunsch nach fluchlosem Leben durch die Rettung seiner Schwester
- Iphigenie: einerseits Sehnsucht nach einem freien Leben mit dem Bruder in der Heimat, andererseits Pflichtgefühl gegenüber Thoas und ihrem Priesterdienst
b) Lösung der Problematik anhand des klassischen Menschenideals
- Thoas: durch Iphigenie vom Barbaren zu humanem Menschen verwandelt
- Orest: nach reuevoller Schuldanerkennung & Reifung
→ erhabenen Seele (im Affekt: edelmütiges Handeln)
- Iphigenie: Durchringen zu unbedingter Wahrhaftigkeit
→ schöne Seele
c) Iphigenie als Verkörperung des Ideals der sittlichen Vollkommenheit (konstruiertes Drama)
Grundfrage: Hat Humanität in einer von Sachzwängen & Eigennutz bestimmten Welt eine Chance?
Zwiespalt I.s: Flucht oder Pflichterfüllung?
schließlich: Neigung zur Pflicht (Offenlegung des Fluchtplans) ➔ schöne Seele (klassisches Menschenideal)
Johann Wolfgang Goethe
Iphigenie auf Tauris
(1787)
- griech. Mythos:
~ Aischylos: Orestie (500 v. Chr.)
~ Euripides: Iphigenie bei den Taurern (5./6. Jhdt.)
- Aufbau & Form:
~ Kombination Blankversen & Jamben ~ klassisches Drama:
- Einheit von Ort, Zeit & Handlung
- Unterteilung in Exposition, Steigerung, Wendepunkt, retardierendes Moment & Katastrophe
~ szenisch-theatralisches Drama, d.h. Entfaltung des Konflikts in Monolog & Dialog → Einbeziehung des Zuschauers
- Personenkonstellation:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Inhalt:
~ Vorgeschichte: Rettung Iphigeniens durch Göttin Artemis vor Opferung → bringt Iphigenie in ihr Heiligtum nach Tauris
(Aufgabe: Verrichtung des Tempeldienstes
→ Überreden Thoas‘ zur Abschaffung der Fremdenopferung)
~ Ablehnung von Thoas‘ Heiratsantrag (Sehnsucht nach der Heimat)
→ Befehl zur Wiederaufnahme der Fremdenopferung wegen gekränktem Herrscherstolz (zu opfernde Fremde- anfangs Identität nicht bekannt:
Orest & Pylades)
~ nach gegenseitigem Erkennen der Geschwister: Schmieden eines Fluchtplans ~ Zweifel Iphigeniens an der Flucht: Pflichtgefühl gegenüber Thoas sowie dem Priesterdienst
→ Offenbarung des Fluchtplans gegenüber Thoas
~ nach Vermittlungsgesprächen durch Iphigenie & der Ausräumung aller Missverständnisse: Erlaubnis Thoas‘ zum Verlassen der Insel Tauris
- Aufklärerischer Gehalt:
( Entstehung unmittelbar nach dem Erscheinen von Werken Kants)
~ Verdeutlichung des antiken Konflikts zwischen Götterspruch und menschlicher Selbstständigkeit (oft als Hybris verstanden) → Appell zu Eigenverantwortlichkeit des Menschen
& Loslösung von Heteronomie
→ Infragestellung der Machtstellung von Fürsten & Göttern ➔ Humanisierung des griechischen Mythos´
~ Umsetzung des Gedanken in die Klassik: Idee der allseitigen Harmonie
- Interpretation:
~ Wandlung der Hauptprotagonisten gemäß dem klassischen Humanitätideals
- Thoas: durch Iphigenie vom Barbaren zu humanem Menschen
verwandelt
- Orest: nach reuevoller Schuldanerkennung & Reifung
→ erhabenen Seele (im Affekt: edelmütiges Handeln)
- Iphigenie: Durchringen zu unbedingter Wahrhaftigkeit
→ schöne Seele
~ Iphigenie als Verkörperung des Ideals der sittlichen Vollkommenheit (konstruiertes Drama)
- Grundfrage: Hat Humanität in einer von Sachzwängen &
Eigennutz bestimmten Welt eine Chance?
- Zwiespalt I.s: Flucht oder Pflichterfüllung?
- schließlich: Neigung zur Pflicht (Offenlegung des Fluchtplans)
→ schöne Seele (klassisches Menschenideal)
Quellen: Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris, Reclam, 19751, Stuttgart
Hrsg. Hermann Stadler: Texte & Methoden, Cornelsen, 19941, Berlin
Häufig gestellte Fragen zu "Iphigenie auf Tauris"
Was ist das klassische Ideal (Humanität), das in "Iphigenie auf Tauris" dargestellt wird?
Das klassische Ideal, auch Humanität genannt, ist eine Weiterentwicklung des Menschenbildes der Aufklärung und des Sturm & Drang hin zum Ideal des humanistischen Menschen. Es beinhaltet die Entwicklung des Individuums zu einer harmonischen Persönlichkeit innerhalb der Gesellschaft und die Erreichung der höchsten Stufe der Humanität, die oft als "schöne Seele" bezeichnet wird. Äußerlich zeigt sich dies in "Grazie/ Anmut".
Welche antiken Stoffe beeinflussten Goethes Drama "Iphigenie auf Tauris"?
Goethe ließ sich von antiken Werken inspirieren, insbesondere von Aischylos' "Orestie" (500 v. Chr.) und Euripides' "Iphigenie bei den Taurern" (5./6. Jhdt. v. Chr.).
Wer sind die Hauptfiguren in "Iphigenie auf Tauris" und wie ist ihre Beziehung zueinander?
Die Hauptfiguren sind Iphigenie, Orest, Pylades und König Thoas. Iphigenie ist die Schwester von Orest, Pylades ist Orests Freund, und Thoas ist der König von Tauris, unter dessen Herrschaft Iphigenie als Priesterin dient. Das Dokument has a section labeled "Personenkonstellation" which indicates there is further explanation of their relationships available.
Wie lässt sich der Inhalt von "Iphigenie auf Tauris" zusammenfassen?
Im Trojanischen Krieg wird Agamemnons Flotte durch eine Windstille aufgehalten. Um freie Fahrt zu erlangen, fordert Artemis die Opferung von Agamemnons Tochter Iphigenie. Artemis rettet Iphigenie heimlich und bringt sie nach Tauris, wo sie im Tempel dient. Währenddessen tötet Iphigenies Bruder Orest ihre Mutter Klytämnestra. Orest reist nach Tauris, um von seiner Schuld befreit zu werden. Iphigenie, Orest und Pylades planen zu fliehen, aber Gewissensbisse plagen Iphigenie. Schließlich offenbart Iphigenie ihren Plan König Thoas, was zur Lösung des Konflikts und zur Erlaubnis der Heimreise führt.
Welche formale Merkmale weist das Drama "Iphigenie auf Tauris" auf?
Das Drama ist in Blankversen (ungereimten Jamben) geschrieben. Es folgt dem Aufbau des klassischen Dramas mit fünf Akten, die Exposition, Steigerung, Wendepunkt, retardierendes Moment und Katastrophe darstellen. Es hält die Einheit von Ort (Hain vor Artemis´ Tempel), Zeit (ein Tag) und Handlung ein. Der Konflikt wird hauptsächlich durch Monologe und Dialoge entfaltet, um das Publikum einzubeziehen.
Welche sprachlichen Besonderheiten finden sich in Goethes "Iphigenie auf Tauris"?
Goethes Wortwahl ist stark vom Griechischen beeinflusst, was sich in Wortzusammenfassungen und Wortspielen zeigt. Das Drama enthält zudem viele Verse, die zu Sentenzen geworden sind.
Welche Bedeutung hat "Iphigenie auf Tauris" für die Klassik?
Das Drama verdeutlicht den Konflikt zwischen göttlichen Geboten und menschlicher Autonomie und appelliert an die Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Es hinterfragt die Macht von Fürsten und Göttern und humanisiert den griechischen Mythos. "Iphigenie auf Tauris" strebt nach einer allseitigen Harmonie zwischen Göttern und Menschen, Regenten und Regierten sowie Mythos und Aufklärung.
Wie wird das klassische Humanitätsideal in "Iphigenie auf Tauris" dargestellt?
König Thoas wandelt sich vom Barbaren zum humanen Menschen durch Iphigenies Einfluss. Orest erfährt nach reuevoller Schuldanerkennung eine Reifung zu einer erhabenen Seele. Iphigenie entwickelt sich durch ihren Wahrheitsanspruch zu einer "schönen Seele".
Wie verkörpert Iphigenie das Ideal der sittlichen Vollkommenheit?
Iphigenie steht vor der Frage, ob sie fliehen oder ihre Pflicht erfüllen soll. Sie entscheidet sich letztendlich für die Pflichterfüllung, indem sie ihren Fluchtplan offenbart. Dadurch verkörpert sie das klassische Menschenideal der "schönen Seele".
Wo finde ich die Quellen, auf die sich die Analyse von "Iphigenie auf Tauris" bezieht?
Die Analyse bezieht sich auf folgende Quellen: Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris, Reclam, 1975, Stuttgart; Hermann Stadler (Hrsg.): Texte & Methoden, Cornelsen, 1994, Berlin; Wolf Wucherpfennig: Geschichte der deutschen Literatur, Ernst Klett Verlag, 1996, Stuttgart.
- Quote paper
- Sarah Schwarzenberg (Author), 2001, Goethe, Johann Wolfgang von - Iphigenie auf Tauris, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105281