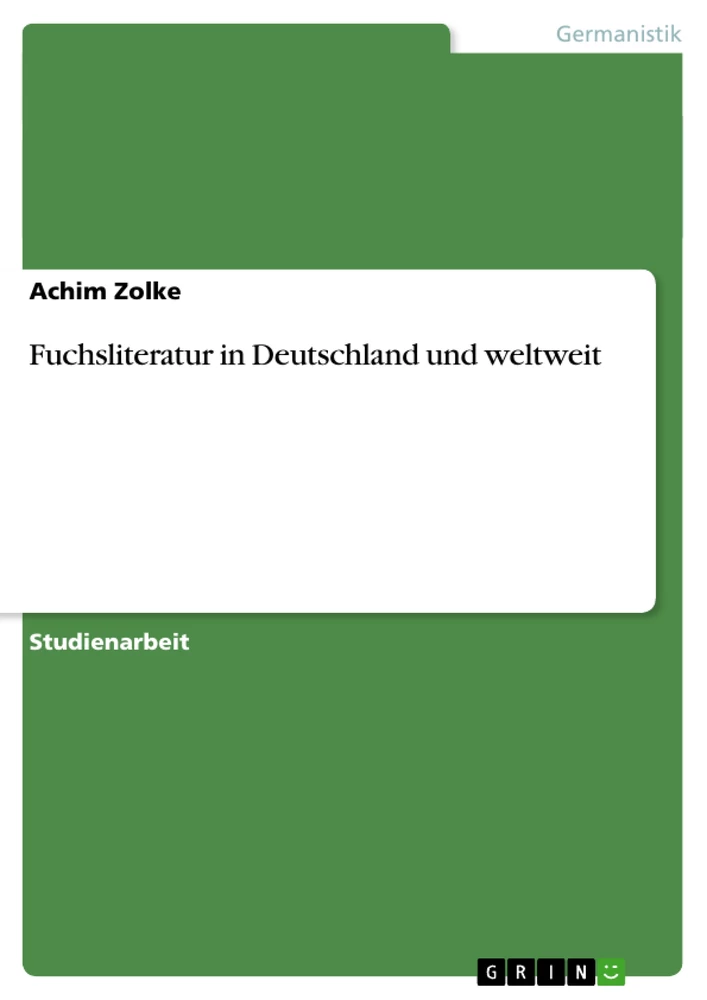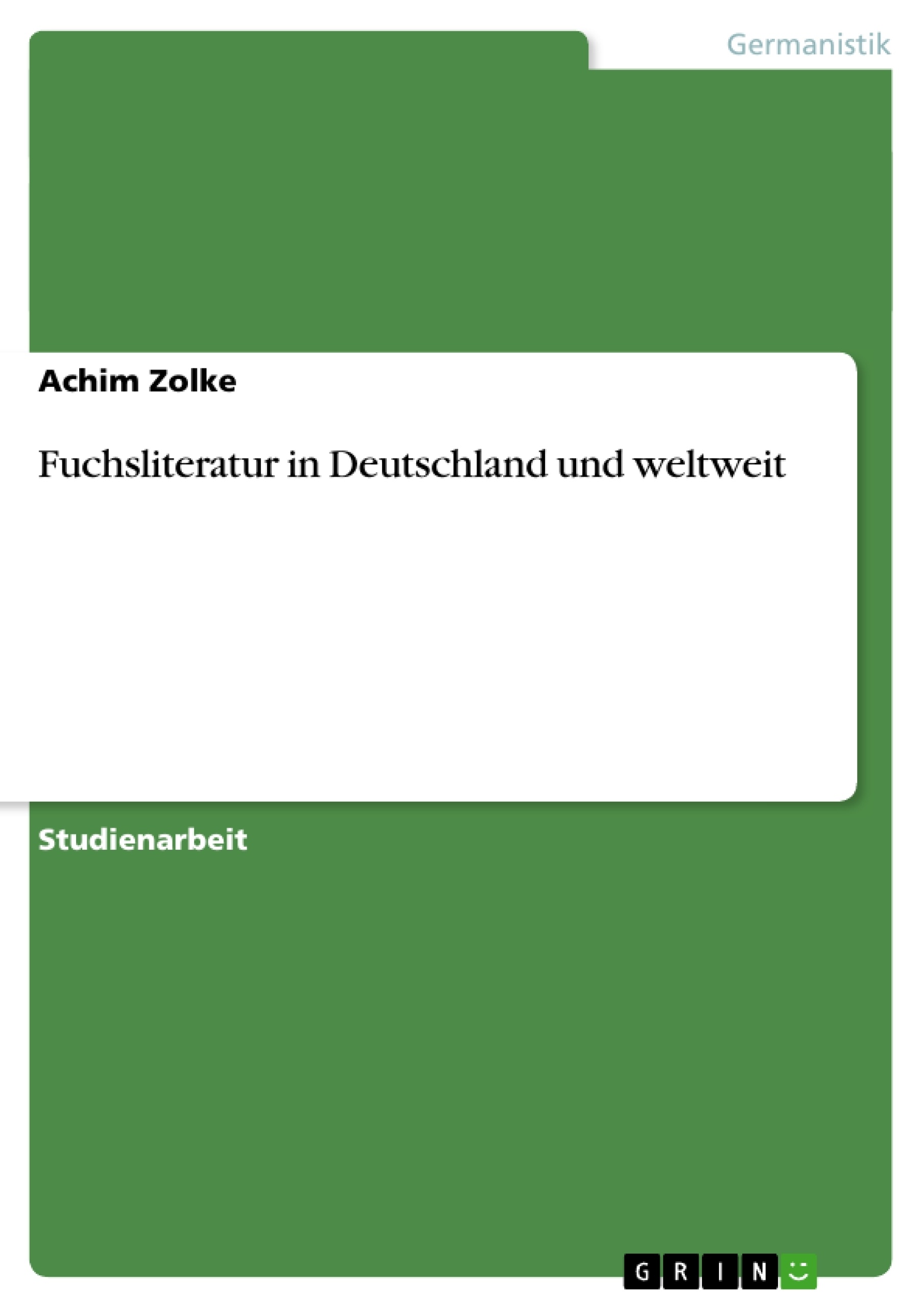Was treibt den Fuchs an, dieses schlaue, gerissene Tier, das seit Jahrhunderten die Literatur bevölkert? Diese faszinierende Studie entschlüsselt die vielschichtige Rolle des Fuchses in Fabeln und Epen, von den antiken Weisheiten Äsops bis zu den modernen Interpretationen im digitalen Zeitalter. Begeben Sie sich auf eine literarische Reise, die die facettenreiche Darstellung des Fuchses in der deutschsprachigen Literatur, darunter Heinrichs "Reinhart Fuchs", "Reynke de Vos" aus Lübeck und Goethes "Reineke Fuchs", beleuchtet und seine Entwicklung vom mittelalterlichen Sünder zum oppositionellen Helden aufzeigt. Entdecken Sie, wie der Fuchs die Gesellschaft spiegelt, ihre Schwächen entlarvt und zur satirischen Projektionsfläche für politische und soziale Kritik wird. Doch die Reise geht weiter: Untersuchen Sie die weltweite Verbreitung des Fuchs-Mythos, von den Fabeln La Fontaines in Frankreich bis zu den Schakal-Gestalten in afrikanischen Erzählungen und den Hexensagen der Schweizer Alpen. Erforschen Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung dieses faszinierenden Tieres über Kulturen und Kontinente hinweg. Wie beeinflussten Aristoteles' naturwissenschaftliche Beobachtungen und frühe Tierbeschreibungen die literarische Konstruktion des Fuchses als Inbegriff von Gerissenheit und Hinterlist? Abschließend wird ein Blick auf die Präsenz des literarischen Fuchses im Internet geworfen, wobei die Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Suche nach diesem archetypischen Charakter analysiert werden. Diese Arbeit bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Fuchsliteratur, sondern regt auch zum Nachdenken über die zeitlose Faszination dieses listigen Geschöpfs an und seine Bedeutung als Spiegelbild menschlicher Eigenschaften und gesellschaftlicher Normen. Tauchen Sie ein in die Welt des Fuchses und entdecken Sie die tiefgründigen Botschaften, die er uns seit jeher vermittelt – ein Muss für Literaturinteressierte, Kulturwissenschaftler und alle, die sich von der unsterblichen Anziehungskraft des Fuchses gefangen nehmen lassen. Eine tiefgehende Analyse für Germanistikstudenten, Literaturwissenschaftler, Kulturhistoriker und interessierte Leser, die mehr über die Bedeutung des Fuchses in der Literatur und Folklore erfahren möchten. Von der Fabel bis zum Epos, von Deutschland bis in die Welt – diese Studie enthüllt die Vielschichtigkeit eines literarischen Archetypus.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Der Fuchs in der deutschsprachigen Literatur (Auswahl)
1) Reinhart Fuchs - von Heinrich (Anonymus)
2) Reynke de Vos - Lübeck 1498
3) Reineke Fuchs - von Goethe
4) Fazit: Der Fuchs im deutschsprachigen Raum
II. Der Fuchs in weltweiter Literatur
1) Die Fabeln Aesops
2) Frankreich
a) Roman de Renart
b) Fabeln La Fontaines
3) Flandern
4) Fuchsgeschichten aus aller Welt
5) Fuchsepik im internationalen Schulunterricht
6) Fazit: Der Fuchs im weltweiten Vergleich
III. „Der Fuchs im Netz“
1) Die Suche nach dem literarischen Fuchs im Internet
2) Suchergebnisse
Literaturverzeichnis
Einleitung
"Es fuchst mich, da werde ich fuchsig, gewieft wie ein Fuchs," - derartige Ausdrücke, die sich zwischen Umgangssprache und lexikalisierten Formen bewegen und auf dem Morphem "fuchs" basieren, sind im deutschen Sprachraum hinlänglich bekannt. Die semantische Bedeutung ist recht klar; der Fuchs, so wie ihn die Literatur seit Jahrtausenden darstellt, hat die Eigenschaft, mit Schläue und Hinterlistigkeit für Ärger und Intrigen verantwortlich zu sein. Die anthropologisierte Version dieses Raubtieres ist in seiner verschlagenen Art seit dem Mittelalter in West-Europa bekannt, seine Ursprünge gehen indes weit über diese zeitliche Grenze und den romanischen und germanischen Sprachraum hinaus.
Zwei wesentliche Gattungen der Fuchsliteratur sind bekannt: Die kurzen, lehrreichen Fabeln in Sammlungen und die epischen Werke, die den Fuchs bereits im Titel als ihren Protagonisten erkennen lassen.
Mit dieser Arbeit soll ein Überblick über Gemeinsamkeiten und (die weit weniger vorhandenen) Unterschiede der Fuchsliteratur von der Antike bis heute, von Deutschland bis in den Orient gegeben werden. Im Anschluss folgt ein Ausblick auf die neuere Methode, nach dem Fuchs weltweit im Internet zu suchen.
I. Der Fuchs in der deutschsprachigen Literatur (Auswahl)
1) Heinrich (der Glîchzare) - Reinhart Fuchs
Ein Anonymus namens Heinrich, der den Beinamen „der Glîchzare“ erhielt, schrieb um 1192 mit „Reinhart Fuchs“ das erste deutschsprachige Tierepos überhaupt. Die Verserzählung widmet sich dem höfischen Leben, wobei die Person des Fuchses immer im Mittelpunkt steht. Das 2248 Verse umfassende Werk kann in drei Abschnitte unterteilt werden:
Teil 1 berichtet über das Pech des Fuchses und erzählt in schwankhafter Weise über das Scheitern Reinharts bei seinen Bemühungen, durch List Beute zu machen. Wenngle ich hier bereits die Gerissenheit des Protagonisten erwähnt wird, versagt er dennoch „überraschend“ oft. Kurt Ruh vermutet, dass dem Leser zur Einstimmung ein „menschliches“, angenehmes Bild vom Fuchs vermittelt werden sollte: „Das epische Vorzeichen ist wohl deshalb verquer gesetzt, weil es im Hinblick auf die späteren, vielfach kriminell zu nennenden Taten des Protagonisten nötig schien, diesem beim Publikum einige Sympathien zu sichern."1
Im zweiten Teil schließt sich die Gevatterschaft von Fuchs und Wolf an, die im Detail über das Verhältnis zwischen der Familie des Wolfes und der Person des Fuchses berichtet. Durch diese Verbindung entsteht auch die Basis für die Minne, die der Fuchs Hersant, der Gattin des Wolfes, entgegenbringt. Es kommt zum Ehebruch, und durch andere Taten Reinharts auch zum Bruch der Gevatterschaft; der Wolf wird seelisch und körperlich vom Fuchs zugrunde gerichtet. Abschnitt 3 führt den Leser an den Hof des Königs. Dieser hat gerade das Ameisenvolk tyrannisiert, eine Ameise rächt sich und krabbelt dem großen Löwen in den Kopf, woraufhin der Monarch erkrankt. Der daraufhin einberufene Hoftag bildet den Rahmen für eine Klage gegen den Fuchs, gleichzeitig bietet die Ameise Reinhart die Möglichkeit, als falscher Arzt den König zu kurieren. Der Fuchs wird also innerhalb kürzester Zeit vom Angeklagten zum ersten Berater des Königs. Der Hoftag gipfelt im Giftmord Reinharts am König, und der Fuchs, der Sünder, bleibt am Ende Sieger. Die Umstände dieses Sieges werden als Kritik Heinrichs an den damaligen höfischen Gegebenheiten angesehen, denn die damals üblichen Wertvorstellungen von Gerechtigkeit, Schuld und Sühne werden vom Autor permanent in ihr Gegenteil verkehrt.
Der Fuchs erfährt während der Gesamthandlung des Tierepos eine Entwicklung: Dabei scheint der erste Teil eine Art Lehrzeit für den Fuchs zu sein. Er ist von Anfang an hinterlistig, ist aber in seinen Taten noch nicht so geschult, dass er die Tiere überlisten kann. Dies wird in besonderem Maße am Kater Dieprecht deutlich, der ihn im ersten Teil noch in die Falle locken kann, während er im dritten Teil der List des Fuchses unterliegt und nur mit größter Mühe dem Tod entkommt. Während also der Fuchs offensichtlich dazugelernt hat, verharren die anderen Tiere auf ihrem gesellschaftlichen Entwicklungsstand.
Abschließend kann gesagt werden, dass die Verserzählung Heinrichs eine Gesellschaftssatire gegen die Staufischen Verhältnisse in höfischer Umgebung darstellt. Jacob Grimm: „Es ist, wenn man will, nicht einmal Satire, nur Nachahmung des menschlichen Treibens, von leiser Ironie begleitet.“2 Der Fuchs wird in dem politischen Schlüsselroman beschrieben als ein völlig gewissenloses, zwar cleveres aber bei weitem nicht geniales Wesen, das nur durch seinen niederträchtigen Charakter siegreich bleibt.
Umstritten unter Germanisten ist, ob dieses Werk auf den Roman de Renart (s.u.) zurückzuführen ist, oder auf noch früheren Quellen basiert. Ende des 19. Jahrhunderts verfasste Carl Voretzsch eine Dissertation, in der er entgegen der vorherrschenden Meinung die Theorie aufstellte, dass Heinrich nicht vom Roman de Renart, sondern von einem früheren, nun verlorenen alt-französischen Epos inspiriert wurde. Einen derartigen Prototypen des mittelalterlichen Fuchs-Stoffes vermutete zur selben Zeit auch Hermann Büttner in seinen "Studien zu dem Roman de Renart und dem Reinhart Fuchs".3
2) Reynke de Vos - Lübeck 1498
Die deutschen Erzählungen von einem Fuchs mit dem berühmten Namen Reineke haben ihre Ursprünge in Lübeck, denn dort ist „Reynke de Vos“ als Inkunabel, einem der ersten Druckwerke der Buchgeschichte, erhalten. Sie ist die Lübecker Bearbeitung einer mittelniederländischen Fassung des Fuchsfabel-Stoffs, die mit zahlreichen Holzstichen als Illustrationen herausgegeben wurde. Die Fabel erzählt von der Dauerfehde zwischen dem weltklugen Fuchs und seinem plumpen, aber starken Widersacher Isengrim, dem Wolf. Offene und offensichtliche Gesellschaftskritik wurde auch hier geschickt in die Tier- Geschichte eingebettet, indem die verschiedenen vorkommenden Tiere nach den damals üblichen vier menschlichen Ständen definiert wurden:
Zum ersten Stand, den Arbeitern, wurden "ackernde" Tiere wie der Esel Boldewin gezählt. Der zweite Stand, die Bürger und Kaufleute, wurde repräsentiert von den Tieren, die in natura von gefundenen Gütern leben, die dann von ihnen gehortet werden. Dazu zählen Eichhörnchen, Hamster und ein Hase, der in Reynke de Vos(und darüber hinaus) Lampe genannt wurde. Die Geistlichen sind in dem Werk nur durch einen tierischen Vertreter vertreten, dem Dachs Grimbart, der von den Gütern der beiden vorangehenden Stände lebt. Der vierte Stand, die Fürsten und Adligen allgemein, tritt in der Inkunabel mehrfach in Erscheinung, je nach Grad seiner Macht und Wichtigkeit. Hierzu gehört Nobel, der König (der Tiere), ebenso die ihm nahestehenden Fürsten und Herzöge wie z.B. Braun, der Bär und Isegrim, der Wolf. Die niedrigere Adel ist durch den großen Hund Rien, den Affen Marten und eben Reynke, neudeutsch Reineke, verkörpert.4
Die mit systemkritischen Tönen und katholischen Zwischenkommentaren geschriebene Geschichte ist in vier Bücher unterteilt. Der äußerst boshafte Fuchs soll, das macht der anonyme Verfasser deutlich, als Antibeispiel betrachtet werden.
3) Goethes „Reineke Fuchs“
Erzählt wird von Johann Wolfgang von Goethe die Geschichte des durchtriebenen Reineke Fuchs. Von den anderen Tieren zahlreicher Untaten bezichtigt, entzieht er sich dem Schuldspruch immer wieder durch geschickte Lügen, wahre Gräueltaten an seinen Gegnern, besonders an Wolf Isegrim, und durch falsche Versprechungen gegenüber König Nobel, dem Löwen. Am Ende siegt Reineke, der für Goethe den neuen politischen Typus des Demagogen, des Kriegsgewinnlers verkörpert, der zwischen den Fronten nach Gutdünken hin und her pendelt. Ihm haben der würdige, aber dumme Nobel und der aus Schaden nie klug werdende Isegrim wenig entgegenzusetzen. Sie entsprechen den Politgrößen, die lügen und an ihre eigenen Lügen glauben.
Goethe wurde 1999 von einem Kritiker unterstellt, durch schmeichelnde Sprache Gefallen am „Witz des Bösen“ erlangt zu haben: „Dafür, dass sie ihn juckte, ist Mephisto der eine Beweis; der andere ist Reineke.“5
In der Tat geht auch in dieser Bearbeitung der Fuchs sehr brutal und reuelos mit seinen Gegnern um; die Frau des Wolfes wird vergewaltigt, viele Mitstreiter Reinekes sterben durch seine Hand (Pfote), und zur Belohnung setzt König Nobel Reineke auf den Stuhl des Kanzlers. In satirisch-humoristischer Weise entwirft Goethe das Bild einer feudalen, korrupten Gesellschaft, die durch Machtspiele, Rücksichtslosigkeit und Opportunismus gekennzeichnet ist. Doch Goethes Fabel ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch ein zum Nachdenken anregender Lesestoff, und sie ist nach wie vor aktuell, denn einen skrupellosen Verführer wie Reineke Fuchs wird es immer geben. Er spielt mit der Dummheit der Tiere (Menschen) und macht sie sich schließlich untertan. Da ist kein Tier beim Hoftag in Nobel, das nicht bittere Klage führt gegen den Übeltäter Reineke Fuchs. Vor allem Isegrim, der Wolf, Wortführer der Geschädigten, weiß Übles zu berichten. Aber der Böse kommt nicht zum Hoftag, sondern bleibt ruhig und sicher auf seiner Festung Malepartus im Exil. Erst Grimbart, der Dachs, kann ihn zur Reise an den Hof bewegen.
Goethes Versepos in Hexametern entstand während seiner Begleitung des Feldzugs gegen Frankreich und der Belagerung von Mainz im Jahr 1793. Dabei geht es in der Dichtung humorvoll und unterhaltsam, aber auch lehrreich zu. „Reineke Fuchs" geht zurück auf ältere Fuchs-Episoden, die in verschiedenen Kulturen bekannt sind. Der Ursprung ist aber nicht genau erforscht, wahrscheinlich stammt die Quelle aus dem 11. Jahrhundert. So gibt es z.B. auch den französischen "Roman de Renart" (s.u.). Fest steht, dass man Goethes Werk auch als Adaption von „Van den Vos Reynaerde“ ansehen kann; in beiden Erzählungen rechtfertigt der Schuft seine bösen Taten und äußert Kritik am gleichfalls unheroischen, korrupten König, dem Löwen.6 Im Laufe der Zeit hat man diese Fabel immer wieder verändert, denn mit ihr konnte man sehr gut das jeweils aktuelle Zeitgeschehen deutlich machen bzw. verhöhnen. Als Fabel verkleidet konnten z.B. die Not und die Ungerechtigkeit, unter denen die armen Leute leiden mussten, aufgezeigt und kritisiert werden.
Auch Goethe dichtete die Fabel um und gestaltete zwölf so genannte Gesänge. In diesem Epos verarbeitet er seine Erfahrungen mit der französischen Revolution, indem er indirekt Gesellschaftskritik übt.
Fazit: Der Fuchs im deutschsprachigen Raum
Die Fuchsfabel hat im Laufe ihrer la ngen Geschichte höchst unterschiedliche Interpretationen ausgelöst: War der Fuchs im späten Mittelalter noch als erbärmlicher Lügner und Todsünder aufgefasst worden, so sieht man ihn später in der Reformationszeit als demaskierenden Agitator, dann in der Barockzeit als nützlichen Ratgeber, als Schelm bei Goethe und heutzutage eher als oppositionellen Helden. Gleichwohl kann der Fuchs in der deutschen Literatur, weil er so meist auftritt, als skrupelloser, treffsicherer Gauner charakterisiert werden. "Blanke Lust am Schaden wie vorsorgliches Ausschalten künftiger Feinde, Kopfobenbehalten in äußerster Not, Ausnutzen aller eignen Ressourcen..."7 sind die Eigenschaften, die ihn hier generell ausmachen. Erstaunlich ist nun die Faszination, die vom Fuchs in Fabeln aller Herren Länder ausgehen, und so wird im folgenden der Frage nachgegangen, ob sich die oben erwähnten Charakterzüge in Erzählungen weltweit gleichen.
II. Der Fuchs in weltweiter Literatur
1) Die Fabeln Aesops
Die Tradition der Fabel beruft sich auf den legendären phrygischen Sklaven Aisopos (Aesop), obwohl es vor ihm schon Fabeln auf griechischem Boden gab - u. a. von Hesiod (um 700 v. Chr.) und Archilochos (um 650 v. Chr.). Dass der Gattungsname trotzdem mit Aesop verbunden wird, hängt wohl entscheidend mit der großen Zahl und der Qualität seiner Fabeln zusammen.
Der sagenhafte Aesop lebte angeblich Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Die ihm zugeschriebenen Fabeln gehen wahrscheinlich auf mündliche Überlieferung zurück. Sein Werk ist nur in späteren Überarbeitungen erhalten, im Prinzip wurde unter seinem Namen eine Fabelsammlung zusammengefasst. Der Fuchs ist hier nicht immer der durch seine Klugheit Überlegene. Das clevere Tier tritt bei Aesop in verschiedenen Funktionen auf, nämlich auch als Kritiker des Verhaltens anderer bzw. als gegen eine beliebige andere Figur austauschbar:
So verdankt der Fuchs seine Rettung vor Jägern nicht unbedingt seiner Klugheit, als er sich in „Der Fuchs und der Holzhacker“ in der Hütte des Holzfällers versteckt. Dieser will den Fuchs verraten, indem er den Jägern mit einer eindeutigen Handbewegung zeigt, wo sich der Fuchs verbirgt. Dabei sagt er jedoch laut, er wisse nichts vom Fuchs, die Jäger übersehen aber den verräterischen Fingerzeig und verschwinden. Der falsche Holzhacker möchte nun den Dank des Geretteten hören, daraufhin verurteilt ihn zurecht der Fuchs: "Ich wüsste dir gerne Dank, wenn die Werke deiner Hand und deine Gesinnung mit deinen Reden im Einklange ständen."
Der Fuchs tritt bei Aesop sogar als Unterlegener auf: In „Der Esel und der Fuchs“ verrät der Fuchs seinen Kameraden, den Esel, um sein eigenes Leben vor dem Löwen zu retten. Der Löwe aber schnappt sich daraufhin den Fuchs mit den Worten „Dich zerreiße ich wegen deiner Falschheit zuerst“. Nicht von ihm zerrissen wird der Schlaukopf in "Der kranke Löwe", obwohl der Fuchs (hier literaturgeschichtlich erstmals) den Fauxpas begeht, den kranken König der Tiere als einziger nicht zu besuchen. Genial redet er sich aber heraus und vernichtet gleichzeitig den Wolf, seinen Erzfeind (der ihn beim König verraten hatte), indem er dem Löwen vorgaukelt, er habe nach einem Heilmittel gesucht und herausgefunden, dass die Wolfshaut dafür am geeignetsten sei. "Der Wolf büßt sein Leben ein, der Fuchs ruft spöttisch aus: So muss man den Herrn nicht zur Ungnade, sondern zur Gnade bewegen."8
„Der Fuchs und der Bock“: In dieser Fabel verfangen sich Fuchs und Bock ungeschickt und wegen ihres großen Durstes in einem Brunnen, woraufhin der Fuchs dem Bock Rettung verspricht, sofern er auf ihn und damit in die Freiheit springen dürfe. Nachdem sich der Fuchs gerettet hat, spottet er auf den Bock und verlässt den Kameraden.9
Fazit: Schon in den ältesten Fuchs-Geschichten wurde das Tier als egoistisches, oftmals cleveres und falsches, gewissenloses Geschöpf charakterisiert. Eine zusammenfassende Lehre hieraus lässt Aesop aber nicht erkennen; mal führt die Ich-Bezogenheit zum Erfolg, mal verliert man dadurch. Allerdings lässt sich aus den einzelnen Fabeln, jede für sich betrachtet, immer ein Ratschlag ableiten, und teilweise erfährt der Leser am Ende der Kurzgeschichte die entsprechende „Moral von der Geschicht‘“.
2) Frankreich
Sicherlich wurde der literarische Fuchs in Frankreich nicht neu erfunden, doch von hier aus erhielten die lehrreichen Tiergeschichten im Mittelalter, und dann noch einmal im 17. Jahrhundert, neue Popularität. Einen sprachwissenschaftlichen Beleg für den Erfolg dieser Literatur fanden die Gebrüder Grimm im 19. Jahrhundert: „Die Fuchsdichtung hat in Frankreich übrigens dazu geführt, dass der Eigenname Renard das alte Wort für den Fuchs, Goupil, verdrängte.“10
a) Roman de Renart
Ende des 12. Jahrhunderts entstand in Nordfrankreich der altfranzösische "Roman de Renart". Dieses frühe Werk kann aufgrund seiner Verbreitung als "Ur- Reineke", als thematische Quelle für spätere Fuchs-Erzählungen wie "Reinhart Fuchs" angesehen werden. Pierre de Saint-Cloud schuf mit dieser Veröffentlichung um 1176 eine höchst originelle Form der literarischen Unterhaltung, da man zu seiner Zeit meist die Abenteuer höfischer Helden las, und bis dato noch nie etwas von der Feindschaft zwischen dem Wolf Ysengrin und dem Fuchs Renart gehört hatte. Damit prägte Saint-Cloud eine "neue Erzählgattung, die sich das ganze Mittelalter hindurch größter Beliebtheit erfreute"11. Doch auch er hatte eine Vorlage: den lateinischen "Ysengrimus" von Nivardus (1152), an den er seinen Roman anknüpfte. Die Renart-Episoden waren derart beliebt, dass sie seit dem Ende des 12. Jahrhunderts in die allgemeine Volkssprache übertragen wurden Der in Altfranzösisch geschriebene Text ist unterteilt in 27 "branches", also Zweigen, und führt episodenhaft durch die Geschichte um Fuchs, Wolf, König Nobel und anderen anthropomorphisierten Tieren. Thematisch wird Renart hier von anderen Tieren als Dieb und Mörder für seine Taten angeklagt: Er sei ein Mörder und Friedensbrecher.
Branche I wurde wohl Mitte des 13. Jahrhunderts von „Willem die Madocke maecte“ verwendet, um vom Hoftag der Tiere, auf dem der Fuchs wegen seiner Verbrechen angeklagt wird, in „Van den Vos Reynaerde“ zu erzählen. Es wurden noch weitere Einzelstücke aus dem altfranzösischen Werk übernommen; so eine Stelle, in der Reinhart einen Schinken raubt (Branche V) und die Geschichte vom betrunkenen Wolf im Klosterkeller (Branche XIV).
Auch „Reinhart Fuchs“ basiert auf dem Roman de Renart.12
b) Fabeln von La Fontaine
Der Roman de Renart ist die erste, aber nicht die einzige prägende Fuchs- Erzählung aus Frankreich: Jean de La Fontaine (1621-1695) begründete im 17. Jahrhundert eine Form der Fabel, die ihr eigentlich wesensfremd ist; mit blumiger und geschmückter, gereimter Sprache tritt die Aussage und Prägnanz der Fabel zugunsten epischer, an das Tierepos bzw. -märchen angelehnter Erzählform in den Hintergrund. Dennoch übernahm La Fontaine weniger den ausgedehnten Inhalt der großen Fuchs-Erzählungen, er schrieb vielmehr echte Fabeln im Stile Aesops oder erzählte sie schlichtweg nach, wobei er sie besonders anschaulich ausmalte. Die Geschichten beinhalten an ihrem Ende jeweils eine Moral. Der Fuchs ist, wie in einer Fabel-Sammlung üblich, nicht der alleinige Protagonist, er tritt nur manchmal in Erscheinung, nicht häufiger als Wolf und Löwe.13 Seine hauptsächliche Motivation ist der Hunger; um ihn zu stillen, betrügt und überlistet er seine Opfer, die meist gefiedert sind. So betört er in "Der Fuchs und der Rabe" den schwarzen Vogel so lange, bis dieser den Schnabel öffnet, um seine vermeintlich schöne Stimme zu beweisen. Der Käse, der vorher im Schnabel war, fällt dem Fuchs plangemäß nach unten entgegen, woraufhin der sich erdreistet, die Moral dazu selbst zu sprechen: "Ein jeder Schmeichler mästet sich vom Fette des, der willig auf ihn hört, Die Lehr ist zweifellos wohl - einen Käse wert!"14 Wenngleich in La Fontaines Fabeln etliche Hühner vom Fuchs gefressen werden, fällt doch auf, dass hier der Fuchs sogar noch häufiger selbst zum Opfer wird. Ohne seine Listigkeit zu verleugnen, wird er in zahlreichen Fabeln als "betrogener Betrüger"15 dargestellt, so z.B. in "Der Hahn und der Fuchs": Hier gibt der Gierige vor, Frieden schließen zu wollen und fordert den Hahn zum Bruderkuss auf.
Dieser Antwortet gewitzt, dass er sehr über das Abkommen erfreut sei, vor allem jetzt, da, wie er "eben erblickt", "zum gleichen Zweck" zwei Hunde auf den Fuchs zulaufen. Auch in "Der Fuchs und der Storch" ist am Ende der Fuchs der Betrogene, da der Storch ihn aus Rache zu einem Essen einlädt, welches in derart schlanken Gefäßen serviert wird, dass der Fuchs mangels spitzen Schnabels nichts davon zu sich nehmen kann.
Der Tradition von "Reynke de Vos" und "Reineke Fuchs" folgend, sind auch bei La Fontaine die vermenschlichten Tiere Spiegelbilder der Standes-Gesellschaft, wobei der Fuchs abermals zum niederen Adel zählt und als beratender Edelmann auftritt. Da aber die Fabeln nicht die epische Länge mit Szenen am Hofe eines "Reineke Fuchs" aufweisen, ist dieser Hintergrund schwerer durchschaubar, so dass La Fontaines Fabeln eher unter didaktischen als gesellschaftskritischen
Aspekten gesehen werden müssen.
3) Flandern
16Um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstand in Flandern das lateinisch geschriebene Tierepos ,, Ysengrimus" . Hier kommen zur Aesopischen Tradition weitere Elemente hinzu, z. B. der königliche Hof- und Gerichtstag und der zeitkritisch-satirische Charakter des Textes.
In Flandern fand der Stoff noch eine neue literarische Bearbeitung, die weiterwirken sollte: das Versepos ,,Van den Vos Reynaerde", verschiedenen historischen Indizien nach wohl etwa zwischen 1180 und 1270 entstanden. Der Dichter nennt sic h im Prolog Willem und stammt vermutlich aus der Gegend von Gent, da ein Gebiet nördlich dieser Stadt in der Geschichte eine Rolle spielt. Er kannte wahrscheinlich außer dem "Roman de Renart" auch den ,, Ysengrimus" und die Aesop-Fabeln. Willems Werk stellt die älteste und literarisch wichtigste niederländische Fassung des Stoffes dar, und eine ganze Reihe ihrer Handlungselemente kommen auch in den meisten späteren Fassungen in derselben Reihenfolge vor: Anklage gegen den Fuchs auf dem Hoftag König Nobels, dreimalige Vorladung, sein Erscheinen und seine Verteidigung (Schatz- Lüge), Bestrafung der Barone (sowie ihre spätere Rehabilitierung), Pilgerreise,Überlistung des Widders und zum Ende hin die Anerkennung Reynaerts.
Dargestellt wird bei Willem eine verkehrte Welt. Durch seine bösen Streiche entlarvt der Fuchs vorgegebenes ritterliches Ethos als Egoismus und pure Anmaßung; Machtstreben und Verlogenheit bestimmen das Verhalten der höfischen Standespersonen, und die Mächtigen fallen schließlich ihrer eigenen Dummheit zum Opfer.
Die sprachliche Raffinesse der ironischen Darstellung dieser verkehrten Welt fängt bei der anspielungsreichen Namengebung an und geht über entlarvende sprachliche Unangemessenheit der handelnden Personen bis zu kleinen Zweideutigkeiten bei der Beschreibung des Handlungsverlaufs. Willem hatte offenbar ein gebildetes Publikum, wie es damals in den flämischen Städten lebte und welches die Anspielungen auch verstand, also Adel, Geistlichkeit und gehobenes Bürgertum. Über "Küchenlatein" kann z. B. nur jemand lachen, der weiß, welche kirchenlateinische Formel damit persifliert wird. Von Flandern aus hat sich, wie erwähnt, das Tierepos vom Fuchs weiter ausgebreitet: "Reinaerts Historie" (um 1370) ist eine moralisierende Umarbeitung und Fortsetzung. Eine Prosa-Bearbeitung davon wurde 1479 in Gouda gedruckt.
4) Fuchsgeschichten aus aller Welt
Fest steht: Erfunden hat die Fabel kein Dichter, sondern der "Volksmund".
Auch ihr Ursprungsland ist unbestimmt: Die Experten werden sich weiterhin ohne Ergebnis darüber streiten, ob die Fabel in Griechenland oder in Indien entstanden ist.
Wenngleich der Fuchs in Fabeln weltweit ähnliche Charakterzüge zugeschrieben bekommt, ist es jedoch nicht immer ein reinrassiger Fuchs, der den notwendigen Typus des intrigant-cleveren Egomanen verkörpert. Da es in Afrika und weiten Teilen Asiens kaum Füchse gibt, wurde dem artverwandten Schakal die Rolle zuteil. Afrikanische Fabeln wie „Der kranke Löwe“ greifen das Motiv aus „Reinhart Fuchs“ auf; hier will der Schakal des Löwen Gunst gewinnen, indem er vorgibt, den König zu heilen, indem er das Fell seines Erzfeindes, der Hyäne, abzieht. In der indischen Fabel „Vom blauen Schakal“ (Laut Jacob Grimm um das Jahr 200 verfasst) beansprucht der Halunke aufgrund seiner unnatürlic hen Farbe gar selbst das Königsamt für sich und scheitert am Ende, da der Betrug auffliegt.17 In Arnold Büchlis Sammlung „mythologische Landeskunde von Graubünden“ finden sich zahlreiche Hexen-Sagen, in denen sich der Fuchs in eine Hexe (oder umgekehrt) verwandelt, obwohl im Bezug auf Hexen die Katze das gängige Verwandlungstier in derartigen Erzählungen war. Im Schweizer Kanton Graubünden jedenfalls galt „Was dem Fuchs widerfährt, wiederfährt auch der Hexe“.18
Die Katze, oder genauer: der Kater zeigte im Märchen ebenfalls seine Artverwandtschaft mit dem Fuchs. Von den ägäischen Inseln ist die Erzählung „Die Füchsin“ bekannt, welche dem Gebrüder-Grimm-Märchen „Der gestiefelte Kater“ ähnelt. Dieses Märchen, welches in vielen verschiedenen Fassungen existiert, hat im süd- und osteuropäischen Bereich sowie in Asien häufiger den Fuchs als den Kater zum Protagonisten.19
Erstaunlich ist, dass nahezu identische Fuchs-Fabeln in weit voneinander entfernten Teilen der Welt überliefert werden. Ein Beispiel hierfür ist eine in mittelhochdeutsch geschriebene Erzählung, die aus dem Orient stammen soll: "die Taube, der Fuchs und der Sperling"20. Der Fuchs bedroht hier die Taube, die ihm eingeschüchtert stets nach der Brutzeit ihre Jungen vom Baum wirft. Der Sperling rät ihr, die s beim nächsten Mal zu verweigern, da der Fuchs ja gar nicht zu ihr emporklettern könnte. Die Taube befolgt den Rat, verrät aber ihren Ratgeber. Der Fuchs rächt sich an diesem auf die ihm eigene Art: Er schmeichelt dem Sperling, dieser wird daraufhin unachtsam. Bevor der Fuchs sein Opfer frisst, erklärt er ihm noch: "Du bist einer, der sich selbst feind ist. Du konntest der Taube gut raten (...) und konntest Dir selbst nicht raten." Bei den Hottentotten, also in Südafrika, ist diese Fabel ebenfalls bekannt, allerdings ist hier der Fuchs ein Schakal, und anstelle des Sperlings tritt der Reiher, der vom Fuchs den Nacken entzwei geschlagen bekommt. "Seit jenem Tage," heißt es dann, ist des Reihers Nacken rund gebogen."21
Spricht man von orientalischen Fabeln, so sind, wie Jacob Grimm erklärt, meist Indische gemeint: "Unter allen Thierfabelsammlungen des Orients reicht keine an das Alterthum der indischen, welche den Titel „Hitopadesa“ führt."22 Aus Italien, von Gherardo de Rossi, stammt eine kurze Fabel, die den Fuchs als edlen, belehrenden Querdenker erscheinen lässt: In "Das Pferd und der Fuchs" bewundern alle Tiere das bei einem Wettlauf gegen einen Stier siegreiche Reittier. Nur der Fuchs hat kein lobendes Wort übrig, er ist der Meinung, das Pferd solle sich mit dem Hirsch messen: "Im Kampf den schwachen Feind zu schlagen, ist noch kein Grund, die Stirne hochzutragen."23 Auch bei Aesop trat der Fuchs nicht immer als Scharlatan, sondern als Kritiker anderer Tiere auf, z.B. in „Die Natter und der Fuchs“ und in „Die Dohle und der Fuchs“.
5) Fuchsepik im internationalen Schul-Unterricht
In vielen Ländern machen Pädagogen und Didaktiker von der Gestalt des Fuchses und den ihm zugeschriebenen Charakter-Eigenschaften gebrauch. Fabeln werden aufgrund ihrer Greifbarkeit schon Grundschülern präsentiert; das Resümee einer jeden Kinder-Fabel soll der Moral oder Bildung zuträglich sein. Allerdings musste vor allem der Reineke Fuchs-Stoff aufgrund seiner Brutalität und der derben sexuellen Anspielungen oft umgeschrieben oder gekürzt werden, ehe Kinder ihren Nutzen daraus ziehen konnten.
Der Fuchs hielt über die Tier-Erzählungen für Schüler auch Einzug in Lieder und Spiele. So ist, um nur eines der vielen Beispiele zu nennen, „Der Fuchs geht um“ ein deutsches Singspiel, in welchem der „Fuchs“ (ein Kind) die tragende, aktive Rolle hat. Außerhalb Deutschlands wird diese Tierfigur ebenso verwendet: „Gnilo jajce“ ist die slowenische Variante des selben Fuchs-Spiels, und in der Türkei werden Kinder mit „Tilki tilki saatin kaV“ („Fuchs, Fuchs, wie spät ist es?“) unterhalten. Hier stellt eines der Kinder den „Tilki“ (türk.: „Fuchs“) dar, der seine Überlegenheit zum einen dadurch erkennen lässt, dass nur er die Frage einer fiktiven Uhrzeit beantworten kann, zum anderen darin, dass er als „Jäger“ die Mitspieler fangen muss.
Ein fast skurriles neuzeitliches Werk für Kinder ist das portugiesische Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren: „A raposa vegetariana“ („Der vegetarische Fuchs“) - darin wird ein gefräßiger Fuchs auf Diät gesetzt und vom Arzt dazu veranlasst, nur noch frisches Gemüse zu fressen.24
Bei der Betrachtung der internationalen Verwendung des Fuchses im Unterricht wird deutlich, dass Kindern schon im frühesten Schul-Alter ein bestimmter Typus des Tieres vorgestellt wird: Der Fuchs steht Pate für den Charakter, vor dem man sich in acht nehmen muss, da er gefräßig, klug und verschlagen ist. Dennoch muss bei der Behandlung von Reineke Fuchs-Dichtungen im Unterricht klar sein, dass längst nicht jedes Werk zu diesem Protagonisten für Kinder geeignet ist. Viele der mittelalterlichen Erzählungen sind voller abscheulicher Gewalt; der Fuchs ging selten zimperlich mit seinen Gegnern um. So wundert es nicht, dass die Fabeln und Erzählungen heute vor allem für Kinder inhaltlich verändert wurden; die Brutalität wurde dabei aus den alten Meisterwerken verbannt oder verharmlost. Und so mancher Germanist, der eine Adaption des Stoffes vornehmen wollte, fragte sich wohl: „Wen schreckte die Vorstellung nicht, daß zur Nachtzeit die Leser des Reineke Fuchs auszögen, Schlafende blind zu pinkeln? Oder die Kämpfe in den Schulkorridoren, wo die Kundigen ihre unkundigen Gegner kaltblütig zu Eunuchen quetschen?“25
6) Fazit: Das Wesen des Fuchses im weltweiten Vergleich
Der Fuchs ist zunächst, das wird beinah überall so erzählt, als listig charakterisiert. Wie er diese Schlauheit nutzt, ist bereits bei Aesop sehr unterschiedlich: Er verwendet sie mal, um sich selbst zu schützen, wie er es häufig in Gegenwart des Löwen tut, dann wiederum bringt er sich selbst auf Kosten anderer, die er absichtsvoll leiden lässt, aus der Gefahr („Der Fuchs und der Bock“, „Der Löwe, Wolf und Fuchs“) oder kritisiert mit gewitztem Spruch das Verhalten anderer wie in „Der Fuchs und der Holzhacker“. In den späteren, epischen Erzählungen über den Fuchs überwiegt seine Hinterlistigkeit, Boshaftigkeit und Grausamkeit, und es stellt sich eher die Frage,mit welcher Intention diese Werke, in denen der Fuchs dann auch einen Namen hat, geschrieben sind. Während Aesop noch didaktische und moralisierende Absichten hatte, sind die mittelalterlichen Fuchsromane in Frankreich und Flandern als Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen sowie als Parodien höfischer Ritterromane anzusehen, anschließend verwendete Goethe den Stoff, um Reineke in einem Schelmenroman auftreten zu lassen.
Es bleibt die Frage, warum dem Fuchs in derart weit voneinander entfernten Teilen der Welt annähernd gleiche charakterliche Eigenschaften zugesprochen wurden, die dann in entsprechende Fabel-Literatur einflossen. Die wahrscheinlichste Erklärung hierfür liegt in den frühesten naturwissenschaftlichen Werken. So hat sich z.B. im alten Japan der Fuchs häufig in den hohen Dielen von Tempeln eingenistet. Kam er nachts zur Beutejagd heraus, wurde seine Gestalt oft nur als schemenhaftes Gespenst wahrgenommen, was ihm ein dämonisches Bild bescherte.26
Aristoteles (384-322 v.Chr.) hat in seiner Eigenschaft als wissenschaftliche Autorität der damaligen Zeit ebenfalls zum schlechten Ruf des Fuchses beigetragen: Das Tier wird charakterisiert als „verschlagen und bösartig“27, es jage bei Nacht und habe den Raben und die Schlange, beides Tiere mit niedrigem Ansehen, als Gefährten. Zum Wolf äußerten sich die Gelehrten ebenfalls „fabelkonform“: Aristoteles bezeichnete ihn als „gefährlich“ und so gierig, dass er zur Not Erde fraß; Gaius Plinius Secundus d. Ältere (23-79), der an Aristoteles anknüpfte, stellte ebenfalls sein häufiges Fressen in den Vordergrund, das er nur unterbräche, „um neue Nahrung zu erbeuten“.28
Es erscheint logisch, dass aufgrund dieser biologischen Erkenntnisse, ob nun haltbar oder nicht, Tiere charakteristisch eingeordnet, anthropologisiert und dann in Geschichten eingebettet wurden, in denen sie Pate stehen für verschiedene menschliche Fähigkeiten und Wesenszüge.
III. „Der Fuchs im Netz“
Die Gestalt und das Wesen des Fuchses werden auch im modernen Kontext gerne für gerissene und häufig halb-legale Aktionen verwendet. So befindet sich im Internet unter www.kartenfuchs.de eine Pla ttform, unter der sich einander nicht bekannte Menschen an deutschen Bahnhöfe verabreden, um gemeinsam ein preiswertes Gruppen-Ticket zu benutzen.
Während die Deutsche Bahn sich übers Ohr gehauen fühlt, nach momentanem rechtlichen Stand aber nichts gegen diese List unternehmen kann, erkennen sich die Nutzer der ökonomischen Masche an einem comicartigen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fuchs-Symbol, das sie gut sichtbar auf den Bahnsteigen bei sich tragen müssen:
Selbstverständlich findet sich im weltweiten Netz auch die klassische Fuchs- und Fabel-Literatur, nach der im folgenden gesucht werden soll.
1) Die Suche nach dem literarischen Fuchs im Internet
Im folgenden soll die Frage behandelt werden, auf welche Weise eine systematische Suche nach dem literarischen Fuchs im Internet vonstatten gehen kann.
Natürlich ist es lohnenswert, die Homepages der großen deutschen Universitäten unter „Germanistik“ nach dem Fuchs zu durchsuchen. Für eine schnelle und effektive Suche zu einem bestimmten Thema gibt es aber keine Alternative zu den gängigen sogenannten Suchmaschinen. Für den deutschsprachigen Raum bieten sich z.Zt. beispielsweise die Adressen www.yahoo.de, www.infoseek.de oder www.fireball.de an; internationale Suchmaschinen zum Nachforschen des Fuchs- Phänomens weltweit besucht man z.B. unter www.yahoo.com, www.hotbot.com oder www.altavista.com.
Sucht man im Internet nach „Fuchs“, so erhält man zunächst biologische Definitionen, Bilder und Beschreibungen des Säugetieres (und Seiten von Menschen, die „Fuchs“ heißen). Beispiel: „Der Rotfuchs zählt zu den hundeartigen Raubtieren und wird 90 bis 140 Zentimeter lang. Davon entfallen 30 bis 50 cm auf den buschigen Schwanz.“29
„Fuchs“ als Synonym für Cleverness wird äußerst häufig als Werbemittel30 für Homepages verwendet, die nichts mit dem Fuchs gemein haben und lediglich ihre Internet-Adresse durch Nominativ-Komposita mit dem Stamm „Fuchs“ attraktiver erscheinen lassen wollen. So gibt es eine Internet-Buchhandlung unter www.buecher-fuchs.de, www.schlauer-fuchs.de soll auf witzige und interessante Internet-Inhalte durch Verknüpfungen verweisen und www.fuchsbriefe.de beinhaltet „ausgefuchste“ Informationen für Wirtschafts-Interessierte, Aktien- Anleger etc.
Fügt der Suchende das Kriterium „Literatur“ hinzu, so werden sowohl zahlreiche Hinweise auf Lehrbücher zum real existierenden Raubtier angeführt, als auch Verweise zu Fabeln und zu Goethes „Reineke Fuchs“. Sobald die Suchkriterien eingeengt werden auf „Fuchs Fabel Literatur“, zeigen die Suchmaschinen im Internet tatsächlich zahlreiche Adressen, auf denen sich einiges zum Thema Fuchsepik finden lässt.
Schwieriger ist nun die Suche nach reiner Fuchsliteratur in anderen Ländern bzw. auf anderen Kontinenten. Ein wirklich wertiges Ergebnis erzielt der Suchende wohl nur dann, wenn er die jeweilige Landessprache beherrscht und somit nach den Entsprechungen der Worte „Fuchs“ und „Literatur“ forschen kann. Aber auch mit der englischen Sprache kommt der Internet-Benutzer schon sehr weit: Nicht nur alle Seiten aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien bzw. den vielen anderen Ländern, in denen hauptsächlich englisch gesprochen wird, sind in dieser Sprache gehalten. Englisch ist ohne Zweifel die Hauptsprache im Internet, und so werden die Texte, von denen die Autoren überzeugt sind, dass sie im World Wide Web (www) weltweit auf Interesse stoßen, oftmals ins Englische übersetzt.
2) Suchergebnisse
Wie oben beschrieben ist der Ursprung der Fuchsliteratur bei Aesop zu suchen. Unter www.gutenberg.aol.de, einem der größten Literatur-Anbieter des deutschsprachigen Internets31, befindet sich eine „Aesop“-Sektion (www.gutenberg.aol.de/autoren /aesop.htm), in der sämtliche Fabeln des vorchristlichen Dichters zu finden sind. Dort befindet sich auch Goethes „Reineke Fuchs“ sowie die Fabeln Lessings und andere deutsche Tierfabeln. Dem englischsprachigen Publikum ist die Seite „Lazy Fox’s spot“ zugänglich; unter anderem befinden sich dort, unter www.tigress.com/lazyfox/greek.html sämtliche Fuchs-bezogenen Aesop-Fabeln.
Die Präsentation von Primär-Texten im Internet als Konkurrenz zum Buch wird immer wichtiger; so ist z.B. unter http://home.hiroshima-u.ac.jp/france/RRenart.html der gesamte Text des „Roman de Renart“ auf französisch und sogar auf japanisch abrufbar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die großen, bekannten Werke über den literarischen Fuchs sind ohnehin zahlreich im Internet vertreten; alleine Goethes Werk wird unter http://kuk.com/lara/goethe/ mit dem Projekt „Reineke Fuchs goes Internet“ und zahlreichen weiteren GoetheSeiten vielfach erwähnt.
Unter www.fantasten.de befindet sich „Pat Addy‘s Märchenwelt“, eine Homepage, die trotz ihres kinderfreundlichen Aufbaus weitgehend unverfälschte Erzählungen beinhaltet. Zwei Fuchs-Märchen aus dem Kaukasus sind hier zu finden, die nicht unbedingt für Kinder geeignet sind: „Der Fuchs und das Eichhörnchen“ und „Der Wolf und der Fuchs“. In ersterem wird der Fuchs das Opfer seiner eigenen Hochmut gegenüber dem vermeintlich dümmeren Eichhörnchen. Letzteres Märchen zeigt den Fuchs einmal mehr triumphierend gegen ein Kamel, das trotz physischer Kraft gefressen wird, und gegen den Wolf, welcher zunächst (wie so oft) Gefährte des listigen Protagonisten ist, dann jedoch an ihm scheitert.
„Der Fuchs und das Eichhörnchen“ wird als „Märchen der Armenier“, „Der Wolf und der Fuchs“ wird als „Märchen der Lesghier“ bezeichnet; beide Geschichten sind nacherzählt von Josef Guter, der seine Werke sonst im Herbig Verlag veröffentlicht.
Eine der besten deutschsprachigen Homepages, die sich mit dem literarischen Fuchs befassen, ist unter www.seeseiten.de/user/fuchsprojekt/ adressiert, dort befindet sich das „Fuchsprojekt Konstanz“. Unter der Rubrik „Fuchsfabeln aus aller Welt“ erhält man das, was der Name verrät, in großer Zahl. Der Autor der Internet-Seite weist in einem Vorwort ausdrücklich darauf hin, dass gute Unterhaltung mit den einzelnen Geschichten im Vordergrund stehe, wenngleich es auch für ihn ein beeindruckendes Phänomen ist, wie sehr sich der Fuchs charakterlich in den vielen, weit voneinander entfernten Ländern darstellt. „Interessant ist, dass der Fuchs durchaus nicht immer über seine Gegner triumphiert - wenn er auch in den meisten Fällen dank seiner sprichwörtlichen Schläue die Oberhand behält.“ Fabeln von La Fontaine sind hier ebenfalls zu finden.
Unter http://vulpes.here.de/ befinden sich „tierische Seiten rund um Fuchs & Co“ - die (nicht-kommerzielle) Homepage eines fuchs-verrückten Menschen, der über sein Hobby mit Zeichnungen, Bildern und jeder Menge Multimedia - Anwendungen zum Thema „Fuchs“ aufwartet und weitere derartige Fuchs-Seiten im Internet verrät.
Eine riesige Datenmenge zum Fuchs hält die englischsprachige Seite „Vulpes World - Suran's Fox Database“ unter www.furry.de/suran bereit. Diese Seite beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit dem „echten“ Fuchs, erwähnt aber auch viele der bekannten Fabeln und Romane und verweist auf weitere 29 englischsprachige, weltweit ansässige Internet-Seiten von Fuchs-Liebhabern im natur- und literaturwissenschaftlichen Bereich.
Erzählungen mit dem Fuchs der modernen, sogar futuristischen Art präsentiert die Seite http://www.mypage.bluewin.ch/hoepf/fhtop/fhinsel1A.html unter dem Titel „Fabeln unserer Nachfahren“ von F. Höpflinger. Dort ist unter anderem diese Kurzfabel, die Reinekes Wesen treffsicher beschreibt und in eine düstere Neuzeit überträgt, zu finden:
„Als der Fuchs den letzten Wal sterben sah, freute er sich. Denn er wusste, dass sein grösster Feind - der Mensch - seinem Untergang einen grossen Schritt nähergekommen war.“
Solange diese Prognose des Fuchses nicht eintritt, werden wohl noch zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt ihrem schlauen Lieblings-Schurken Respekt zollen und weitere Homepages über das berühmte Raubtier veröffentlichen. Ganz offensichtlich führt der literarische Fuchs seine Erfolgsgeschichte auch im Internet fort.
Literaturverzeichnis
Fühmann, Franz: „Reineke Fuchs...“, Hinstorff Verlag GmbH, Rostock 1993
Grimm, Jacob: "Reinhart Fuchs", Georg Olms Verlag, Hildesheim/New York, 1974
Grimm, Jacob und Wilhelm: „Deutsches Wörterbuch“, Verlag von S. Hirzel, Leipzig 1878
Jauss, Hans Robert und Köhler, Erich (Hrsg.): "Le Roman de Renart", Wilhelm Fink Verlag, München 1965
Kehne, Birgit: „Formen und Funktionen der Anthropologisierung in Reineke Fuchs-Dichtungen“, Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt/Main, 1992
Kuehnel, Irmeli: „An annotated Bibliography of ‚Reinhart Fuchs‘ Literature“, Kümmerle Verlag, Göppingen 1994
Künstlerkreis Ortenau, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (Hrsg.): „Der Fuchs“, Grimmelshausen Verlag, Oberkirch 1988
Landeszentrale für politische Bildung (LpD) (Hrsg.): „Flandern - eine europäische Region“, Heft 36, LpB Baden-Württemberg, 1998
Röhrich, Lutz: "Sage und Märchen", Verlag Herdecke, Freiburg - Basel - Wien 1976
Ruh, Kurt: „Höfische Epik des deutschen Mittelalters“, Teil 2, Schmidt, Berlin 1980
Stackelberg, Jürgen von: „Die Fabeln La Fontaines“, W. Fink Verlag, München 1995
Ulich/Oberhuemer/Reidelhuber (Hrsg.): "Der Fuchs geht um ...auch anderswo", Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1987
Wahle, Gerhard: "Reineke Fuchs“. Das mittelniederdeutsche Tierepos Reynke de Vos, Lübeck 1498, nach der Ausgabe Prien/Leitzmann, Halle/Saale, 1960 ins Neuhochdeutsche übertragen, ibidem-Verlag, Stuttgart, 2000
(Die Adressen sämtlicher verwendeter Internet-Quellen sind im Text oder in den dazugehörigen Fußnoten angegeben.)
[...]
1 Ruh, Kurt: „Höfische Epik des deutschen Mittelalters“, S. 18
2 Grimm, „Reinhart Fuchs“, S. 259
3 Kuehnel, "An Annotated Blibliography of Reinhart Fuchs Literature", S. 4-6
4 Wahle, "Reineke Fuchs", S. 10-11
5 Reineke Fuchs und die Ideologie / Goethe im Wortlaut, zitiert von Jost Nolte, in: Berliner Morgenpost, 07.02.1999
6 Kuehnel, "An Annotated Blibliography of Reinhart Fuchs Literature", S. 21
7 Fühmann, "Reineke Fuchs...", S. 318
8 Grimm: Reinhart Fuchs, S. 260
9 Dies ist eine der vielen Fabeln, die gut 2000 Jahre später im Grunde mit gleichem Inhalt von La Fontaine nacherzählt wird.
10 Grimm, „Deutsches Wörterbuch“, S. 331
11 Aus dem Vorwort von Jauss-Meyer in Jauss/Köhler (Hrsg.): "Le Roman de Renart", S. 7
12 Aus dem Vorwort von Jauss-Meyer in Jauss/Köhler (Hrsg.): "Le Roman de Renart", S. 8
13 von Stackelberg, „Die Fabeln La Fontaines“, S. 39
14 Auch diese Fabel basiert auf Aesop, dort ergaunert der Fuchs ein Stück Fleisch und spricht anschließend keine Moral.
15 von Stackelberg: "Fabeln La Fontaines", S. 63
16 Alle Informationen zu diesem Kapitel aus: LpD: „Flandern-eine europäische Region“, S. 44 - 46
17 „Vom blauen Schakal“ (Indisch: „Hitopadescha“), eine zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert entstandene Arbeit des indischen Dichters Narajan, in: Halbey, "Fabeln aus aller Welt", S. 6f
18 Röhrich, "Sage und Märchen", S. 61
19 Schultze, „Der Fuchs im Märchen“, in: „Der Fuchs“, S. 26
20 Etzel, Theodor (Hrsg.): "Fabeln und Parabeln der Weltliteratur", S. 41
21 Etzel, Theodor (Hrsg.): "Fabeln und Parabeln der Weltliteratur", S. 43
22 Grimm, "Reinhart Fuchs", S. 272
23 Etzel, Theodor (Hrsg.): "Fabeln und Parabeln der Weltliteratur", S. 427
24 Sämtliche Beispiele für die didaktische Nutzung des literarischen Fuchses aus: Ulich/Oberhuemer/Reidelhuber (Hrsg.): „Der Fuchs geht um ...auch anderswo“, Beltz Verlag. Weinheim und Basel 1987
25 Fühmann: „Reineke Fuchs...“, S. 318 (Fühmann hatte 1961 das niederdeutsche Volksbuch vom Reineke Fuchs kindergerecht umgeschrieben.)
26 Kehne, „Formen und Funktionen der Anthropologisierung in Reineke Fuchs-Dichtungen“, S. 21
27 Kehne, „Formen und Funktionen der Anthropologisierung in Reineke Fuchs-Dichtungen“, S. 38
28 Kehne, „Formen und Funktionen der Anthropologisierung in Reineke Fuchs-Dichtungen“, S. 40f
29 Zu finden unter der Adresse www.lahrer-hinkender-bote.de/art54.html, wo auch allgemeine Anmerkungen zum literarischen Fuchs gegeben werden.
30 Den altbekannten „Bauspar-Fuchs“ findet man unter www.schwaebisch-hall.de natürlich ebenso wie den Werbe-Fuchs, der auf www.henkel.de darüber informiert, dass man mit dem Waschmittel „Spee“ auf „die schlaue Art“ wäscht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text ist eine umfassende Analyse des Fuchses in der Literatur, von der Antike bis zur Gegenwart und über verschiedene Kulturen hinweg. Er untersucht, wie der Fuchs als literarische Figur dargestellt wird und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es in den Fuchserzählungen weltweit gibt.
Welche deutschsprachigen Werke werden in Bezug auf den Fuchs behandelt?
Der Text behandelt unter anderem "Reinhart Fuchs" von Heinrich (Anonymus), "Reynke de Vos" (Lübeck 1498) und "Reineke Fuchs" von Goethe. Er analysiert die Darstellung des Fuchses in diesen Werken und die gesellschaftlichen und politischen Kommentare, die sie enthalten.
Welche Rolle spielt der "Roman de Renart" in der Fuchsliteratur?
Der "Roman de Renart" aus dem altfranzösischen Raum wird als eine wichtige Quelle und thematische Grundlage für spätere Fuchserzählungen betrachtet, darunter "Reinhart Fuchs". Der Text erläutert, wie Episoden und Motive aus dem "Roman de Renart" in andere Werke übernommen wurden.
Wie wird der Fuchs in den Fabeln Äsops dargestellt?
In den Fabeln Äsops wird der Fuchs nicht immer als der clevere und überlegene Charakter dargestellt. Er tritt in verschiedenen Rollen auf, manchmal als Unterlegener oder als Kritiker des Verhaltens anderer. Der Text beleuchtet einige konkrete Fabeln, in denen der Fuchs vorkommt, und analysiert seine Rolle und Motivation.
Welche Bedeutung hat der Fuchs in Flandern?
In Flandern entstand das Versepos "Van den Vos Reynaerde", das als älteste und literarisch wichtigste niederländische Fassung des Fuchsstoffs gilt. Der Text beschreibt, wie Willem in seinem Werk eine verkehrte Welt darstellt, in der der Fuchs vorgegebenes ritterliches Ethos entlarvt und die Mächtigen ihrer eigenen Dummheit zum Opfer fallen.
Gibt es Fuchserzählungen aus anderen Kulturen und Ländern?
Ja, der Text erwähnt Fuchserzählungen aus Afrika, Asien und dem Orient. In einigen Kulturen wird der Fuchs durch den Schakal ersetzt, da es dort keine Füchse gibt. Der Text verweist auf indische Fabeln und Hexensagen, in denen der Fuchs eine Rolle spielt.
Wie wird der Fuchs im Schulunterricht eingesetzt?
Der Text erläutert, wie Pädagogen und Didaktiker die Figur des Fuchses und seine charakteristischen Eigenschaften nutzen, um Kindern bestimmte Werte und Moralvorstellungen zu vermitteln. Fabeln werden in Grundschulen eingesetzt, und es gibt Lieder und Spiele, in denen der Fuchs eine wichtige Rolle spielt.
Wie kann man im Internet nach Fuchsliteratur suchen?
Der Text gibt Tipps zur systematischen Suche nach Fuchsliteratur im Internet, einschließlich der Verwendung von Suchmaschinen und der Eingabe spezifischer Suchbegriffe wie "Fuchs Fabel Literatur". Er verweist auf verschiedene Homepages und Websites, auf denen man Fuchsfabeln und -erzählungen finden kann.
Welche Schlussfolgerungen werden über das Wesen des Fuchses gezogen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass der Fuchs in der Literatur oft als listig, hinterlistig und grausam dargestellt wird. Seine Motive und Absichten variieren jedoch je nach Werk und kulturellem Kontext. Die Darstellung des Fuchses spiegelt oft gesellschaftliche Verhältnisse und politische Kommentare wider.
- Citar trabajo
- Achim Zolke (Autor), 2000, Fuchsliteratur in Deutschland und weltweit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105272