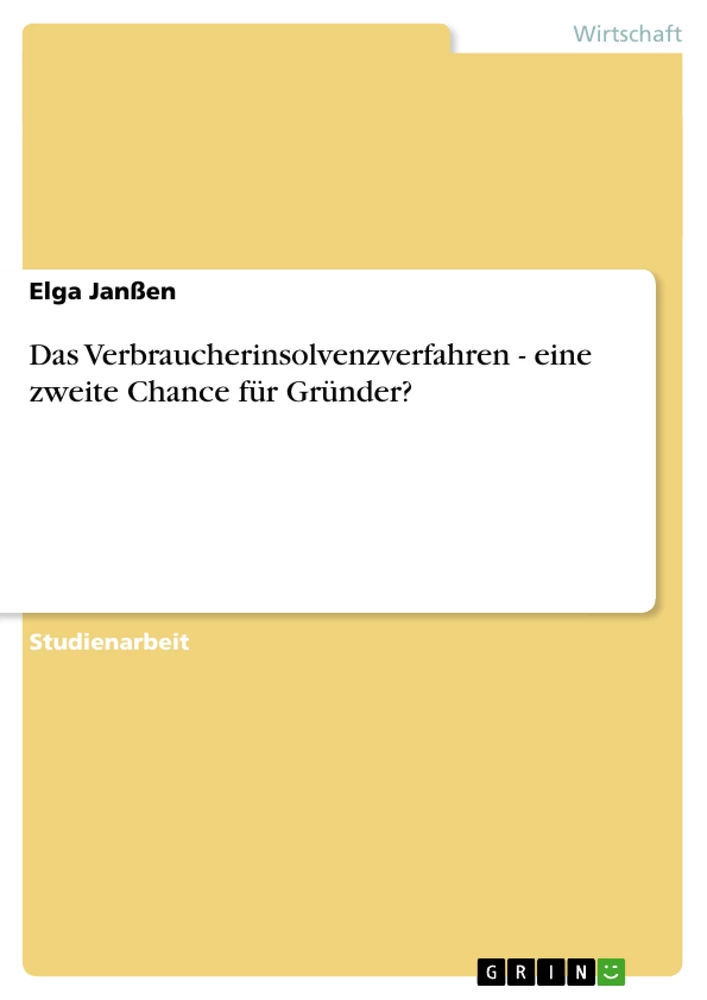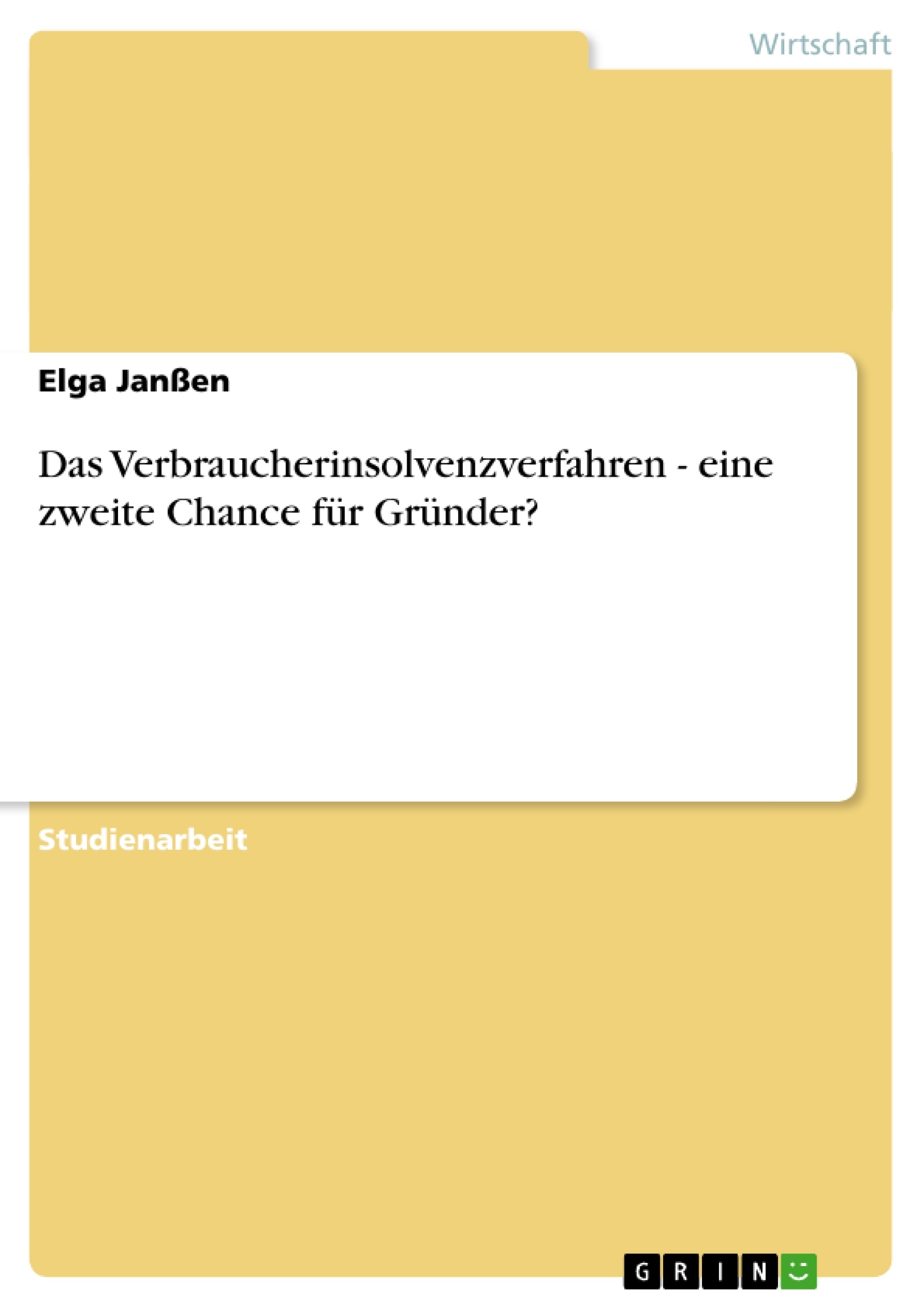Inhalt
1 EINLEITUNG
2 GESCHEITERTE EXISTENZGRÜNDER
2.1 ZAHL DER INSOLVENZEN IN DEUTSCHLAND
2.2 DEUTSCHLAND BRAUCHT EINE KULTUR DER PLEITE
2.3 GRÜNDE DES SCHEITERNS
3 DIE INSOLVENZORDNUNG (INSO)
3.1 BEGRIFF DES INSOLVENZRECHTS
3.2 DIE INSOLVENZRECHTSREFORM
3.3 INKRAFTTRETEN
3.4 ZIELE
3.5 ERÖFFNUNG DES VERFAHRENS, VORAUSSETZUNGEN
3.6 DAS VERBRAUCHERINSOLVENZVERFAHREN
3.6.1Anwendungsbereich
3.6.2Die einzelnen Stufen des Verfahrens
3.6.2.1 Der außergerichtliche Einigungsversuch
3.6.2.2 Der gerichtliche Schuldenbereinigunsplan
3.6.2.3 Vereinfachtes Insolvenzverfahren
3.6.2.4 Die Wohlverhaltensperiode/Restschuldbefreiung
4 HINDERNISSE, HÜRDEN, STOLPERSTEINE
4.1 DIE KOSTEN DES VERFAHRENS
4.2 DAUER DES VERFAHRENS
4.3 VORRANG VON ABTRETUNGEN
4.4 VERBRAUCHER- ODER REGELINSOLVENZ?
5 GEPLANTE ÄNDERUNGEN DER INSO
5.1 DER GESETZENTWURF DER PDS
5.2 DER GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG
5.2.1Kosten des Insolvenzverfahrens
5.2.2Dauer des Verfahrens
5.2.3Lohnabtretungen
5.2.4Verbraucher- oder Regelinsolvenz?
6 ZUSAMMENFASSUNG/AUSBLICK
7 LITERATURANGABEN
1 Einleitung
Existenzgründung - ein Modewort?
Bereits im Dezember 1995 wurde das Existenzgründer-Institut Berlin e.V.1 gegründet, das zum Ziel hat, den Entrepreneurship - Gedanken in Deutsch- land zu fördern und das Thema "Existenzgründung" an die Hochschulen zu tragen.2
Die Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie hat in Zusammenarbeit mit dem Existenzgründer-Institut Berlin e.V. und der Investitionsbank Berlin den "Existenzgründungsführer der Berliner Hochschulen - Wegweiser zum Berliner Hochschulnetzwerk" herausgegeben.3
Und selbst das Arbeitsamt berät Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte auf dem Weg in die Selbständigkeit.4(Aufgrund der Beendigung des 3-jährigen Förderzeitraumes im Juli 2001 stellt allerdings die WBS Training AG die Tätigkeit des Existenzgründerbüros am 13.07.2001 ein.5)
Für ein besseres Gründerklima in Deutschland hat sich am 20.05.01 Rolf Schwanitz, Staatsminister der Bundesregierung für Angelegenheiten der neuen Länder, auf den Existenzgründertagen in Berlin6ausgesprochen7.
Fazit: Der Weg in die Selbständigkeit, die Existenzgründung, wird geför- dert. Ob Arbeitslose, Hochschulabsolventen, Angestellte oder sonstige Gründer - Existenzgründung wird als ein Mittel zur Verhinderung von Ar- beitslosigkeit und zur allgemeinen Wirtschaftsförderung angesehen (Auf- schwung Ost?).8
Jedoch ist eine Existenzgründung immer mit einem gewissen Risiko verbunden, wie die neueste Entwicklung im Bereich der "Start-ups" insbesondere im Internet - Bereich (sogenannte DOTCOMS) verdeutlicht:
Auf "PINK - SLIP - PARTYS"9, so benannt nach den rosafarbenen Umschlä- gen der Kündigungsschreiben amerikanischer Unternehmen, treffen sich die ehemaligen Angestellten der DOTCOMS, die durch die Pleite ihrer Firmen arbeitslos wurden.
Was bedeutet das Scheitern nun für die betroffenen Firmen? Was wird aus den Gründern?10Was wird aus den Einzelunternehmern, aus den Gesellschaftern einer GbR?
Werden diese jemals wieder die Chance haben, erneut ein Unternehmen zu gründen?
Die am 01.01.1999 in Kraft getretene neue Insolvenzordnung sollte es u. a. erleichtern, Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, zu sa- nieren und fortzuführen, so die Zahl der Unternehmenspleiten zu verringern und Privatleuten, Freiberuflern sowie Kleingewerbetreibenden nach einer "WOHLVERHALTENSPERIODE" von fünf (Altfälle) bzw. sieben Jahren durch Erlass der Restschulden wieder die Teilnahme am wirtschaftlichen Leben ermöglichen.
In dieser Hausarbeit werde ich der Frage nachgehen, ob die reformierte In- solvenzordnung diesen Anforderungen genügt. Dabei beschränke ich mich auf die Betrachtung des Verbraucherinsolvenzverfahren, da die Einbeziehung der Regelinsolvenz den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.11
Aufgrund der Aktualität des Themas war ich bei meiner Recherche und Literaturauswahl in besonderem Maße auf das Internet angewiesen (s. Literaturverzeichnis im Anhang).
2 Gescheiterte Existenzgründer
2.1 Zahl der Insolvenzen in Deutschland
Die Ergebnisse der Studien, die die Creditreform e. V.1213in regelmäßigen Abständen durchführt, sind erschreckend:
Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland stieg im ersten Halbjahr 2001 auf 22.300.14
Dabei ist der Anstieg der Insolvenzen in den neuen Bundesländern um 25,6 % gegenüber dem Vorjahr besonders auffällig.15
Die Creditreform e. V. beziffert die durch Insolvenzen hervorgerufenen Schäden auf 35 Mrd. DM im ersten Halbjahr 2001. In Westdeutschland sei pro Insolvenzfall mit einem Schaden von 890.000 DM zu rechnen - in Ostdeutschland mit 1.110.000 DM.16
Die Statistiken des statistischen Bundesamtes beziehen sich auf den Zeitraum bis 1998, also vor Inkrafttreten der neuen Insolvenzordnung.17
Zahl der Insolvenzen 1998 nach Rechtsformen18
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zahl der Insolvenzen 1998 nach Alter (des Unternehmens)19
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
78,5 Prozent der Unternehmen und freien Berufe, die ein Konkursverfahren (alte Bundesländer) oder ein Insolvenzverfahren nach der Gesamtvoll- streckungsordnung (neue Bundesländer) beantragten, waren noch keine 8 Jahre alt.
Das statistische Landesamt Berlin20verfügt über neuere Zahlen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es erstaunt die immer noch - trotz Insolvenzrechtsreform - hohe Anzahl der mangels Masse abgelehnter Verfahren (s. u.).
2.2 Deutschland braucht eine Kultur der Pleite
"Kapitalismus ohne Konkurs ist wie Christentum ohne Hölle" - mit diesem Zitat von Frank Borman, CEO Eastern Airlines, beginnt ein Bericht über eine Veranstaltung der EU-Kommission zum Thema "Unternehmensmisser- folg" am 11. und 12.5.2001 in Noordwijk.21Einer von der Boston Consul- ting Group22für die EU-Kommission durchgeführten Untersuchung zufolge findet sich die extremste Neustart-feindliche Einstellung in Österreich und Deutschland: „Kein Neustart - Konkurs ist eine gerechte Strafe für den ge- scheiterten Unternehmer“.23
EOS Gallup Europe führte im September 2000 eine telefonische Befragung in fünfzehn europäischen Ländern und in den USA zum Thema "ENTREPREUNEURSHIP" durch, die zum Ziel hatte, herauszufinden, wie eini- ge Aspekte unternehmerischer Aktivitäten durch die Öffentlichkeit beurteilt werden.24
3. Etes-vous toutàfait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord avec les propositions suivantes ?
a) Les personnes qui ont lancéleur propre affaire et qui ontéchouédevraient recevoir une seconde chance.
3. Do you strongly agree, agree, disagree or strongly disagree with the following state- ments ?
a) People who started their own business and failed should be given a second chance.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Flash Eurobarometer 83: esprit d’entreprise/entrepreneurship study (septembre 2000)25
Der Aussage "Personen, die sich selbständig gemacht haben und gescheitertsind, sollte eine zweite Chance gegeben werden" stimmten 83 % der Befragten sowohl in Europa insgesamt als auch in Deutschland zu; augenfällig ist dabei der Unterschied zwischen Ost- und West-Deutschland.
Bei der Aussage "Man sollte sich nicht selbständig machen, wenn das Ri-siko des Scheiterns besteht" zeigten sich allerdings große Unterschiede zwi- schen den Befragten in den USA und in Europa. Während nur 27 % der US- Amerikaner der Aussage zustimmten, waren es 45 % der befragten Euro- päer. Deutschland liegt dabei mit 56 % um einiges über dem Durchschnitt. An erster Stelle liegt dabei wiederum Ost-Deutschland mit 64 %.
Hier zeigt sich zwar eine gewisse Toleranz gescheiterten Existenzgründern gegenüber - allerdings ist auch ersichtlich, dass in Europa und dabei insbesondere in Deutschland (Ost) die Bereitschaft, bei einer Existenzgründung das Risiko des Scheiterns einzugehen, nicht eben hoch ist.
Die Angst vor der mit dem Scheitern verbundenen Stigmatisierung sowie dem völligen finanziellen Ruin führt dazu, dass viele Selbstständige ihr Un- ternehmen so lange aufrecht erhalten, bis es für eine Sanierung zu spät ist und alle finanziellen Reserven aufgebraucht sind.
Gescheiterte Unternehmensgründer auszugrenzen und in den finanziellen Ruin zu treiben, widerspricht den wirtschaftlic hen Erfordernissen:
"Unser Land braucht Menschen mit Kreativität, Visionen und Fähigkeiten, diese in Form von neuen Produkten, Prozessen und Dienstleistungen am Markt umzusetzen."26
Gescheiterte Existenzgründer bringen bereits Erfahrungen als Gründer mit. Und sie haben die Möglichkeit, aus ihren Fehlern zu lernen.
Gerade diejenigen, die diese Erfahrungen bereits gemacht haben, sollten daher die Möglichkeit einer erneuten Gründung erhalten.
2.3 Gründe des Scheiterns
Im Rahmen einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Be- rufsforschung wurden 1997 1139 Existenzgründer, deren Existenzgründung in den Jahren 1994/1995 durch das Arbeitsamt gefördert wurden, befragt27.
70 % der ehemals geförderten waren zum Zeitpunkt der Befragung noch selbständig. Als Gründe für die Aufgabe der Selbständigkeit wurden von denen, die nicht mehr selbständig waren, genannt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung28
M. Woiwode untersucht anhand von Daten, die durch die Creditreform e. V. erhoben wurden, die Ursachen von Unternehmensschließungen.29
Die Ergebnisse fasse ich wie folgt in Stichpunkten zusammen:30
1. Mit steigender Unternehmensgröße sinkt die Insolvenzwahr- scheinlichkeit.
2. Diese sinkt ebenso mit steigendem Unterne hmensalter.
3. Mit zunehmenden Alter des Unternehmers/der Unternehmerin sinkt die Insolvenzwahrscheinlichkeit.
4. Unternehmen, die von jungen Personen geführt werden, haben eine überdurchschnittlich hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit.
5. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Rechtsform (Haftungs- beschränkung) von Unternehmen und der Insolvenzwahrscheinlic h- keit.
6. Es zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen (in Bezug auf die Schließungswahrscheinlic h- keit).
7. Unternehmen, die von Frauen geführt werden, haben eine höhere In- solvenzwahrscheinlichkeit, als von Männern geführte. (Wettbe- werbsnachteile von Frauen?)
Insbesondere die ersten vier Punkten lassen vermuten, dass die Insolvenzwahrscheinlichkeit neu gegründeter KMUs besonders hoch ist.
3 Die Insolvenzordnung (InsO)
3.1 Begriff des Insolvenzrechts
Obermüller/Hess grenzen die Insolvenz von der Liquidation ab: Eine Liquidation erfolgt, wenn die Gesellschafter beschließen, die Gesellschaft abzuwickeln, ohne dass ein Insolvenzgrund vorliegt.31
Im Unterschied dazu droht im Fall einer Insolvenz das Vermögen der Gesellschaft (bzw. einer Einzelperson) zu verfallen.
Das Insolvenzrecht umfasst damit alle gesetzlichen Normen, die den Austritt einer Gesellschaft bzw. eines Einzelunternehmer aus dem Markt regeln, wenn die Interessen der Gläubiger in Gefahr geraten. Dabei wird im Unterschied zur Einzelzwangsvollstreckung das gesamte Vermögen „von dem Insolvenzbeschlag erfasst".32
Weitere insolvenzrechtliche Regelungen finden sich - außer in der am 05.10.94 verabschieden Insolvenzordnung - in der Zivilprozessordnung (ZPO), dem Strafgesetzbuch (StGB) und dem Sozialgesetzbuch (SGB III).
3.2 Die Insolvenzrechtsreform
Am 01.01.1999 trat das neue Insolvenzrecht in Kraft. Es löst damit die Konkurs- und Vergleichsordnung der alten Bundeslä nder sowie die Gesamtvollstreckungsordnung, die in den neuen Bundesländern nach 1990 weiterhin galt, ab (s. Art. 2 EGInsO).
Gründe für diese Reform waren demnach die Vereinheitlichung der Konkursordnungen in Ost und West sowie die Mängel der im Jahre 1879 in Kraft getretenen Konkursordnung: So wurden etwa ¾ aller Verfahren wegen Massearmut gar nicht erst eröffnet:33
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt34
1998 wurden demnach 73,5 % aller beantragten Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt. Die Zahl der beantragten Konkursverfahren hat sich zwi- schen 1960 und 1990 fast verfünffacht, zwischen 1960 und 1998 mehr als versechsfacht.
Das Verbraucherkonkursverfahren wurde Teil der Insolvenzordnung. Die Vorschläge der Schuldnerberater, den Verbraucherkonkurs in einem eigenen Gesetz zu regeln, da das Verfahren für Verbraucher viel zu kompliziert und zu teuer sei, fanden kein Gehör. „Die Verbraucherinsolvenz ist schon sys- tematisch falsch in der Insolvenzordnung für die Wirtschaft geregelt.“35Das Verbraucherkonkursverfahren schien im Rahmen der Insolvenzrechtsreform leichter durchsetzbar.
Am 18.10.1994 erfolgte die Veröffentlichung des Gesetzes im Bundesge- setzblatt.
3.3 Inkrafttreten
Im Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO36) ist das Inkrafttreten geregelt:
Nach §110 Abs. 1 EGInsO treten die Insolvenzordnung und das EGInsO am 01.01.1999 in Kraft, „soweit nichts anderes bestimmt ist". In Abs. 2 werden die Artikel der InsO aufgeführt, die bereits am Tag nach der Verkündigung des Gesetztes in Kraft treten. Dabei geht es um die Bestimmung von Amts- gerichten zu Insolvenzgerichten, die Zuständigkeit von Oberlandesgerichten bei Beschwerden m Rahmen der InsO, die Bestimmung „geeigneter Stel- len" (s. u.) und vorläufiger Insolvenzverwalter sowie deren Vergütung. Ins- gesamt also um Regelungen, die der Vorbereitung des Inkrafttretens der InsO die nten.
Ursprünglich war das Inkrafttreten der Insolvenzordnung zum 01.02.1997 vorgesehen, auf Druck einiger Bundesländer wurde dieser Termin nach ei- nem Vorschlag des Vermittlungsausschusses auf den 01.01.1999 verscho- ben.
Es wurde befürchtet, der Ansturm der Schuldner37auf die Gericht würde die öffentlichen Kassen zu sehr belasten.
Aufgrund dieser „Verschiebung" wurde u. a. die „Altfall-Regelung" getroffen, die eine Verkürzung der „Wohlverhaltensperiode" (s. u.) von sieben auf fünf Jahre beinhaltet.
3.4 Ziele
Vorrangiges Ziel der InsO ist die bestmögliche Gläubigerbefriedigung. Erst an zweiter Stelle geht es um eine Restschuldbefreiung: „Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien." (§1 Abs. 2 InsO)
Der Begriff des „redlichen Schuldners" spielt im Verbraucherkonkurs eine große Rolle und zieht sich wie ein roter Faden durch das Gesetz.
3.5 Eröffnung des Verfahrens, Voraussetzungen
Das Insolvenzverfahren kann über das Vermögen juristischer wie natürlicher Personen eröffnet werden (§ 11, Abs. 1 InsO).
Es wird nur auf Antrag eröffnet. Antragsberechtigt sind nicht nur die Schuldner, sondern auch die Gläubiger. (§ 13 Abs. 1 InsO)
Zur Eröffnung des Verfahrens muss ein Eröffnungsgrund vorliegen. (§ 16 InsO). „Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit“ (§ 17 Abs. 1). Im zweiten Absatz wird die Zahlungsunfähigkeit definiert: Der Schuldner, der seine fällig gewordenen Zahlungspflichten nicht erfüllen kann, ist zahlungsunfähig. Anzunehmen ist dieses, wenn er die Zahlungen eingestellt hat. (§ 17 Abs. 2 InsO).
Bestimmte Umstände können für eine Zahlungseinstellung sprechen, wie Aufgabe des Geschäftsbetriebes, Nichtzahlung von Energielieferungen, Löhnen und Gehältern, Krankenkassenbeiträgen, Steuern. In der Regel soll- ten mehrere Indizien zusammentreffen - das Nichtabführen von Steuern ist z. B. alleine noch kein Indiz für eine Zahlungsunfähigkeit. Kommen je doch Haftbefehle zur Erzwingung der Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung hinzu, ist eine Zahlungsunfähigkeit wohl eher anzunehmen.38
Auch drohende Zahlungsunfähigkeit kann ein Eröffnungsgrund sein, alle r- dings nur dann, wenn der Schuldner selbst den Antrag stellt (§ 18 Abs. 1). Er droht, zahlungsunfähig zu werden, wenn er seine bestehenden Zahlungs- verpflichtungen voraussichtlich im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht erfüllen kann (§ 18 Abs. 2).
Problematisch ist natürlich die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit. Obermüller/Hess schlagen zur Lösung dieses Problems mehrwertige Prognosen vor.39
Überschuldung gilt nur bei juristischen Personen als Eröffnungsgrund für das Insolvenzverfahren (§ 19 InsO).
3.6 Das Verbraucherinsolvenzverfahren
In den § 304 ff InsO ist das Verbraucherinsolvenzverfahren geregelt, das ich im folgenden Abschnitt skizzieren werde.
3.6.1 Anwendungsbereich
Das Verbraucherinsolvenzverfahren kann von natürlichen Personen bean- tragt werden, die keine oder nur eine geringfügige wirtschaftliche Tätigkeit ausüben40(§ 304 Abs. 1). In Abs. 2 wird die geringfügige wirtschaftliche Tätigkeit definiert: Sie ist dann geringfügig, „wenn sie nach Art oder Um- fang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert“. Dieses trifft auf Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) zu sowie auf Einzelunternehmer, die nicht im Handelsregister eingetragen und nicht überwiegend kaufmännisch tätig sind. (z. B. Freiberufler).
3.6.2 Die einzelnen Stufen des Verfahrens
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.6.2.1 Der außergerichtliche Einigungsversuch
Der Schuldner hat beim Antrag auf Eröffnung des Verfahrens eine Bescheinigung einer „geeigneten Person oder Stelle“ über das Scheitern einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern vorzulegen. Diese darf nicht älter als sechs Monate sein und muss auf der Grundlage eines Planes erfolgt sein. (§ 305 Abs. 1, Nr. 1 InsO).
3.6.2.1.1 Geeignete Personen oder Stellen
Welche Personen oder Stellen als geeignet anzusehen sind, wurde vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt. Gemäß § 305 Abs. 1, Nr. 1 InsO können die Länder dieses bestimmen.
In Berlin entscheidet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo)41über die Anerkennung. Dabei sollen die Stellen anerkannt werden, die eine qualifizierte Schuldnerberatung anbieten können.
Allein aufgrund ihres Berufes gelten Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare42als geeignete Personen nach § 305 Abs. 1, Nr. 1 InsO.
3.6.2.1.2 Die Bescheinigung
An das Ausstellen der Bescheinigung sind keine hohen Anforderungen zu stellen. So ist es ist nicht erforderlich, dass die geeignete Person oder Stelle die Verhandlungen selbst geführt hat.43
3.6.2.1.3 Der Plan
Der außergerichtliche Einigungsversuch hat auf der Grundlage eines Planes, z. B. eines Zahlungs- oder Tilgungsplan zu erfolgen. Der Schuldner hat bei der Ausgestaltung dieses Planes völlig freie Hand, er unterliegt damit der Privatautonomie.
Der außergerichtliche Einigungsversuch wurde dem gerichtlichen Verfahren vorangestellt, da man hoffte, dadurch viele Verfahren ohne Einschaltung der Gerichte zu lösen und so Gerichtskosten einzusparen. Der befürchtete Sturm auf die Gericht blieb dann allerdings auch aus, nur aus anderen Gründen! (s. u.)
Außergerichtliche Einigungsversuche scheitern in der Regel, wenn der Schuldner im Falle des Scheiterns nicht die Möglichkeit hat, das gerichtliche Verfahren zu beantragen (zu den Gründen: s. u.) und die Gläubiger dieses wissen bzw. vermuten.
3.6.2.1.4 Der Antrag
Kommt kein Vergleich mit den Gläubigern zustande (wobei alle Gläubiger dem Plan zustimmen müssten), erfolgt der nächste Schritt: Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird beantragt. Dem Antrag ist die Bescheinigung der geeigneten Stelle (s. o.) über das Scheitern des außergerichtlichen Eini- gungsversuches beizufügen, ein ausgefülltes Vermögens-, ein Gläubiger- und Forderungsverzeichnis sowie ggf. ein Antrag auf Erteilung der Rest- schuldbefreiung.
Der Antrag ist formlos zu stellen. Es existieren verschiedene Vordrucke (Heidelberger, Darmstädter Antragsformular, vereinfachtes Formular des AKInsO44...).
3.6.2.2 Der gerichtliche Schuldenbereinigunsplan
Auch ein Schuldenbereinigungsplan ist dem Antrag beizufügen. Dessen Gestaltung unterliegt, wie auch die des außergerichtlichen Einigungsversu- ches, der Privatautonomie. Das Gesetzt schreibt lediglich vor, dass die darin enthaltenen Regelungen den Gläubigerinteressen entsprechen sollen, unter Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuldners, und dass diese zu einer angemessenen Schuldenbereinigung führen sollten (§ 305 Abs. 1 InsO).
Bis zur Entscheidung über den Plan ruht das Verfahren über den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 306).
Das Gericht verschickt den Plan an die Gläubiger. Diese haben die Gele- genheit, innerhalb einer Notfrist von einem Monat darauf zu reagieren. Ge- ben Sie innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme ab, gilt dieses als Zu- stimmung.
Stimmen alle Gläubiger zu, hat der Schuldenbereinigungsplan die Wirkung eines Vergleiches im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung (s. § 308 InsO).
Hat dem Plan mehr als die Hälfte der Gläubiger zugestimmt und betragen die Forderungen der zustimmenden Gläubiger mehr als die Hälfte der Ge- samtforderungen (Summen- und Kopfmehrheit), so kann unter bestimmten Voraussetzungen die Zustimmung einzelner Gläubiger ersetzt werden (s. § 309 InsO).
3.6.2.3 Vereinfachtes Insolvenzverfahren
Das Verfahren zur Aufnahme des Antrages zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird wieder aufgenommen, wenn eine Zustimmungsersetzung nicht möglich ist (§ 311 InsO).
Bei der Eröffnung des Verfahren wird ein Treuhänder bestimmt, der die Aufgaben des Insolvenzverwalters wahr nimmt (§ 313, Abs. 1 InsO).
Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen beim Treuhänder anzumelden (§ 174 InsO).
Im vereinfachten Verfahren wird, anders als im Regelinsolvenzverfahren, das einen Berichtstermin vorsieht, nur ein Prüftermin bestimmt (§ 312 Abs. 1 InsO), indem die Forderungen ihrem Betrag und ihrem Rang nach geprüft werden (§176 InsO).
Nach dem Prüftermin können Barmittel, die evt. in der Insolvenzmasse vorhanden sind, an die Insolvenzgläubiger verteilt werden (§ 187 InsO).
Sobald die Verwertung der Insolvenzmasse beendet ist, erfolgt die Schluss- verteilung (§ 196 InsO). Zusammen mit der Zustimmung zur Schlussver- teilung legt das Insolvenzgericht den Schlusstermin fest. Dabei werden die Schlussrechnung des Insolvenzverwalters erörtert, können Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis erhoben werden und die Gläubiger über nicht verwertbare Gegenstände der Insolvenzmasse entscheiden (§ 197, Abs. 1 InsO).
3.6.2.4 Die Wohlverhaltensperiode/Restschuldbefreiung
Ein für Schuldner besonders wichtiger Aspekt (der wichtigste?) ist die Möglichkeit, von den Verbindlichkeiten gegenüber den Insolvenzgläubigern befreit zu werden, die durch die Verwertung der Insolvenzmasse im Insolvenzverfahren nicht erfüllt werden konnten.
Die Restschuldbefreiung können nur natürliche Personen erlangen (§ 286 InsO). Restschuldbefreiung wird nur gewährt, wenn diese ausdrücklich beantragt wurde (§ 287, Abs. 1 InsO).
Dem Antrag ist eine Erklärung des Schuldners beizufügen, dass seine pfändbaren Bezüge aus einem Dienstverhältnis für die Dauer von sieben Jahren45an den Treuhänder abgetreten werden.
Im Schlusstermin entscheidet das Insolvenzgericht über den Antrag des Schuldners auf Restschuldbefreiung (§ 289, Abs. 1 InsO).
3.6.2.4.1 Versagungsgründe
§ 290 InsO führt die Tatbestände auf, die, auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, zum Versagen der Restschuldbefreiung führen können:
- Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten nach §§ 283 bis 283 c StGB (Bankrott, Konkursverschleppung etc.). Dieses gilt auch bei einer rechtskräftigen Verurteilung aufgrund einer Insolvenzstraftat im Zeitraum zwischen dem Schlusstermin bis zum Ende der Wohlverhaltensperiode (§ 297 InsO).
- Unrichtige oder unvollständige Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse, um einen Kredit zu erhalten, Leistungen aus öffentli- chen Mitteln zu beziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen zu vermeiden, innerhalb von 3 Jahren vor Antragstellung Ø Versagung der Restschuldbefreiung innerhalb von zehn Jahren vor Antragstellung (dieser Grund kann noch keine Rolle spielen, da das Gesetz erst vor gerade 2 Jahren in Kraft trat)
- Beeinträchtigung der Befriedigung der Insolvenzgläubiger durch Be- gründung unangemessener Verbindlichkeiten oder durch Vermö- gensverschwendung
- Verletzung von Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuld- ners im Verfahren
- Unrichtige oder unvollständige Angaben in den Vermögens- und Einkommensverzeichnissen, die nach § 305, Abs. 1 Nr. 3 InsO vorzulegen sind.
3.6.2.4.2 Obliegenheiten
Wenn der Schuldner während der Laufzeit der Abtretungserklärung seine Obliegenheiten verletzt, versagt ihm das Insolvenzgericht die Restschuldbefreiung (§ 296 InsO).
Zu den Obliegenheiten zählen (§ 295 InsO):
- Ausübung einer angemessenen Erwerbstätigkeit
- Herausgabe der Hälfte einer Erbschaft an den Treuhänder
- Angabe eines Wechsels der Beschäftigungsstelle oder des Wohn- sitzes, Auskünfte über Bezüge, Vermögen und Erwerbstätigkeit
- Keine Bevorzugung einzelner Insolvenzgläubiger - Zahlungen nur an den Treuhänder zu leisten
Sollte der Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausüben, müssen seine Zahlungen an den Treuhänder in der Höhe denen entsprechen, die er bei Eingehung eines angemessenen Dienstverhältnisses leisten müsste.
3.6.2.4.3 Deckung der Mindestvergütung
Auf Antrag des Treuhänders wird die Restschuldbefreiung versagt, wenn dessen Mindestvergütung nicht gedeckt ist (§ 289 InsO).
3.6.2.4.4 Ausgenommene Forderungen
In § 302 InsO sind die Forderung aufgeführt, die von einer Restschuldbefreiung ausgenommen sind. Diese können also nach Abla uf der Laufzeit der Abtretungserklärung weiterhin geltend gemacht werden:
- Verbindlichkeiten aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Hand- lung
- Geldstrafen und gleichgestellte Verbindlichkeiten nach § 39 Abs. 1 Nr. 3 InsO (Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder...)
3.6.2.4.5 Abschluss des Verfahrens
Nach Beendigung der Laufzeit der Abtretungserklärung entscheidet das In- solvenzgericht über die Erteilung der Restschuldbefreiung (§ 300, Abs. 1 InsO). Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen (§ 300, Abs. 3 InsO).
3.6.2.4.6 Wirkung der Restschuldbefreiung
Die Forderungen sämtlicher Insolvenzgläubiger, auch derer, die ihre Forderungen nicht angemeldet hatten, können gegenüber dem „restschuldbe- freiten Schuldner“ nicht mehr geltend gemacht werden. Die Forderung erlöscht jedoch nicht. Sie wird zu einer Verbindlichkeit, die weiterhin erfüllbar, aber nicht mehr erzwingbar ist.
Welche Folgen diese Regelung für die „restschuldbefreiten Schuldner“ hat, bleibt abzuwarten.
4 Hindernisse, Hürden, Stolpersteine...
Der von einigen erwartete Ansturm auf die Insolvenzgerichte blieb aus.
Im 1. Halbjahr 2001 wurden einer Untersuchung der Creditreform e. V.46 zufolge in Deutschland lediglich 6.000 Verbraucherinsolvenzverfahren er- öffnet. Die Zahl der überschuldeten Haushalte beträgt Schätzungen zufolge über 2 Millionen47.
M. Schütz kommt in seiner Auswertung der Pflichtveröffentlichungen im Bundesanzeiger48im Zeitraum 01. - 31.07.2000 zu dem Ergebnis, dass „das Verbraucherinsolvenzverfahren bisher in der jetzigen gesetzlichen Fassung nicht geeignet ist, Überschuldung mehr als nur marginal abzubauen, wenn- gleich es auch im Einzelfall eine deutliche Entlastung für den Schuldner darstellen kann“.49
Warum dieses so ist und was der Gesetzgeber plant, dagegen zu tun, werde ich im nun folgenden Abschnitt anhand einiger ausgewählter Punkte darle- gen.
4.1 Die Kosten des Verfahrens
Schuldner verfügen in der Regel bei Antragsstellung nicht mehr über die notwendigen Mittel, um die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Reserven sind oft restlos aufgebraucht. Viele haben bereits jahrelange Lohnpfändun- gen erduldet und sind durch die Vollstreckungsversuche der Gläubiger „kahlgepfändet“.
Reicht das Vermögen des Schuldners nicht aus, die Kosten des Verfahrens zu decken und kann er auch keinen Vorschuss leisten, so weist das Insolvenzgericht den Antrag mangels Masse ab (§ 26 Abs. 1).
Die Gewährung von Prozesskostenhilfe wird von den meisten Gerichten abgelehnt, so dass dem überwiegenden Teil der Schuldner der Gang in das gerichtliche Verfahren verwehrt bleibt.
Auch ergibt sich die absurde - und vor allem ungerechte - Situation, dass es alleine vom Wohnort des Schuldners, d. h. vom Gerichtsbezirk, in dem er wohnt, abhängt, ob er Prozesskostenhilfe erhält oder nicht.
Günter König, Richter am Landgericht Oldenburg, veröffentlicht auf der Homepage des OLG Oldenburg eine umfassende Umfrage zur Gewährung von Prozesskostenhilfe im Verbraucherinsolvenzverfahren.50 Demnach wohnen annähernd 80 % der Bevölkerung in Gerichtsbezirken, in denen für das eröffnete Verfahren keine Prozesskostenhilfe gewährt wird.
Die Kosten des Verbraucherinsolvenzverfahrens werden auf ca. 4.000 DM geschätzt. Eine Beispielsberechnung der Kosten findet sich auf der Homepage des Forums Schuldnerberatung.51
4.2 Dauer des Verfahrens
Die Dauer des Verfahrens mit fünf (Altfall) bzw. sieben Jahren ist zu lang bemessen. Kaum jemand kann einen Zeitraum von sieben Jahren über- blicken.
In der amerikanischen Vergleichsordnung ist ein Zeitraum von lediglich vier Jahren vorgesehen. Das entspräche auch in etwa der Planungsperiode privater Haushalte.52
Zudem ist die Gesamtdauer des Verfahrens im Gesetz nicht geregelt; d. h., vom Antrag auf Eröffnung des Verfahrens bis zum Beginn der „Wohlver- haltensperiode“ vergehen u. U. mehrere Jahre. Messner/Hofmeister53haben aufgrund eines hypothetischen Zeitplanes eine Dauer von zehn Jahren er- rechnet.
Eine lebhafte Diskussion löste der Artikel von Michael Schütz im „Diskus- sionsforum Schuldnerberatung" über das unendliche Insolvenzverfahren aus.54Darin bezieht er sich auf einen Aufsatz in der DZWiR 1999, Seite 2-8.55Die Autoren legen dar, dass es ihrer Meinung nach kein Entrinnen aus dem eröffneten vereinfachten Insolvenzverfahren gäbe, wenn der Schuldner über ein pfändbares Einkommen verfüge. Begründet wird dieses mit der potenziellen Unbegrenztheit des Verfahrens, die sich aus § 35 InsO ergäbe. Demnach gehört zur Insolvenzmasse nicht nur das vorhandene, sondern auch das während des Verfahrens neu erlangte Vermögen. Da das Verfahren erst aufgehoben werden kann, wenn die Schlussverteilung erfolgt ist (§ 200, Abs. 1 InsO), die Schlussverteilung aber erst erfolgen kann, wenn die Ver- wertung der Insolvenzmasse beendet ist (§ 196, Abs. 1 InsO), befindet sich der Schuldner in einem unendlichen Verfahren, solange er über ein pfändba- res Einkommen verfügt. In dieser Falle sollen sich bereits Schuldner wie- dergefunden haben.
4.3 Vorrang von Abtretungen
Aufgrund des Druckes der Banken, die ihre Kredite größtenteils durch Abtretungsvereinbarungen sichern, wurde eine Sonderregelung geschaffen. Demnach gelten Lohnabtretungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens drei Jahre lang weiter (§ 114 Abs. 1 InsO).
Das bedeutet, dass der Gläubiger mit der ältesten gültigen Lohnabtretung das gesamte pfändbare Einkommen des Schuldners einziehen kann. Dies hat zur Folge, dass weder die Kosten des Treuhänders in dieser Zeit gedeckt sind noch die Kosten des Verfahrens aus der Masse gedeckt werden können.
4.4 Verbraucher- oder Regelinsolvenz?
Schuldnerberatungen waren bisher oft mit der Beratung (ehemals) Selbst- ständiger überfordert. Schuldner mit bis zu einhundert Gläubigern und Schulden in Millionenhöhe gehören nicht gerade zum üblichen Klientel von Schuldnerberatungen. Vor Inkrafttreten der Insolvenzordnung lehnten viele Schuldnerberatungen generell die Beratung von Selbstständigen ab. Außergerichtliche Einigungsversuche sind bei einer großen Anzahl von Gläubigern nur schwer durchzuführen, zudem aufwendig und kostspielig.56
Schwierig ist zudem die Abgrenzung zwischen Verbraucher- und Regelinsolvenz. Die Definition „geringfügige wirtschaftliche Tätigkeit“ lässt einigen Interpretationsspielraum.
5 geplante Änderungen der InsO
Bereits ein Jahr nach Inkrafttreten wurden die Mängel der InsO unüberseh- bar, so dass bereits wieder Reformbedarf entstand - eine „Reform der Re- form“ war unabdingbar, wollte man das Ziel, zahlungsunfähigen Schuldnern die Teilnahme am wirtschaftlichen Leben wieder zu ermöglichen, zumindest annähernd erreichen.
5.1 Der Gesetzentwurf der PDS
Der Gesetzentwurf der PDS vom 11. 01. 2000 zur Änderung der Insolvenz- ordnung (InsOÄndG) sah vor, Prozesskostenhilfe im Verbraucherinsolvenz- verfahren nach Maßgabe der §§ 114 bis 127a Zivilprozessordnung zu ge- währen, die „Wohlverhaltensperiode“ von sieben auf fünf Jahre zu kürzen, Null-Pläne ausdrücklich zuzulassen und den Vollstreckungsschutz auf das außergerichtliche Verfahren auszudehnen. Am 27.06.01 wurde dieser Ge- setzentwurfs mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der PDS abgelehnt.57
5.2 Der Gesetzentwurf der Bundesregierung
Am 28. 03. 2001 veröffentlichte die Bundesregierung ihren Entwurf zur Änderung der Insolvenzordnung. Auch die Bundesregierung gelangte schließlich zu der Erkenntnis, dass das Verfahren insbesondere durch den Ausschluss mittelloser Schuldner die in es gesetzten Erwartungen bislang nicht erfüllt hat. Auch habe es sich als nicht effizient genug erwiesen. Die Vermögensverhältnisse (ehemals) Selbständiger mit z. T. mehr als 100 Gläubigern hätten sich als unüberschaubarer erwiesen, als zunächst ange- nommen wurde, was das Verfahren aufwendiger und auch kostspieliger ma- che als ursprünglich geplant. Gerade das zeitaufwendige außergerichtliche Verfahren verzögere die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und verhindere dadurch, dass rechtzeitig Maßnahmen zur Sicherung evt. noch vorhandener Masse ergriffen werden könnten.58
Nach Vornahme einiger Änderungen durch den Rechtsausschuss des Bun- destages wurde der Gesetzentwurf am 27.06.01 mit den Stimmen der Frak- tionen von SPD, CDU/CSU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimm- enthaltung der Fraktionen der F.D.P. und der PDS angenommen. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird zum 01.11.01 gerechnet, da von einer Zustimmung durch den Bundesrat ausgegangen werden kann.59
Die Änderungen betreffen u. a. folgende Punkte:
5.2.1 Kosten des Insolvenzverfahrens
Nach § 4 InsO werden die §§ 4a bis 4d eingefügt, die die Stundung der Insolvenzkosten regeln. Die Kosten können gestundet werden bei natürlichen Personen, die die Restschuldbefreiung beantragt haben und deren Vermögen nicht ausreicht, die Kosten zu decken. Erst nach Erteilung der Restschuldbefreiung sind die Kosten zu zahlen. Wird im Laufe des Verfahrens die Restschuldbefreiung widerrufen, wird die Stundung aufgehoben.
5.2.2 Dauer des Verfahrens
„In Absatz 2 Satz 1 [§ 287 InsO] werden die Zahl „sieben" durch die Zahl „sechs“ und die Wörter „nach der Aufhebung“ durch die Wörter „nach der Eröffnung“ ersetzt.60
Mit diesem lapidaren Satz wird die „Wohlverhaltensperiode“ auf sechs Jahre verkürzt. Wichtig ist der Beginn der „Wohlverhaltensperiode“: Statt mit der Aufhebung des Verfahrens (s. o.) beginnt diese nun schon mit der Eröffnung. Dadurch findet die Diskussion um das „unendliche Insolvenzverfahren“ endlich ein Ende; die Dauer des Verfahrens ist begrenzt und für den Schuldner überschaubarer geworden.
5.2.3 Lohnabtretungen
Die Dauer der Gültigkeit einer Lohnabtretung im Verbraucherinsolvenzverfahren wird von drei auf zwei Jahre reduziert.
5.2.4 Verbraucher- oder Regelinsolvenz?
Diesen Punkt betrifft die m. E. problematischste Regelung des Gesetzent- wurfes:
§ 304 wird geändert, so dass grundsätzlich nur noch die Schuldner das Verbraucherinsolvenzverfahren durchlaufen können, die (als natürliche Per- sonen) keine selbständige Tätigkeit ausüben oder ausgeübt haben. Eine Ausnahme ist möglich, wenn die Vermögensverhältnisse des Schuldners überschaubar sind und gegen ihn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Die Vermögensverhältnisse gelten als überschaubar bei weniger als zwanzig Gläubigern.
Damit ist den meisten Selbstständigen der Weg in das Verbraucherinsolvenzverfahren versperrt.
6 Zusammenfassung/Ausblick
Die Reform der Insolvenzordnung führte nicht zum erwünschten Ergebnis: Der Sturm auf die Gerichte blieb aus. Das geplante InsO-Änderungsgesetz beseitigt die gravierendsten Mängel der Insolvenzordnung. Ob die Zahl der eröffneten Insolvenzverfahren nach Inkrafttreten der Änderungen ansteigt, bleibt abzuwarten. Viele Punkte, die ich im Rahmen dieser Arbeit nicht be- handeln konnte, bleiben ungelöst (Kompliziertheit des Verfahrens, Warte- zeiten bei den Schuldnerberatungen von mehreren Monaten, Arbeitnehmer- anteil der Sozialversicherungsabgaben als „ausgenommene Forderungen“, Problematik der Obliegenheiten des Schuldners im Verfahren, Gefahr des Versagens der Restschuldbefreiung...).
Die Änderung des § 304 Insolvenzwahrscheinlichkeit wird dazu führen, dass viele Selbständige, die bislang das Verbraucherinsolvenzverfahren be- antragen konnten, nun in das Regelinsolvenzverfahren gedrängt werden. Dieses bedeutet, dass Schuldnerberatungen sich für diese ehemals Selbst- ständigen bzw. Kleingewerbetreibenden nicht mehr zuständig fühlen wer- den. Die Diskussion darüber hat bereits begonnen.61Fraglich ist, ob Schuld- nerberatungen beispielsweise die Beratung von Sozialhilfeempfänger ver- weigern können, weil diese mehr als 20 Gläubiger oder Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen vorweisen. Diese Verweisung auf das Regelinsol- venzverfahren ist sehr pauschal und wird den Einzelfällen nicht gerecht: Was wird z. B. aus den „Strohfrauen“, den mithaftenden Ehefrauen oder anderen Mithaftenden?
Da die Insolvenzordnung im Regelinsolvenzverfahren keinen außergerichtlichen Einigungsversuch vorschreibt, können (ehemals) Selbstständige nach der Gesetzesänderung schneller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen, was ein großer Vorteil des Regelinsolvenzverfahrens ist.
Alles in allem ist der Gesetzesentwurf ein Schritt in die richtige Richtung - für Verbraucher. Nur die Konsequenzen für einige gescheiterte Existenzgründer sind problematisch. Sie werden in ein kompliziertes Verfahren gedrängt - ohne Unterstützung durch Schuldnerberatungen. Einen Anwalt werden sich die wenigsten leisten können.
Daher wird sich vermutlich auch die Einstellung in der Bevölkerung so schnell nicht ändern: Man gründet keine Existenz, wenn die Gefahr besteht zu scheitern. Diese Auffassung verhindert Neugründungen. Diese Einstel- lung zu ändern erfordert ein Insolvenzverfahren, welches gescheiterten Gründern schnell und unkompliziert die Entschuldung und damit einen Neuanfang ermöglicht62.
7 Literaturangaben
Bork, R., Einführung, in: Insolvenzordnung. Synopse: Insolvenzordnung und Konkursordnung (Auszug), München 1995, S. IX. Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze, in: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZinsO), Heft 13/2001, S. 601. Grub, V., Smid, S.: Verbraucherinsolvenz als Ruin des Schuldners - Strukturprobleme des neuen Insolvenzrechts. In: DZWiR, 9. Jg (1999), Heft 1, S. 2-8.
Institut für Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz (IFF): Maß-
nahmen zur Begegnung der Schuldenkrise, in: Verbraucher und Recht, H. 6, 1990, S. 306.
Messner, O., Hofmeister, K.: Endlich schuldenfrei - Der Weg in die Restschuldbefreiung. München, 1998, S. 57.
Obermüller, M., Hess, H.: InsO. Eine systematische Darstellung des neuen Insolvenzrechts, Heidelberg 1999, S. 2-3.
Piepenburg, H.: Neustart nach Unternehmensinsolvenz - Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene, in: ZinsO, H. 13/2001, S. 596-598. Reifner, U.: Grundsätze zur Bewertung des Verbraucherkonkurses, in: Verbraucher und Recht, H. 3, 1990, S. 133.
Statistisches Bundesamt (Hg.): Statistisches Jahrbuch 2000 für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 2000, S. 132.
Woywode, M.: Determinanten der Überlebenswahrscheinlichkeit von Unternehmen. Eine empirische Überprüfung organisationstheoretischer und industrieökonomischer Erklärungsansätze. 1. Auflage, Baden-Baden, 1998, S. 211 ff.
Online -Quellen:
http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm: Bundestags - Drucksache 14/2496, 14/5680, Dokumentenserver PARFORS. Bundestags - Drucksachen und -Plenarprotokolle ab der 13. Wahlperiode, download v. 01.08.01.
http://eba-berlin.de/aktuell/index.html: Existenzgründerbüro der Berliner Arbeitsämter - aktuell, download v. 28.06.01.
http://eba-berlin.de/leistung/index.html: Existenzgründerbüro der Berliner Arbeitsämter - Leistungen, download v. 28.06.01.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarom eter83_en.pdf: EOS Gallup Europe: FLASH EUROBAROMETER 83, „entrepreneurship“, download v. 21.07.01.
http://f23.parsimony.net/forum48247/messages/818.htm: Forum Schuld- nerberatung (Praktikerforum): Beratung der Freiberufler und Kleinge- werbetreibenden nach INsO-Änderung, download v. 01.08.01. http://forum-schuldnerberatung.de/selbstst/regelinso/insoplan.htm, down- load v. 01.07.01.
http://www.ass-ma.de/selbstaendige/synopse.pdf: Synopse, download v. 01.07.01.
http://www.berlin.de/Land/SenArbSozFrau/lageso/insolv_set.html: Lan- desamt für Gesundheit und Soziales Berlin, Verbraucherinsolvenz, down- load v. 02.08.01.
http://www.berliner-morgenpost.de/archiv1999/991216/lokalanzeiger_so/ story14732.html: Braden, H.-D.: Der lange und schwierige Weg herab vom Schuldenberg, in: Berliner Morgenpost v. 16.12.1999, download v. 25.06.01.
http://www.berliner-morgenpost.de/archiv2001/010519/wirtschaft/story423078.html: Wieder mehr Gründungen, download v. 25.06.01.
http://www.berlinews.de/gruendernews/1048.shtml: Gründernews Vom Campus in die Selbstständigkeit, download v. 28.06.01. http://www.bma.bund.de/de/sicherung/armutsbericht/ARBBericht01.pdf: Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, download v. 01.08.01. [Die Datei passte nicht auf die Diskette!]
http://www.bmwi.de/Homepage/Politikfelder/mittelstandspolitik/Kultur% 20der%20Selbst%e4ndigkeit/Kulturselbst.jsp: BMWi Kultur der Selbständigkeit, download v. 28.06.01.
http://www.creditreform.de/info/leistungen/e_analysen/0019/01.html: Neue Insolvenzflut, download v. 27.06.01.
http://www.creditreform.de/info/leistungen/e_analysen/0019/02.html:
Höhere Steigerungsraten in Ostdeutschland, download v. 27.06.01.
http://www.creditreform.de/info/leistungen/e_analysen/0019/04.html: Firmenpleiten verursachen wieder mehr Schäden, download v. 27.06.01. http://www.deutsche-existenz-gruendertage.de/presse6.rtf: Bilanz der Deutschen ExistenzGründertage in Berlin, download v. 25.06.01. http://www.ecin.de/news/2000/07/04/00208/: Deutschen Internet-Firmen droht Zahlungsunfähigkeit, download v. 28.06.01.
http://www.existenzgruender-institut.de/: Existenzgründer-Institut Berlin e_V, download v. 28.06.01.
http://www.existenzgruender-institut.de/uu/frziel.htm: Existenzgründer- Institut Berlin e_V_ - Über uns, download v. 28.06.01. http://www.forum-schuldnerberatung.de/infos/inf0012.htm: M. Schütz: Die quantitative Entwicklung der Verbraucherinsolvenzverfahren in 2000, download v. 02.08.01.
http://www.forum-schuldnerberatung.de/rechtspr/inso/kosten.htm: Kosten des Insolvenzverfahrens, download v. 30.07.01.
http://www.forum-schuldnerberatung.de/rechtspr/insodiv/id004.htm: Grundsatzbeschluss zur Ausstellung der Bescheinigung. Urteil des OLG Schleswig, Beschluss vom 1.2.2000 - 1 W 51 / 99, download v. 30.07.2001.
http://www.forum-schuldnerberatung.de/veroeff/v0004.htm: Das unendli- che Insolvenzverfahren, download v. 30.07.01.
http://www.iab.de/ftproot/kb0198.pdf: positive Zwischenbilanz, IAB Kurzbericht, Nr. 1, 19.01.1998, S. 4, download v. 25.06.01.
http://www.ifm.uni-mannheim.de/ifm/web/unter/struk.pdf: Tätigkeitsbe- richt des Institus für Mittelstandsforschung, download v. 25.06.01. http://www.OLG-Oldenburg.de: König, G.: Gewährung von Prozesskos- tenhilfe im Verbraucherinsolvenzverfahren, download vom 30.07.01. http://www.pinkslipparty.de/: Pink Slip Party, download v. 28.06.01 http://www.statistik-berlin.de/statistiken/unternehmen/insolvenz_01.htm: Statistisches Landesamt Berlin. Insolvenzen in Berlin 1991 bis 2000, download v. 01.08.01.
[...]
1http://www.existenzgruender-institut.de/: Existenzgründer-Institut Berlin e_V, download v. 28.06.01
2http://www.existenzgruender-institut.de/uu/frziel.htm: Existenzgründer-Institut Berlin e_V_ - Über uns, download v. 28.06.01
3http://www.berlinews.de/gruendernews/1048.shtml: Gründernews Vom Campus in die Selbstständigkeit, download v. 28.06.01
4http://eba-berlin.de/leistung/index.html: Existenzgründerbüro der Berliner Arbeitsämter - Leistungen, download v. 28.06.01
5http://eba-berlin.de/aktuell/index.html: Existenzgründerbüro der Berliner Arbeitsämter - aktuell, download v. 28.06.01
6http://www.deutsche-existenz-gruendertage.de/presse6.rtf: Bilanz der Deutschen Exis- tenzGründertage in Berlin, download v. 25.06.01
7 http://www.berliner-morgenpost.de/archiv2001/010519/wirtschaft/story423078.html: Wieder mehr Gründungen, download v. 25.06.01
8Mit der Frage der Beschäftigungswirkung von Gründungen und KMU sowie der wirt- schaftlichen Ertragslage von KMU beschäftigt sich u. a. der Tätigkeitsbericht des Instituts für Mittelstandsforschung. Demnach ergibt sich aus den bisher durchgeführten Studien ein uneinheitliches Bild in Bezug auf die Beschäftigungswirkung. Auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von KMU und deren gesamtwirtschaftlicher Stellenwert wird kritisch beleuchtet. Vgl. http://www.ifm.uni-mannheim.de/ifm/web/unter/struk.pdf: Tätigkeitsbericht des Insti- tus für Mittelstandsforschung, download v. 25.06.01
9http://www.pinkslipparty.de/: Pink Slip Party, download v. 28.06.01
10 Ein GmbH-Gesellschafter haftet mit seinem Privatvermögen, wenn er grobe Fehler begangen oder gegen geltende Gesetze verstoßen hat.
11Eine Gegenüberstellung von Regelinsolvenz und Verbraucherinsolvenz findet sich hier: http://www.ass-ma.de/selbstaendige/synopse.pdf: Synopse des Ablaufs von Regel- und Verbraucher-Insolvenzverfahren bei Eigenantrag, download v. 01.07.01.
12zum Begriff der Insolvenz: s. u., Abschnitt 3.1.
13Die Organisation Creditreform wurde bereits 1879 gegründet, um ihre Mitglieder vor Forderungsausfällen zu schützen.
14http://www.creditreform.de/info/leistungen/e_analysen/0019/01.html: Creditreform - Neue Insolvenzflut, download v. 27.06.01.
15 http://www.creditreform.de/info/leistungen/e_analysen/0019/02.html: Creditreform - Höhere Steigerungsraten in Ostdeutschland, download v. 27.06.01.
16http://www.creditreform.de/info/leistungen/e_analysen/0019/04.html: Creditreform - Firmenpleiten verursachen wieder mehr Schäden, download v. 27.06.01.
17Aktuellere Angaben lagen bei Redaktionsschluss des Statistischen Jahrbuchs 2000 nicht vor.
18Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Statistisches Jahrbuch 2000 für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 2000, S. 132.
19Vgl. ebd.
20 Vgl. http://www.statistik-berlin.de/statistiken/unternehmen/insolvenz_01.htm: Statisti- sches Landesamt Berlin. Insolvenzen in Berlin 1991 bis 2000, download v. 01.08.01.
21Vgl. Piepenburg, Horst: Neustart nach Unternehmensinsolvenz - Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene, in: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZinsO), H. 13/2001, S. 596-598.
22im Internet unter: http://www.bcg.de.
23Die Ergebnisse dieser Tagung werden in einer Dokumentation zusammengefasst, die in der zweiten Jahreshälfte 2001 vorliegen wird.
24Vgl. http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobaro- meter83_en.pdf: EOS Gallup Europe: FLASH EUROBAROMETER 83, „entrepreneurship“, download v. 21.07.2001.
25 Ebenda
26http://www.bmwi.de/Homepage/Politikfelder/mittelstandspolitik/Kultur%20der%20Selbst %e4ndigkeit/Kulturselbst.jsp: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): Kultur der Selbständigkeit, download v. 28.06.01.
27Vgl. http://www.iab.de/ftproot/kb0198.pdf: positive Zwischenbilanz, IAB Kurzbericht, Nr. 1, 19.01.1998, S. 4, download v. 25.06.01.
28 Ebenda.
29Vgl. Woywode, M.: Determinanten der Überlebenswahrscheinlichkeit von Unternehmen. Eine empirische Überprüfung organisationstheoretischer und industrieökonomischer Erklärungsansätze. 1. Auflage, Baden-Baden, 1998.
30Vgl. ebd., S. 211 ff.
31 Vgl. Obermüller, M., Hess, H.: InsO. Eine systematische Darstellung des neuen Insolvenzrechts, Heidelberg 1999, S. 2-3.
32Ebenda, S. 2.
33 Bork, R., Einführung, in: Insolvenzordnung. Synopse: Insolvenzordnung und Konkursordnung (Auszug), München 1995., S. IX.
34Vgl. Statistisches Bundesamt, a.a.O.
35 Institut für Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz (IFF): Maßnahmen zur Begegnung der Schuldenkrise, in: Verbraucher und Recht, H. 6, 1990, S. 306.
36Insolvenzordnung. a.a.O., S. 191 ff
37 Um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, verwende ich den Begriff „Schuldner“ ebenso wie den Begriff „Gläubiger“ nur in der männlichen Version. Schön wäre es ja, gäbe es keine Schuldnerinnen, aber diese sind „mitgemeint“.
38 Vgl. Obermüller, M., Hess, H., a. a. O., S. 29-30.
39Vgl. Obermüller, M., Hess, H., a. a. O., S. 30.
40 Hiermit knüpft der Gesetzgeber an den früheren handelsrechtlichen Begriff des Minderkaufmanns an.
41Vgl. http://www.berlin.de/Land/SenArbSozFrau/lageso/insolv_set.html: Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, Verbraucherinsolvenz, download v. 02.08.01.
42Ich verwende hier auch nur die männliche Form.
43Vgl. http://www.forum-schuldnerberatung.de/rechtspr/in sodiv/id004.htm: Grundsatzbe- schluss zur Ausstellung der Bescheinigung. Urteil des OLG Schleswig, Beschluss vom 1.2.2000 - 1 W 51 / 99, download v. 30.07.01.
44 Arbeitskreis InsO der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbraucher- und Wohlfahrtsverbände (AGSBV).
45 Bei „Altfällen“ fünf Jahre, s. Art. 107 EGInsO.
46Creditreform - Neue Insolvenzflut, a. a. O.
47Vgl. http://www.bma.bund.de/de/sicherung/armutsbericht/ARBBericht01.pdf: Lebensla- gen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, down- load v. 01.08.01.
48Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens muss im Bundesanzeiger veröffentlicht werden (§ 30 InsO).
49 http://www.forum-schuldnerberatung.de/infos/inf0012.htm: M. Schütz: Die quantitative Entwicklung der Verbraucherinsolvenzverfahren in 2000, download v. 02.08.01.
50http://www.OLG-Oldenburg.de: Gewährung von Prozesskostenhilfe im Verbraucherin- solvenzverfahren, download v. 30.07.01.
51http://www.forum-schuldnerberatung.de/rechtspr/inso/kosten.htm: Kosten des Verbrau- cherinsolvenzverfahrens, download v. 30.07.01.
52 Reifner, U.: Grundsätze zur Bewertung des Verbraucherkonkurses, in: Verbraucher und Recht, H. 3, 1990, S. 133.
53Messner, O., Hofmeister, K., a. a. O., S. 185-188.
54http://www.forum-schuldnerberatung.de/veroeff/ v0004.htm: Das unendliche Insolvenz- verfahren, download v. 30.07.01.
55 Grub, Volker, Smid, Stefan: Verbraucherinsolvenz als Ruin des Schuldners - Strukturprobleme des neuen Insolvenzrechts, in: DZWiR, 9. Jg (1999), Heft 1, S. 2-8.
56Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens enthält ca. 40 Seiten, die an alle Gläubiger verschickt werden müssen. Für jeden Gläubiger ist zudem eine eigene Seite auszufüllen.
57 http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm: Bundestags - Drucksache 14/2496, Doku- mentenserver PARFORS. Bundestags -Drucksachen und -Plenarprotokolle ab der 13. Wahlperiode, download v. 01.08.01
58http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm: Bundestags - Drucksache 14/5680, a. a. O., download v. 01.08.01
59 Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze, in: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZinsO), Heft 13/2001, S. 601.
60 Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze, a. a. O., S. 603
61 http://f23.parsimony.net/forum48247/messages/818.htm: Forum Schuldnerberatung (Praktikerforum): Beratung der Freiberufler und Kleingewerbetreibenden nach INsOÄnderung, download v. 01.08.01.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Seite?
Diese Seite ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Sie behandelt das Thema Insolvenzrecht in Deutschland, insbesondere das Verbraucherinsolvenzverfahren.
Was sind die Hauptthemen der Seite?
Die Hauptthemen sind: gescheiterte Existenzgründer, die Insolvenzordnung (InsO), Hindernisse im Insolvenzverfahren, geplante Änderungen der InsO und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Was sind die Gründe für das Scheitern von Existenzgründern?
Gründe für das Scheitern sind u.a. mangelnde Erfahrung, finanzielle Schwierigkeiten, Wettbewerbsnachteile und eine zu späte Inanspruchnahme von Sanierungsmaßnahmen.
Was ist die Insolvenzordnung (InsO)?
Die InsO ist das deutsche Gesetz, das die Insolvenzverfahren regelt. Sie soll Unternehmen sanieren, Arbeitsplätze erhalten und Privatpersonen nach einer Wohlverhaltensperiode eine Restschuldbefreiung ermöglichen.
Was sind die Ziele der InsO?
Die Ziele der InsO sind die bestmögliche Gläubigerbefriedigung und die Restschuldbefreiung für redliche Schuldner.
Was ist das Verbraucherinsolvenzverfahren?
Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist ein spezielles Insolvenzverfahren für natürliche Personen, die keine oder nur eine geringfügige wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.
Welche Stufen durchläuft das Verbraucherinsolvenzverfahren?
Das Verfahren umfasst einen außergerichtlichen Einigungsversuch, einen gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan, das vereinfachte Insolvenzverfahren und die Wohlverhaltensperiode mit anschließender Restschuldbefreiung.
Was ist die Wohlverhaltensperiode?
Die Wohlverhaltensperiode ist ein Zeitraum, in dem sich der Schuldner redlich verhalten muss, um die Restschuldbefreiung zu erlangen. Dazu gehört u.a. die Ausübung einer angemessenen Erwerbstätigkeit und die Abtretung pfändbarer Bezüge.
Welche Hindernisse gibt es im Insolvenzverfahren?
Hindernisse sind u.a. die Kosten des Verfahrens, die Dauer des Verfahrens, der Vorrang von Abtretungen und die Abgrenzung zwischen Verbraucher- und Regelinsolvenz.
Welche geplanten Änderungen der InsO gibt es?
Geplante Änderungen betreffen u.a. die Stundung der Insolvenzkosten, die Verkürzung der Wohlverhaltensperiode und die Einschränkung des Zugangs zum Verbraucherinsolvenzverfahren für Selbstständige.
Was sind die Kritikpunkte an der InsO?
Kritikpunkte sind u.a. die Kompliziertheit des Verfahrens, lange Wartezeiten bei Schuldnerberatungen, die Gefahr des Versagens der Restschuldbefreiung und die fehlende Unterstützung für einige gescheiterte Existenzgründer.
Welche Rolle spielt die "Kultur der Pleite" in Deutschland?
In Deutschland herrscht eine eher negative Einstellung gegenüber gescheiterten Unternehmern. Eine Kultur der Pleite, die einen Neuanfang ermöglicht, wird als wichtig für die Förderung von Unternehmertum angesehen.
Was sind "Pink Slip Partys"?
"Pink Slip Partys" sind Treffen ehemaliger Angestellter von DOTCOMs, die durch die Insolvenz ihrer Firmen arbeitslos wurden.
Was bedeutet "mangels Masse abgelehnte Verfahren"?
Dies bedeutet, dass das Insolvenzverfahren nicht eröffnet wird, weil das Vermögen des Schuldners nicht ausreicht, um die Kosten des Verfahrens zu decken.
Was bedeutet die "Altfall-Regelung"?
Die "Altfall-Regelung" ermöglichte eine Verkürzung der Wohlverhaltensperiode von sieben auf fünf Jahre, wenn das Verfahren vor einem bestimmten Zeitpunkt beantragt wurde.
Was bedeutet "Restschuldbefreiung"?
Die Restschuldbefreiung bedeutet, dass der Schuldner nach Ablauf der Wohlverhaltensperiode von den restlichen Verbindlichkeiten gegenüber den Insolvenzgläubigern befreit wird.
Was sind "Obliegenheiten" im Insolvenzverfahren?
Obliegenheiten sind Pflichten, die der Schuldner während der Wohlverhaltensperiode erfüllen muss, um die Restschuldbefreiung zu erlangen.
Was sind "Versagungsgründe" für die Restschuldbefreiung?
Versagungsgründe sind Gründe, die dazu führen können, dass die Restschuldbefreiung nicht erteilt wird, z.B. Insolvenzstraftaten oder Verletzung von Auskunfts- und Mitwirkungspflichten.
- Quote paper
- Elga Janßen (Author), 2001, Das Verbraucherinsolvenzverfahren - eine zweite Chance für Gründer?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105218