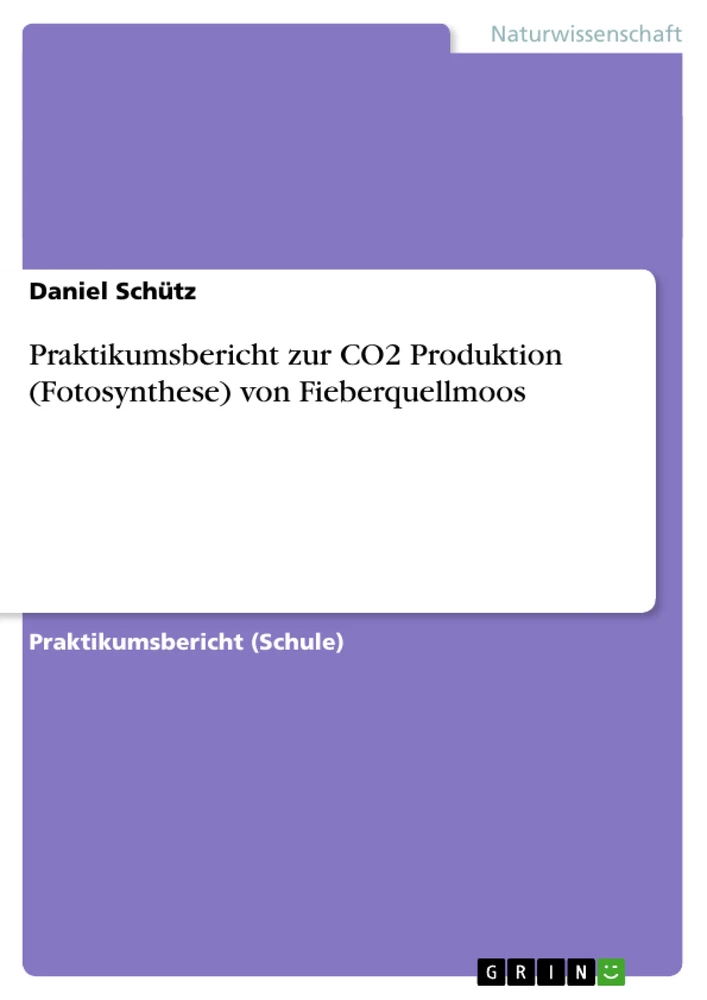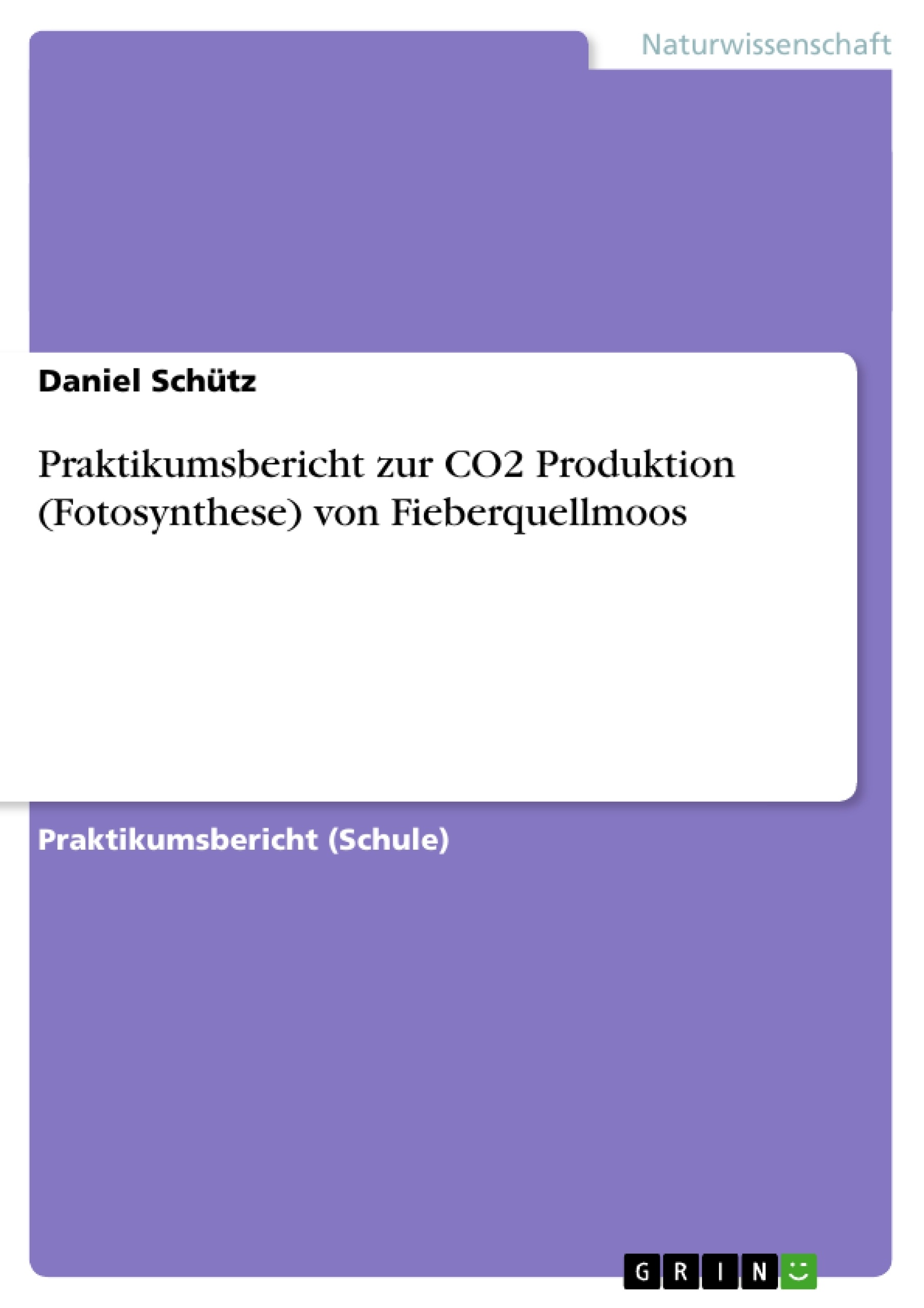Praktikumsbericht zur CO2 Produktion (Fotosynthese) von Fieberquellmoos
Praktikum:
Wie hoch ist die Sauerstoffproduktion des Fieberquellmooses in ml. während einer Woche mit, resp. ohne CO2, kombiniert mit gedüngtem-, entionisiertem-, und normalem Wasser?
Aufgabe:
Wir untersuchten die Sauerstoffproduktion des Fieberquellmooses bei bestimmten Bedingungen. Aus den daraus resultierenden Resultaten möchten wir auf die Fotosynthesenrate schliessen.
Wir entschieden uns, die Pflanzen unter erhöhter Konzentration von Kohlenstoffdioxid bzw. bei normalen Bedingungen zu untersuchen. Ein weiterer veränderter Faktor war, dass wir die Wasserqualität veränderten (entionisiertes-, gedüngtes- und Leitungswasser).
Versuchsprotokoll:
Material:
Wasserpflanze (Fieberquellmoos)
Leitungswasser
entionisiertes Wasser
Flüssigdünger (MioPlant)
CO2
6 Einmachgläser (1L)
6 Glastrichter
6 kl. Reagenzgläser
Briefwaage
CO2
Pyrette
Messzylinder (1Liter)
PH-Indikator
Bunsenbrenner
Holzstäbchen
Voraussetzungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gewicht der Pflanzen am 01.03.2001:
→ Wir tupfen die Pflanzen mit saugstarkem Papier ab, da dies genauere Resultate liefert. Diese Messwerte sind jedoch nicht ganz genau, da es schwierig ist, bei jeder Pflanze gleich viel Wasser abzutupfen.
Ohne Abtupfen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit Abtupfen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
D,E&F werden jeweils mit CO2 begast, A,B&C nicht.
Methoden:
Wir legen die Wasserpflanzen (Fieberquellmoos), welche wir zuvor in einen Glastrichter tun, in die Einmachgläser, und zwar so, dass die breite Öffnung der Trichter am Boden des Glases zu liegen kommt. Wir füllten nun in jedes Einmachglas, die für die Buchstaben vorgesehene Flüssigkeit. Anschliessend decken wir den Trichterhals mit einem kleinen Reagenzglas ab. Dabei müssen wir Acht geben, dass keine Luftbläschen ins RG gelangen. Zu diesem Zweck füllen wir es zuerst mit dem im entsprechenden Einmachglas enthaltenen Wasser und drehen es unter der Wasseroberfläche (direkt im Glas) um und stülpen das Reagenzglas über den Trichterhals. Diese Massnahmen sind notwendig, da eventuelle Luftbläschen die Versuchsresultate beeinträchtigen könnten.
Unmittelbar vor dem Versuch werden die sechs Ansätze Fieberquellmoos gemessen. 14 Tage nach Versuchsbeginn wägten wir die Pflanzen noch einmal.
Die Versuche werden nun wenn möglich täglich überprüft, einmal in der Woche werden wir genauere Messungen erstellen.
Da sich immer wieder Bläschen in den Pflanzen festsetzen, müssen wir versuche diese durch schütteln ins RG zu befördern.
Um zu testen, ob sich in den Reagenzgläsern reiner Sauerstoff als Photosyntheseprodukt, und nicht Kohlenstoffdioxid oder andere Stoffe angesammelt haben, wenden wir die Knallgasreaktion an: Wir nehmen die Reagenzgläser aus dem Wasser, und halten sie mit der Öffnung gegen oben. Über einem Gaskocher drehen wir nun, das RG um neunzig Grad, damit sich die Öffnung über der Flamme befindet und das Gas ausströmen kann. Falls es sich bei dem Gas um Sauerstoff handelt, sollte nun eine Stichflamme entstehen.
Versuchsergebnisse/Beobachtungen:
1.Versuch, 01.033.2001-08.03.2001
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messung des PH-Wertes:
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messung der entstandenen Sauerstoffmenge in ml nach einer Woche:
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schlussfolgerungen nach einer Woche:
A kann im entioniesierten Wasser offensichtlich keine Fotosynthese machen. B verändert sich langsam, wohl dem normalen Wachstum entsprechend. C wächst unregelmässig, jedoch stark. Offensichtlich unterstützt der Dünger das Wachstum. D veränderte sich kaum, jedoch mehr als A. Wir können daher sagen, dass auch in entionisiertem Wasser Fotosynthese möglich ist, jedoch nur unter erschwerten Bedingungen. Offensichtlich wird der Prozess durch hohen Kohlenstoffdioxidgehalt beschleunigt. Bei E wurde am meisten Sauerstoff produziert, wir nehmen daher an, dass normales Wasser kombiniert mit CO2 die beste Kombination ist. F produziert zu unserem grossen Erstaunen nicht viel Sauerstoff. Die Kombination CO2 und Dünger scheinen der Pflanze nicht zu entsprechen.
2.Versuch,08.03.2001-14.03.2001
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messung des PH-Wertes:
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messung des PH-Wertes:
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Knallgasreaktion:
Bemerkung: Um zu testen, ob sich in den Reagenzgläsern reiner Sauerstoff als Photosyntheseprodukt, und nicht Kohlenstoffdioxid oder andere Stoffe angesammelt haben, wollen wir die Knallgasreaktion anwenden:
Dieser Versuch misslingt uns jedoch, da die Mengen, des im RG vorhandenen Ga ses zu klein für die Knallgasreaktion ist.
Wir haben also keinen Beweis, dass es sich bei den Blasen im RG um Sauerstoff handelt, wir können es jedoch mit grösster Wahrscheinlichkeit behaupten, da die Versuchsergebnisse mit unseren Überlegungen und Erwartungen übereinstimmen.
Entstandene Sauerstoffmenge der letzten Woche (zwischen dem 8.3.01 und dem 15.3.01):
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schlussfolgerungen nach einer weiteren Woche:
Bei A sahen wir erste Anzeichen vom Absterben der Pflanze. Die Pflanze kann in entionisiertem Wasser keine Fotosynthese machen. Die Pflanze wächst in normalem Wasser am optimalsten. Bei F scheint die Kombination Dünger&CO2 der Pflanze geschadet zu haben.
Aus den Messungen des PH-Wertes können wir keine Schlüsse ziehen, da dieser ständig wankte und keine eindeutigen Trends sichtbar sind.
Vergleich der Entstandenen Sauerstoffmenge:
08.03.2001
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
15.03.2001
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wachstum der Sauerstoffmenge vom 08.03.2002 bis zum 15.03.2001:
Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zunahme des O2 Gehaltes im RG in Prozent zwischen dem 08.03 und dem 15.03: Unter normalen Bedingungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter erhöhter CO2-Konzentration:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diskussion:
Schon nach den ersten paar Tagen zeigten sich Anzeichen dafür, dass unserer Versuch gelungene Resultate liefert. Die Pflanze im Glas A war ja bekanntlich in entionisiertem Wasser, d.h. in Wasser ohne jegliche Mineralien (das heisst auch ohne CO2). Das Wasser wurde auch nicht mit Kohlenstoffdioxid begast. CO2 ist jedoch ein Edukt, welches bei der Photosynthese unbedingt benötigt wird. Wie erwartet konnte die Pflanze in Ansatz A also keine Photosynthese machen. Bei B war in der zweiten Woche das grösste Wachstum festzustellen. Genau begründen können wir dies nicht, wir nehmen jedoch an das es sich hierbei um den normalen Wachstumsverlauf einer Pflanze handelt, da dieser Versuch in Bedingungen ablief, welche auch in der Natur anzutreffen sind. C produzierte in der ersten Woche am meisten Sauerstoff, in der zweiten dann bedeutend weniger. Vielleicht wirkte sich der Dünger in der ersten Woche besonders stark auf die Pflanze aus, verliert aber nach einer Woche den Dünge-Effekt. Versuch D zeigt uns, dass in Wasser Photosynthese nur stattfinden kann, wenn Kohlenstoffdioxid beigemischt ist. Dies ist eine logische Beobachtung welche die Photosynthese (Wasser + Kohlenstoffdioxid → Traubenzucker + Sauerstoff) bestätigt. E scheint optimal zu sein. Wir erreichten bei E erstaunlicherweise die grösste Produktion an Sauerstoff. Wir können daher annehmen, dass im normalen Wasser genug Nährstoffe für eine optimale Photosynthese vorhanden sind. Einzig und allein mit Erhöhung des CO2 Gehaltes kann das Wachstum noch optimiert werden. Versuch F bestätigt diese Theorie. Er verdeutlicht uns sogar, dass ein zu hoher Mineraliengehalt der Pflanze schadet, das Wachstum verringern und sogar stoppen kann. Wir vermuten das die Pflanze durch die Düngung und CO2 überdüngt wurde. Da die Pflanzen mit Zellatmung auch Sauerstoff verbrennen, fragten wir uns, ob sich wirklich reiner Sauerstoff in den Reagenzgläsern befand. Da die Knallgasreaktion misslang, konnten wir dies nicht beweisen. Der von den Pflanzen produzierte Sauerstoff könnte also theoretisch auch gleich wieder in Kohlenstoffdioxid umgewandelt worden sein. Wir haben da also eine Lücke in unseren Resultaten. In unseren Messungen ist nur die apparente Fotosynthese ersichtlich, da wir die reelle Fotosynthese nicht messen konnten.
Ein wichtiger Faktor für die Fotosynthesenrate ist die Beleuchtungsstärke. Da aber wärend den zwei Wochen, in denen wir unseren Versuch durchführten vorwiegend schlechtes Wetter war, ist die fotosyntheserate wohl beträchtlich niedriger als bei schönem Wetter.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Praktikumsbericht zur CO2-Produktion (Fotosynthese) von Fieberquellmoos?
Dieser Praktikumsbericht untersucht die Sauerstoffproduktion von Fieberquellmoos unter verschiedenen Bedingungen. Ziel ist es, aus den gewonnenen Ergebnissen Rückschlüsse auf die Fotosyntheserate zu ziehen. Die Studie befasst sich speziell mit dem Einfluss von CO2-Konzentration und Wasserqualität (entionisiertes, gedüngtes und normales Leitungswasser) auf die Sauerstoffproduktion des Mooses.
Welche Materialien wurden für das Experiment verwendet?
Die verwendeten Materialien umfassten: Fieberquellmoos, Leitungswasser, entionisiertes Wasser, Flüssigdünger (MioPlant), CO2, Einmachgläser (1L), Glastrichter, kleine Reagenzgläser, eine Briefwaage, Pyrette, ein Messzylinder (1 Liter), ein PH-Indikator, einen Bunsenbrenner und Holzstäbchen.
Wie wurde das Experiment durchgeführt?
Das Fieberquellmoos wurde in Glastrichter gegeben und in Einmachgläser platziert, gefüllt mit unterschiedlichen Wasserarten (Leitungswasser, entionisiertes Wasser, Düngerlösung). Einige Gläser wurden zusätzlich mit CO2 begast. Die Sauerstoffproduktion wurde über eine Woche gemessen, indem das verdrängte Wasser in Reagenzgläsern aufgefangen wurde. PH-Wert-Messungen wurden ebenfalls durchgeführt. Die Pflanzen wurden vor und nach dem Versuch gewogen, um Gewichtsunterschiede festzustellen.
Was waren die wichtigsten Ergebnisse des Experiments?
Die Ergebnisse zeigten, dass Fieberquellmoos in entionisiertem Wasser ohne CO2-Zufuhr kaum Fotosynthese betreiben kann. Gedüngtes Wasser förderte das Wachstum, aber die Kombination von Dünger und CO2 schien das Wachstum zu hemmen. Normales Leitungswasser in Kombination mit CO2 führte tendenziell zu der höchsten Sauerstoffproduktion.
Was waren die Schlussfolgerungen des Experiments?
Die Schlussfolgerungen waren, dass CO2 ein entscheidender Faktor für die Fotosynthese ist. Normales Wasser, kombiniert mit CO2, schien die besten Bedingungen für die Sauerstoffproduktion des Fieberquellmooses zu bieten. Zu viele Nährstoffe (Dünger und CO2) können das Wachstum hemmen. Der Bericht weist auch darauf hin, dass aufgrund fehlender Möglichkeiten zur Messung der tatsächlichen Fotosynthese (Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettofotosynthese) nur die apparente Fotosynthese gemessen wurde.
Warum schlug die Knallgasreaktion fehl?
Die Knallgasreaktion, die dazu dienen sollte, zu bestätigen, dass es sich bei dem in den Reagenzgläsern gesammelten Gas um Sauerstoff handelte, schlug fehl, weil die Sauerstoffmenge zu gering war. Dies bedeutet, dass es keinen direkten Beweis für die Zusammensetzung des Gases gab, obwohl die Ergebnisse mit den Erwartungen übereinstimmten.
Welche anderen Faktoren könnten die Ergebnisse beeinflusst haben?
Die Beleuchtungsstärke, die während des Versuchszeitraums aufgrund schlechten Wetters gering war, könnte die Fotosyntheserate beeinflusst haben. Der Bericht diskutiert auch die Möglichkeit, dass die Fotosyntheserate von Wasserpflanzen sich von der von Landpflanzen unterscheiden könnte.
- Quote paper
- Daniel Schütz (Author), 2000, Praktikumsbericht zur CO2 Produktion (Fotosynthese) von Fieberquellmoos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105212