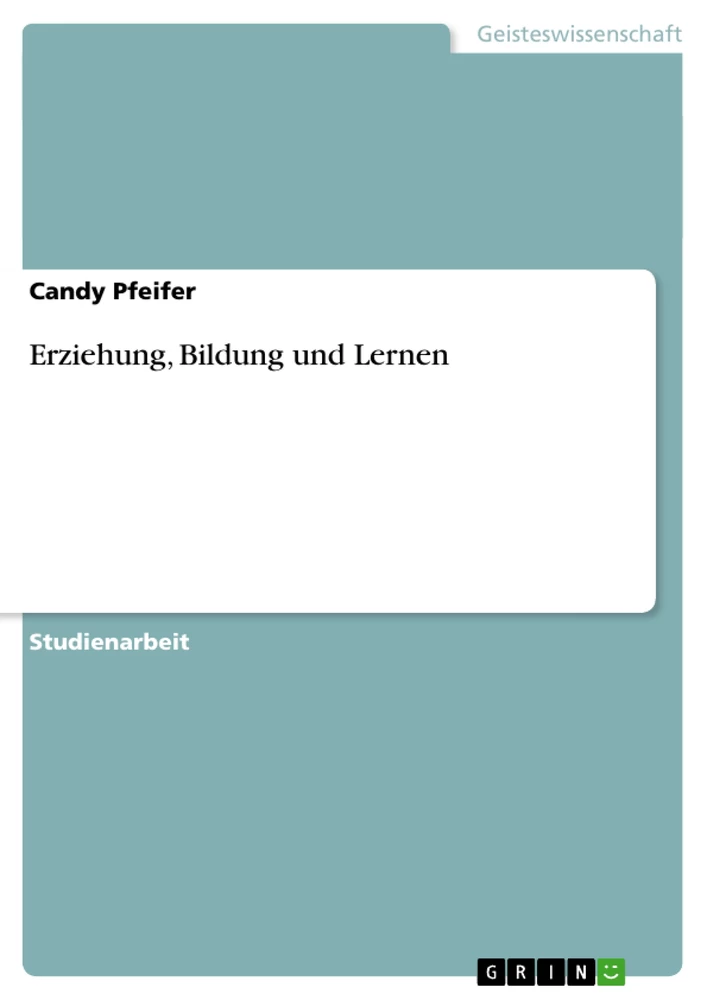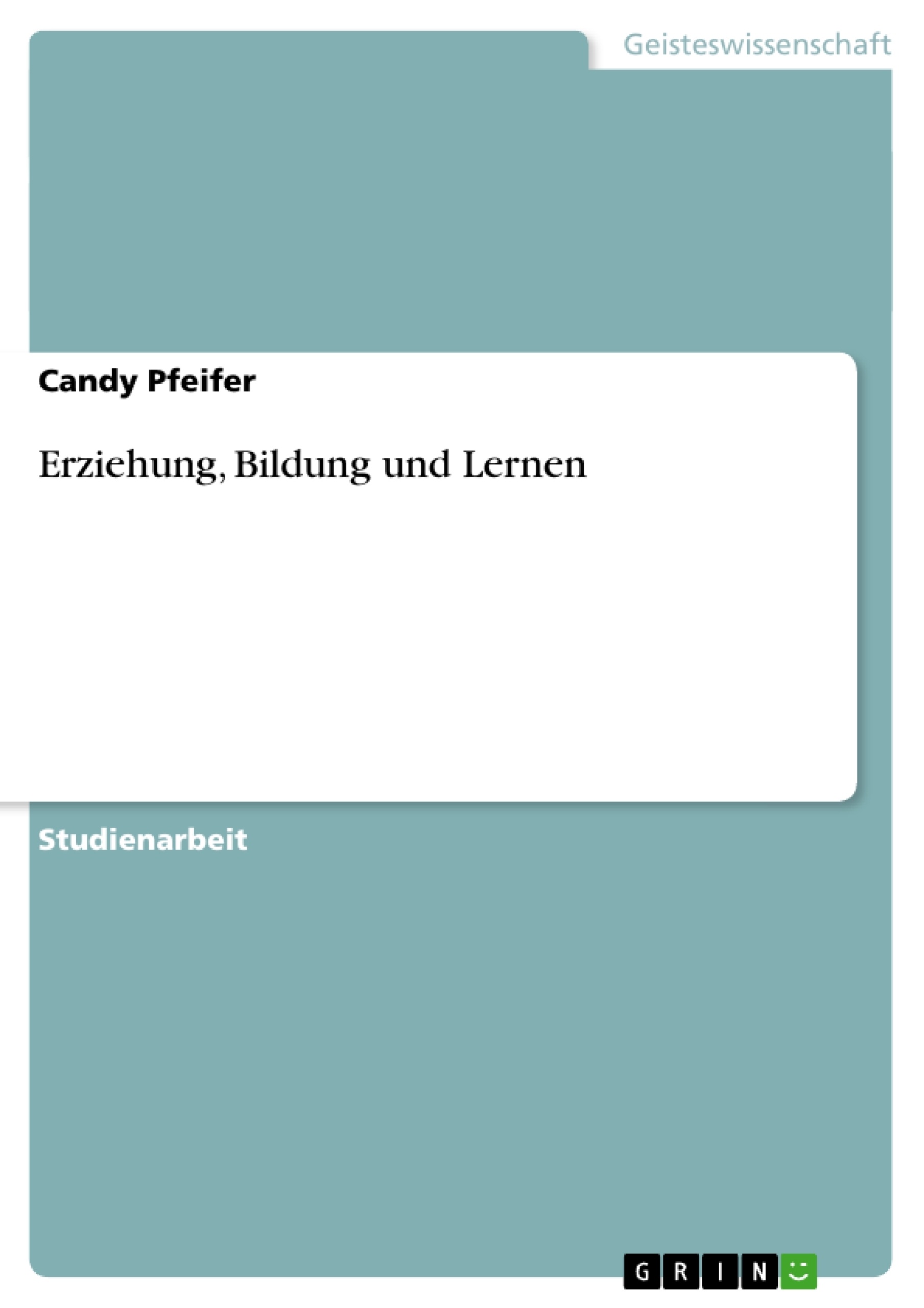Was bedeutet es wirklich, ein Mensch zu sein, der lernt, sich bildet und erzogen wird? Diese Frage durchzieht die Seiten dieser tiefgründigen Auseinandersetzung mit den fundamentalen Begriffen Erziehung, Bildung und Lernen. Jenseits gängiger Definitionen enthüllt dieses Werk die vielschichtigen Interpretationen und historischen Wandlungen, die diese Konzepte geprägt haben. Es ist eine fesselnde Reise durch die deutsche Geistesgeschichte, die den Leser einlädt, über die zweckfreie Entfaltung der eigenen Anlagen und die Auseinandersetzung mit den Schöpfungen des menschlichen Geistes nachzudenken. Dabei wird deutlich, wie Erziehung und Lernen untrennbar miteinander verwoben sind und wie sie die Basis für Enkulturation, Sozialisation und Personalisation bilden. Anhand konkreter Beispiele aus der sozialpädagogischen Praxis, insbesondere der Erziehungsbeistandschaft, wird die Bedeutung einer ganzheitlichen Förderung junger Menschen beleuchtet. Der Autor wirft einen kritischen Blick auf die Herausforderungen einer defizitären Erziehung und deren Auswirkungen auf schulische Leistungen und die Fähigkeit zur aktiven Auseinandersetzung mit der Welt. Zugleich plädiert er für eine differenzierte Betrachtung des Bildungsbegriffs, die über konventionelle Maßstäbe hinausgeht und auch die "Lebensintelligenz" junger Menschen würdigt. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit den Grundlagen der Pädagogik auseinandersetzen und die komplexen Zusammenhänge zwischen Erziehung, Bildung und Lernen verstehen möchten. Es regt dazu an, die eigene Rolle als Erzieher, Lehrender oder Lernender zu reflektieren und neue Perspektiven für die Gestaltung einer humanen und zukunftsorientierten Gesellschaft zu entwickeln. Es ist eine Einladung, über den Tellerrand des Gewohnten hinauszublicken und die tieferen Sinngehalte von Erziehung, Bildung und Lernen zu ergründen. Ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung des Individuums in der modernen Gesellschaft, beleuchtet durch fundierte Theorie und anschauliche Praxisbeispiele aus der Sozialpädagogik und Jugendhilfe. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen, die unser Verständnis von Menschsein und Entwicklung prägen, und eine Einladung, die eigene pädagogische Haltung zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Gliederung
1 Einleitung
2 Begriffsklärungen
2.1 Erziehung
2.2 Bildung
2.3 Lernen
2.4 Resümee
3 Zusammenführung der Begriffe
4 Persönliche Stellungnahme
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Das Thema der vorliegenden Arbeit, „Erziehung, Bildung und Lernen“ stellt ein sehr weites Feld der sozialen Arbeit dar. Sozialpädagogisches Handeln wird in jedem praktischen Aufgabenfeld von wenigstens einem dieser Begriffe begleitet. Auch in der Theorie, vor allem in pädagogischer Fachliteratur sind „Erziehung“, „Bildung“ und „Lernen“ feste Bestandteile. So könnte jeder einzelne dieser Begriffe näher betrachtet mit seinen Theorien und Ansprüchen ganze Diplomarbeiten füllen.
Selbstverständlich können in einer Seminararbeit nicht alle Aspekte dieses Themas beleuchtet werden. Vielmehr sollen zunächst in Punkt 2 die Begriffe kurz definiert werden. In Punkt 3 soll eine von vielen Möglichkeiten dargestellt werden, eine Verbindung zwischen Erziehung, Bildung und Lernen zu schaffen.
Dabei erhebt die Seminararbeit aufgrund des Umfangs des gewählten Themas keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll einen knappen Überblick und eine kurze Zusammenfassung des Themas darstellen.
2 Begriffsklärungen
2.1 Erziehung
Der Begriff Erziehung ist ein Alltagsbegriff. Deshalb unterliegt er vielgestaltigen Auslegungen und Konventionen, woraus sich ergibt, dass eine Einheitsdefinition undenkbar ist. (vgl. Kron 1994, S.54)
Aus diesem Grunde sollen hier mehrere Definitionsversuche angesprochen werden.
Als Erziehung beschreibt der Brockhaus die „körperliche, geistige und sittliche Formung eines Menschen, besonders der Jugend. Sie beginnt in der Familie, die seit Jahrhunderten mehr und mehr durch die Schule unterstützt wird. Außerdem wirken die Kirchen und Jugendorganisationen mit. Ziel ist, den jungen Menschen in die bestehende Kultur einzufügen und ihn zur selbständigen Persönlichkeit zu erziehen.“ (Brockhaus, S.233)
Schon diese allgemeine Definition, die aus keinem Fachbuch der Pädagogik stammt gibt wieder, dass es sich bei der Erziehung um einen Prozess handelt, welcher schon im frühesten Kindesalter beginnt. Auch lässt sich daraus schon eine Veränderung erkennen, die im Laufe der Zeit stattfand.
„Im historischen Wandel unterliegt Erziehung verschiedenen Entwicklungsprozessen und Entwicklungstendenzen.“ (Dabitz/Scheuring (Red.) 1993, S.295) Früher war die Erziehung ausschließlich Aufgabe der Familie, welche heute jedoch durch eine Vielzahl von Institutionen unterstützt wird. Einige von ihnen lassen sich in §§ 27-35 des Kinderund Jugendhilfegesetzes als „Hilfen zur Erziehung“ finden.
W. Brezinka gibt in seinem Buch „Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft“ eine Definition von Erziehung, in der er die einseitige Interaktion zwischen Erwachsen und Heranwachsenden als „soziales Handeln“ bezeichnet:
„Unter Erziehung werden soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten. Die kürzeste Form dieses Begriffsinhaltes ist folgender Satz: Als Erziehung werden Handlungen bezeichnet, durch die Menschen versuchen, die Persönlichkeit anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht zu fördern.“ (Kron 1994, S.55)
Aus den oben genannten Definitionen ergibt sich, dass Erziehung zumeist vom Erwachsenen ausgeht und sich an ein Kind oder einen Jugendlichen richtet. Dies trifft auf das Grundverständnis der Erziehung in Familie, Schule und anderen Einrichtungen, wie Kindertagesstätten auch zu.
Jedoch kann Erziehung im weiteren Verständnis auch von Staat oder Gesellschaft ausgehen und sich an Erwachsene oder bestimmte Gruppen von Erwachsenen richten, worauf ich jedoch aufgrund des Umfangs dieses Themas nicht näher eingehen möchte.
2.2 Bildung
Der Begriff „Bildung ist eine speziell deutsche Wortprägung, für den sich in anderen Sprachen kein entsprechender Ausdruck findet. Daher ist er nur vor dem Hintergrund deutscher Geistesgeschichte verständlich. Jedoch ist seine Bedeutung umstritten. (vgl. Blomeyer, Novak, Michel, Vörg 1976, S.85)
Der Brockhaus erklärt Bildung als "bewußte planmäßige Entwicklung der natürlich vorhandenen geistigen und körperlichen Anlagen des Menschen. Auch der durch diese Entwicklung erreichte Zustand wird Bildung genannt." (Brockhaus, S.91) Schon dieser einfache Klärungsversuch verdeutlicht, dass der Begriff Bildung zwei Aspekte umfasst. Zum einen ist Bildung als ein Prozess, zum anderen als das Produkt dieses Prozesses anzusehen.
Um 1800 wurde der Begriff Bildung von W. v. Humboldt und J.H. Pestalozzi in die pädagogische Fachsprache eingeführt, wo er bis heute den geistesgeschichtlichen Kontext dieser Zeit bewahrt.
Bildung sollte, gegensätzlich zur Ausbildung die zweckfreie Entfaltung aller Anlagen ermöglichen, besonders aber die Kräfte des Heranwachsenden fördern, die seine Humanität ausmachen, wie Individualität, Geistigkeit und Moralität.
Deshalb beruhte Bildung weniger auf Umwelterfahrung, als auf der Auseinandersetzung mit den Schöpfungen des menschlichen Geistes.
Erst, wenn sich der junge Mensch in diesen Bereichen genügend "gebildet" hatte, sollte seine berufliche Ausbildung erfolgen. Nur so war er zur autonomen und verantwortlichen Gestaltung seines Lebens imstande. (vgl. Blomeyer, Novak, Michel, Vörg 1976 , S.86)
Die Geschichte des Bildungsbegriffes sowie der Bildungstheorie ist, wie erwähnt besonders bestimmt von Humboldt und Pestalozzi. Weiterhin wären unter anderen Herder, Schiller und Hegel als Vertreter anzuführen.
"Gegenwärtig ist eine einheitliche Aussage über den Bildungsbegriff unmöglich. So wird es als unmöglich bezeichnet, den Begriff in der pädagogischen Fachsprache zu verwenden; zum anderen erfolgt eine Präzisierung des Bildungsbegriffs; oder aber der Begriff Bildung wird für alles in Anspruch genommen." (Dabitz/Scheuring (Red.) 1993,S.168)
Aus diesen Definitionsversuchen, sowie dem kurzen Anriß der Geschichte dieses Begriffs läßt sich erkennen, dass es kaum möglich ist, diesen klar zu definieren.
2.3 Lernen
Lernen als Grundbegriff der Pädagogik, der ebenfalls in der Alltagssprache eine Bedeutung findet ist sehr vieldeutig. Man versucht diesen Begriff natürlich in wissenschaftlichen Zusammenhängen zu präzisieren und zu klären, jedoch kann man bis heute nicht von einer einheitlichen Definition sprechen.
Inzwischen wird der Lernbegriff so stark abstrakt definiert, dass eine Anwendung auf physikalische, chemische, biologische und geistige Prozesse möglich ist. (vgl. Krüger/Helsper 1996, S.93)
Die Erklärung „Im vorwissenschaftlichen Sprachgebrauch ist nur in solchen Situationen von Lernen die Rede, in denen wir uns absichtlich und zumeist unter mehr oder weniger großer Anstrengung irgendwelche Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen. Außerdem wird stillschweigend unterstellt, dass sich mit dem Lernen immer auch eine Leistungssteigerung einstellt; bleibt dies erwartete Ergebnis aus, so ist eben nicht gelernt worden.“ (Bredenkamp 1974, S.607f.) gibt eine allgemeine Vorstellung von Lernen wieder. (vgl. Kron 1994, S.66)
Diese Vorstellung sagt aus, dass beim Lernen im allgemeinen Sprachgebrauch allein das Ergebnis, nämlich die Leistungssteigerung von Bedeutung ist, der Prozess und die damit verbundene Anstrengung jedoch unerheblich.
Zdarzil (1972, S. 118) versteht unter Lernen „den Erwerb motorischer Fertigkeiten [...] und die Aneignung von kognitiven und sprachlichen Leistungen [...] wie auch die Übernahme von Gefühlseinstellungen, Motivationen, Wertmaßstäben und Rollenmustern. Das all diesen Lernprozessen Gemeinsame ist darin zu verstehen, dass es sich...jeweils um eine Entstehung oder Veränderung von Verhaltensweisen, d.h. die Veränderung des Verhaltensrepertoires des Individuums handelt.“ (vgl. Kron 1994, S. 67)
Dieser Definitionsversuch gibt an, dass Lernen immer eine Veränderung des Individuums beinhaltet. So versucht also dieser Klärung zufolge der Lehrende den Lernenden, beziehungsweise der Lernende sich selbst zu verändern oder zu beeinflussen.
Der Lernbegriff hat in der Theorie der Sozialpädagogik eine große Bedeutung. Andere zentrale Begriffe, wie beispielsweise Erziehung oder Sozialisation werden häufig mit Lernprozessen gleichgesetzt, und somit zum Basisbegriff erklärt. (vgl. Kron 1994, S.65) „Eine pädagogische Betrachtung des Lernens wird [...] zunächst das Interesse auf die Werte und Normen, die Einstellungen und Erwartungen, Bedürfnisse und Interessen, Rollen und Regeln sowie deren makro- und mikro-soziale Bedingungszusammenhänge richten und dann auf die an oder mit diesen sozialen Inhalten sich vollziehenden Prozesse, in welchen die Inhalte in bestimmten Arten und Weisen „transportiert“ oder „vermittelt“ werden.“ (Kron 1994, S.65f.)
Diese Betrachtung gibt wieder, dass bei dem Begriff „Lernen“ aus pädagogischer Sicht nicht allein die Ziele und Ergebnisse im Vordergrund stehen, sondern der gesamte Prozess mit seinen Mitteln.
Zu diesem Thema ist eine Vielzahl von Lerntheorien existent, die jedoch an dieser Stelle aufgrund ihres Umfangs nicht erörtert werden können.
2.4 Resümee
Zusammenfassend kann über die Begriffe „Erziehung“, „Bildung“ und „Lernen“ gesagt werden, dass sich eine Definition als sehr schwierig erweist, da die Begriffe zum Teil auch wissenschaftlich noch nicht allgemeingültig und einheitlich definiert sind. Es sollte jedoch unter Punkt 2 lediglich ein knapper Überblick gegeben werden.
3 Zusammenführung der Begriffe
Lernen, Erziehung und Bildung sind möglich und notwendig, deshalb
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bildung
Als Ergebnis der aktiven Auseinandersetzung mit der Welt, als Ziel des selbständigen und erzieherisch unterstützten Lernens
Quelle: Unterrichtsmaterialien von Dr. Holz
Diese Übersicht soll knapp gefasst einen möglichen Zusammenhang zwischen den Begriffen „Erziehung“, Bildung“ und „Lernen“ darstellen. Aus ihr geht hervor, wie sich diese drei Grundbegriffe mit drei weiteren, nämlich Enkulturation, Sozialisation und Personalisation wechselseitig beeinflussen.
Der Beginn der Übersicht behauptet die Notwendigkeit von Erziehung und Lernen, was damit erklärt wird, dass das Lernen zu Enkulturation, Sozialisation und Personalisation führt, und Erziehung Enkulturations-, Sozialisations- und Personalisationshilfe leisten, welche wiederum zu Enkulturation, Sozialisation und Personalisation führen. Das bedeutet, dass der Mensch durch Lernen und mittels Erziehung kulturelle Lebensweise und soziales Verhalten lernt und seine Persönlichkeit aufbaut. Damit kann gesagt werden, dass Erziehung und Lernen den einzelnen Menschen zu einem Individuum machen und ihn zum eigenverantwortlichen Handeln mehr oder weniger angepasst an gesellschaftliche Normen und Werte befähigen. Den Schluß der Übersicht bildet die Aussage, dass Enkulturation, Sozialisation und Personalisation, und somit indirekt auch Erziehung und Lernen, Bildung zur Folge haben. Bildung wird also hier als das Ziel und Ergebnis von Erziehung und Lernen dargestellt, welches eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt beinhaltet. Zusammenfassend soll der Mensch nach dieser Übersicht also lernen und erzogen werden, damit ihm Enkulturation, Sozialisation und Personalisation zukommt, und er die Fähigkeit erhält, sich mit der Welt und sich selbst als Person auseinander zu setzen, und somit zu bilden.
4 Persönliche Stellungnahme
An dieser Stelle möchte ich aus meiner Sicht auf Theorie und Praxis einen Zusammenhang zwischen Erziehung, Bildung und Lernen darstellen.
Ich bin in der Praxisphase in der Erziehungsbeistandschaft des Diakoniewerkes tätig, welche eine ambulante Form der Hilfe zur Erziehung gemäß § 30 KJHG darstellt. Im Rahmen dieser Praxisstelle habe ich also sehr viel mit Erziehung zu tun, da mein Einsatzgebiet vor allem Familien beinhaltet, in welchen Erziehungsschwierigkeiten auftreten, sich Jugendliche also nicht mehr von den Eltern lenken lassen, oder Eltern selbst mit der Erziehung überfordert sind. Weiterhin werden in meiner Praxiseinrichtung Betreuungsweisungen angeboten, welche als richterliche Weisungen gemäß § 10 JGG in Anspruch genommen werden.
Während meiner Arbeit habe ich die Erfahrung gemacht, das vor allem Jugendliche, welchen im Elternhaus eine defizitäre Erziehung mit vielen Problemen zwischen ihnen und den Eltern oder auch den Eltern untereinander zuteil wurde, auch erhebliche schulische Probleme oder sogar Lernbehinderungen aufweisen.
Damit kann ich den engen Bezug zwischen Erziehung und Lernen auch aus der Praxis bestätigen.
Weiterhin haben viele der Jugendlichen mit komplizierten Familienverhältnissen oder negativen biographischen Einschnitten, bei denen die Erziehung zum Teil durch Unfähigkeit oder Überforderung der Eltern nur mangelhaft erfolgte, Probleme, sich mit ihrer Umwelt und ihrer Person aktiv auseinanderzusetzen. Dazu kommt, dass sie in der Familie und durch ihre Erziehung nicht gelernt haben, soziale Beziehungen zu führen, eine kulturelle Lebensweise zu entwickeln und sich selbst als Person anzunehmen, wobei also auch die Hilfe zur Sozialisation, Enkulturation und Personalisation nicht ausreichend gewährleistet ist.
Daraus müßte sich der Übersicht in Punkt 3 nach zu urteilen ergeben, dass diese Jugendlichen auch über eine geringe Bildung verfügen, was sicher auch der Wahrheit entspricht, wenn man Bildung an einem großen Allgemeinwissen auf verschiedenen sozialen, kulturellen oder politischen Gebieten mißt, oder an schulischen Leistungen. Mir ist jedoch klar geworden, dass vor allem Jugendliche, welchen kaum eine oder nur eine sehr defizitäre Erziehung im Elternhaus zuteil wird, oftmals lediglich ungenügende Lernleistungen zeigen, weil sie von ihren Eltern nicht gefordert werden, oder kein Interesse für ihre (schulischen) Belange erhalten. Außerdem ist mir aufgefallen, dass viele dieser Jugendlichen über eine, für ihr Alter ungewöhnlich hohe "Lebensintelligenz" verfügen, also ziemlich zeitig auf eigenen Beinen stehen, aus dem Elternhaus ausziehen und über ihre Rechte und Pflichten sämtlichen Ämtern gegenüber informiert sind.
Wenn man also Bildung mit einem "Zurechtkommen in der Welt" gleichsetzt, so denke ich, dass viele der von mir betreuten Jugendlichen einen hohen Bildungsstand aufweisen.
Abschließend möchte ich sagen, dass ein Zusammenhang zwischen Erziehung, Bildung und Lernen nicht von der Hand zu weisen ist. Jedoch ist es eine Frage der Definition, inwieweit diese drei Begriffe sich wirklich wechselseitig beeinflussen.
Mir ist bewußt, dass die von mir dargestellten Erfahrungen aus der Praxis keine unbedingte Gültigkeit haben, sondern lediglich meine subjektiven Eindrücke aus neun Monaten praktischer Arbeit mit Jugendlichen beinhalten.
Auch bin ich mir auch im klaren darüber, dass es für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich ist, allgemeine Aussagen zu machen, da ich bisher nur dreizehn Klienten kennenlernen durfte. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es Verallgemeinerungen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit überhaupt geben sollte, da jeder Fall anders gelagert, und somit jeder Jugendliche individuell zu betrachten ist.
Für Erziehung und Lernen mag es Richtlinien geben, und sicherlich auch ein Maß, wobei ich bezweifle, dass dieses bei jedem Jugendlichen relevant und anwendbar ist, jedoch bin ich der Meinung, dass kein Sozialarbeiter das Recht hat, die Bildung eines Klienten zu beurteilen oder in Frage zu stellen.
5 Literaturverzeichnis
Anger, Eberhard (Redaktionelle Leitung): Der Brockhaus in einem Band. 4. Auflage. F.A. Brockhaus GmbH. Mannheim. 1992
Blomeyer, Günther; Novak, Felix; Michel, Christian; Vörg, Rita: Pädagogik 1 Grundwissen Probleme-Theorien-Anwendung. 2. Auflage. Hueber-Holzmann Verlag. München. 1976
Deutscher Verein für Öffentliche und Private Fürsorge (Hrsg.) [Red. Günther Dabitz; Dorith Scheuring]: Fachlexikon der sozialen Arbeit. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Deutscher Verein für Öffentliche und Private Fürsorge; Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer. 1993
Janssen, Karl: Jugend- und Sozialgesetze: Eine Gesetzessammlung für Studium und Praxis. 2. Auflage. Fortis-Verlag. Köln. 1999
Kron, Friedrich W.: Grundwissen Pädagogik. 4. Verb. Auflage. E. Reinhardt. München, Basel.1994.
Krüger/Helsper (Hrsg.): Einführung in Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. 2. Auflage. Leske + Budrich. Opladen. 1996
Erklärung:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist "Erziehung, Bildung und Lernen" und stellt ein weites Feld der sozialen Arbeit dar.
Was sind die Hauptziele dieser Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Begriffe "Erziehung," "Bildung" und "Lernen" zu definieren, eine Verbindung zwischen diesen Begriffen darzustellen und einen knappen Überblick über das Thema zu geben.
Wie wird Erziehung in dieser Arbeit definiert?
Erziehung wird als ein vielgestaltiger Alltagsbegriff beschrieben, der keine Einheitsdefinition hat. Es werden verschiedene Definitionsversuche angesprochen, einschließlich der Formung eines Menschen, besonders der Jugend, durch Familie, Schule und andere Institutionen. Auch soziale Handlungen, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten.
Wie wird Bildung in dieser Arbeit definiert?
Bildung wird als eine speziell deutsche Wortprägung beschrieben, für die es in anderen Sprachen keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Sie umfasst sowohl den Prozess der Entwicklung der geistigen und körperlichen Anlagen des Menschen als auch den durch diese Entwicklung erreichten Zustand.
Wie wird Lernen in dieser Arbeit definiert?
Lernen wird als ein vieldeutiger Grundbegriff der Pädagogik beschrieben, der auch in der Alltagssprache eine Bedeutung findet. Es wird versucht, den Begriff in wissenschaftlichen Zusammenhängen zu präzisieren, jedoch gibt es keine einheitliche Definition. Es beinhaltet den Erwerb von Fähigkeiten, Kenntnissen, Gefühlseinstellungen, Motivationen, Wertmaßstäben und Rollenmustern.
Wie werden die Begriffe Erziehung, Bildung und Lernen in Beziehung gesetzt?
Die Arbeit stellt einen Zusammenhang zwischen Erziehung, Bildung und Lernen dar, indem sie diese mit Enkulturation, Sozialisation und Personalisation in Beziehung setzt. Lernen und Erziehung führen zu Enkulturation, Sozialisation und Personalisation, was wiederum Bildung zur Folge hat.
Was ist die persönliche Stellungnahme des Autors?
Der Autor beschreibt Erfahrungen aus der Praxis in der Erziehungsbeistandschaft, die einen engen Bezug zwischen Erziehung und Lernen bestätigen. Jugendliche mit defizitärer Erziehung weisen oft schulische Probleme auf. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine geringe "Lebensintelligenz" vorliegt oder ein hoher Bildungsstand, wenn man Bildung mit einem "Zurechtkommen in der Welt" gleichsetzt.
Welche Literatur wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Werke aus dem Bereich Pädagogik und Sozialer Arbeit, darunter Werke von Brockhaus, Blomeyer, Dabitz/Scheuring, Janssen, Kron und Krüger/Helsper.
Was sind Enkulturation, Sozialisation und Personalisation?
Diese Begriffe werden im Zusammenhang mit Erziehung, Bildung und Lernen erwähnt, aber nicht weiter definiert oder ausgeführt in dieser Arbeit.
Welche Institutionen sind in die Erziehung einbezogen?
Familie, Schule, Kirchen und Jugendorganisationen werden als Institutionen gennant, die bei der Erziehung mitwirken.
- Quote paper
- Candy Pfeifer (Author), 2001, Erziehung, Bildung und Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105197