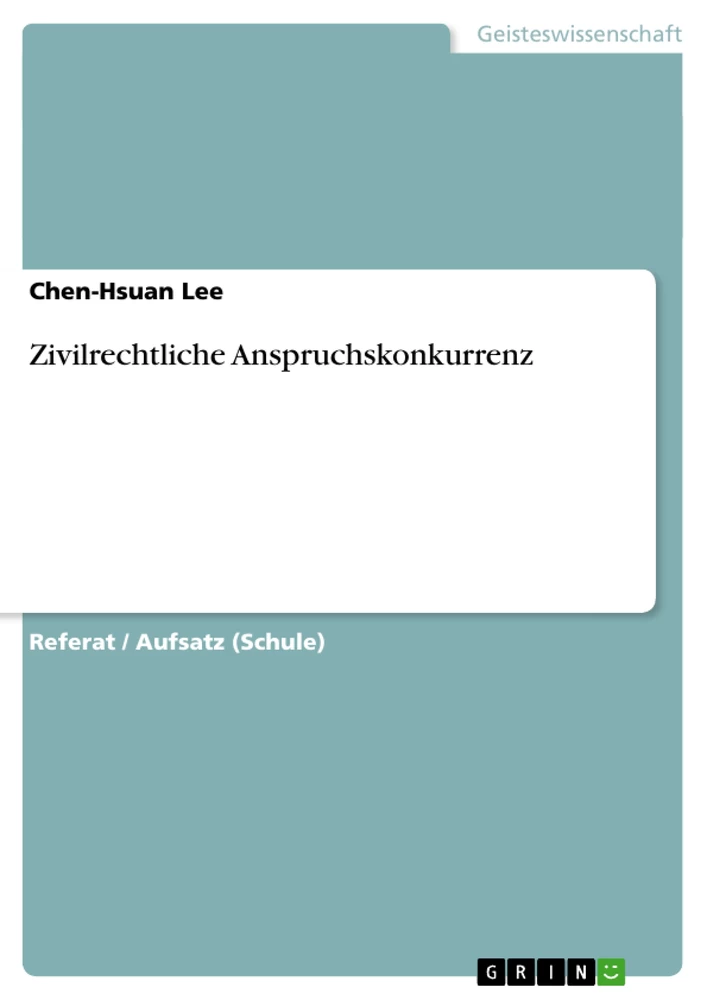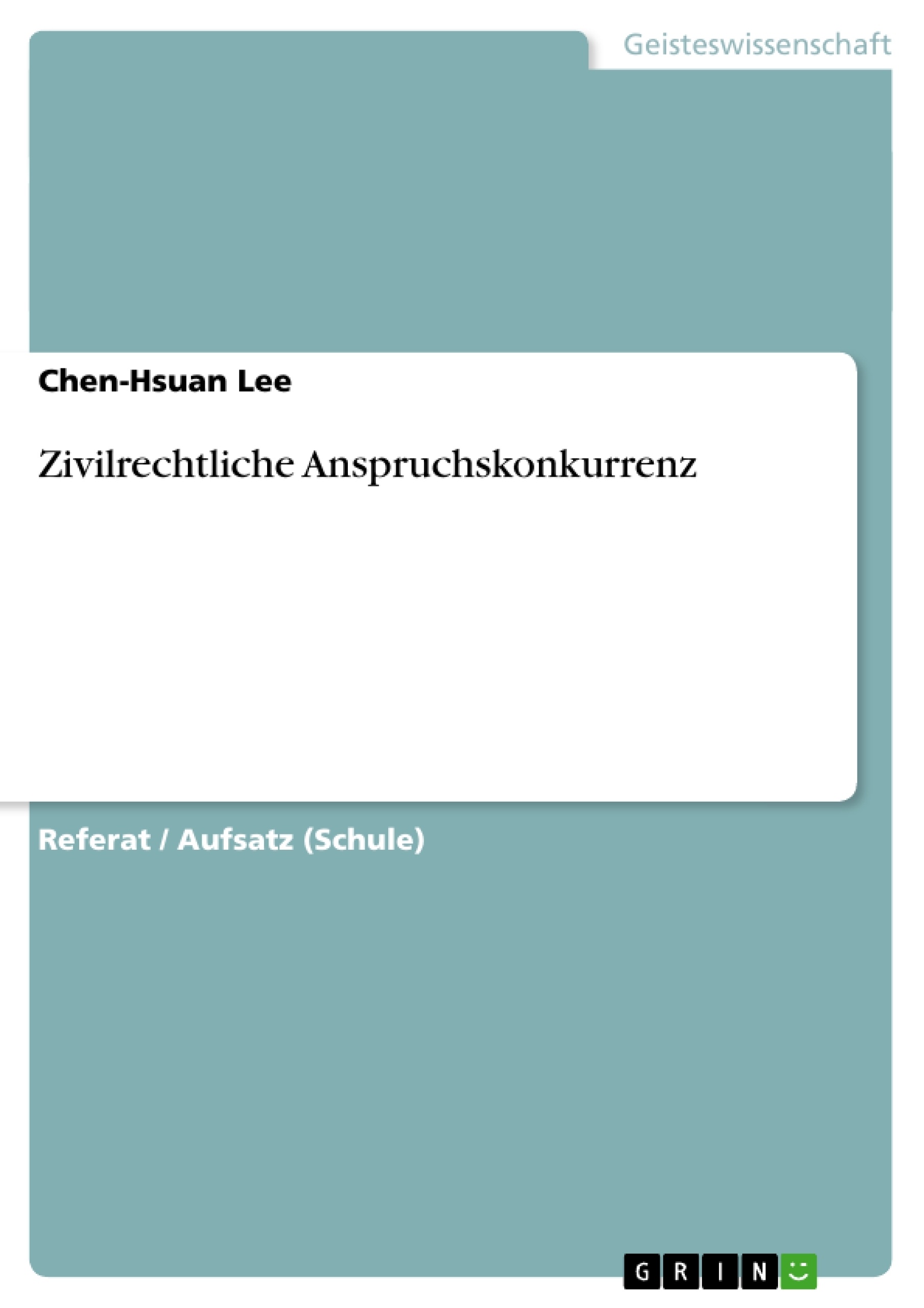Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Trümmerhaufen juristischer Möglichkeiten, ein Dickicht aus Paragraphen und Urteilen. Jeder Stein, jeder Zweig könnte den Schlüssel zu Ihrem Recht bergen – oder Sie in die Irre führen. Dieses Buch ist Ihr Kompass in der komplexen Welt der zivilrechtlichen Anspruchskonkurrenz. Es enthüllt, wie verschiedene Anspruchsgrundlagen – von vertraglichen Verpflichtungen über dingliche Rechte bis hin zu unerlaubten Handlungen und Bereicherungsansprüchen – miteinander verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen. Anhand praxisnaher Fallbeispiele, wie dem Mietwagenfall oder der gestürzten Hausfrau im Kaufhaus, wird die Theorie lebendig und verständlich. Erfahren Sie, wann ein vertraglicher Anspruch einen deliktischen verdrängt, wann ein dinglicher Anspruch parallel geltend gemacht werden kann und wie die verschiedenen Meinungsstände in der Rechtswissenschaft diese Konkurrenzen beurteilen. Von BGB AT über Schuldrecht bis hin zu familien- und erbrechtlichen Ansprüchen – dieses Werk bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anspruchsebenen und deren Zusammenspiel. Die klare Strukturierung und die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Anspruchsnormen ermöglichen es sowohl Studierenden als auch Praktikern, die komplexen Zusammenhänge der Anspruchskonkurrenz zu durchdringen und die optimale Anspruchsstrategie für ihren Fall zu entwickeln. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die im Zivilrecht den Durchblick behalten und ihre Rechte effektiv durchsetzen wollen, inklusive einer verständlichen Erläuterung von culpa in contrahendo und p.V.V. (positive Vertragsverletzung). Entdecken Sie die feinen Unterschiede zwischen Leistungskondiktion und Eingriffskondiktion und meistern Sie die Herausforderungen der Anspruchsdurchsetzung mit diesem fundierten und praxisorientierten Ratgeber.
Zivilrechtliche Anspruchskonkurrenz
Wer Schaden verursacht, muss grundsätzlich für den Schaden haften. Der Geschädigte ist berechtigt, aus verschiedenen Anspruchsgrundlagen Ansprüche gegen den Ersatzpflichtigen stellen. Der Anspruchssteller ist berechtigt, einen Anspruch auszuwählen, von welchem er am meisten profitiert, darf jedoch nicht alle Ansprüche haben. Es gibt sieben Anspruchsebenen, aus denen die Anspruchsgrundlagen bestehen.
Die folgende Tabelle zeigt die sieben Anspruchsbereiche mit jeweils dazugehörenden Beispielen:
1) Vertragliche Ansprüche:
§§ 556, 325, 604, 433, 611, 535
2) Vertragsähnliche Ansprüche:
c.i.c. ( Culpa in contrahendo)
3) Dingliche Ansprüche:
§§ 985, 929
4) Ansprüche aus unerlaubter Handlung/ Gefährdungshaftung:
§§ 823, 828
5) Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung:
§§ 812, 816, 818, 822
6) Familiäre und erbrechtliche Bereicherung:
§§ 1601, 1602
7) Ansprüche aus BGB AT:
§§ 122, 179, 31
Im Folgenden sind verschiedene Meinung zu zivilrechtlichen Anspruchskonkurrenzen aufgeführt:
BGB RGRK
Zwischen Eigentümer und Besitzer entsteht ein schuldrechtliches Verhältnis, so bleibt der Eigentumsanspruch trotzdem bestehen. In diesem Fall liegt eine Anspruchskonkurrenz zu den vertraglichen Rückgabeansprüchen vor, auch gegenüber Anspruchsbereichen, Ansprüchen aus Geschäftsführung ohne Auftrag, ungerechtfertigter Bereicherung oder unerlaubter Handlung. In dem Fall, dass der Mieter die Mietsache den Dritten überlassen hat und die Mietsache nach der Beendigung der Mietzeit nicht zurückgegeben hat, gilt die Vorschrift § 556 für den Herausgabeanspruch des Vermieters gegen den Mieter und § 985 kommt ebenfalls in Anwendung, wenn der Vermieter der Eigentümer ist.
Dingliche Herausgabeansprüche können gleichzeitig mit den gesetzlichen bzw. mit den vertraglichen Schadensersatzansprüchen gelten. Jedoch ist dabei besonders die Schadensminderung zu berücksichtigen. Mit dinglichen Ansprüchen können auch Ansprüche auf Vorlegung oder Abholung von Sachen geltend gemacht werden. Nach § 894 kommen bei Grundstücken Berichtigungsansprüche und nach § 1004 Ansprüche auf Beseitigung von Störungen in Betracht.
Soergel- Mühl
Es besteht keine Subsidiarität zwischen Bereicherungshaftung und anderen Anspruchsbereichen, jedoch wenn ein Anspruch aus dem Vertrag vorliegt, so wird die Bereicherungshaftung ausgeschieden, denn der rechtfertigende Grund ist vorhanden. Bereicherungsansprüche können aber mit Ansprüchen aus unerlaubter Handlung und mit einem Anspruch auf Herausgabe gemäß § 985 konkurrieren.
Das Verhältnis des § 985 zu anderen Ansprüchen ist aber umstritten. Die h.M. vertritt die Meinung, dass der Anspruch aus § 985 neben den Ansprüchen aus Vertrag und unerlaubter Handlung erhoben werden kann. Jedoch beginnt ein Meinungsstreit dort, wo der Besitzer ein Zurückbehaltungsrecht anwendet. Hiermit hat Siber kritisiert, dass eine Vereinigung der Ansprüche aus Eigentum und Vertrag als ein Anspruchskonkurrenz betrachtet werden soll.
Staudinger
Der Herausgabeanspruch gemäß § 985 kann mit anderen dinglichen bzw.
obligatorischen Ansprüchen konkurrieren. Z. B. mit §§ 861, 1007, 2018ff, 2029 oder mit Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung und aus unerlaubter Handlung. Der Anspruch aus § 985 kann auch mit vertraglichen bzw. mit den gesetzlichen obligatorischen Rückgabeansprüchen zusammentreffen.
Der Rückgabeanspruch gegen den Dritten gemäß § 604 besteht neben dem Rückgabeanspruch gegen den Entleiher. Der Anspruch gegen den Dritten entfällt jedoch in dem Fall, wenn das Leihverhältnis nicht mit Kündigung bzw. durch Zeitablauf beendet wird. Dabei hat es keine Bedeutung, ob der Entleiher befugt oder unbefugt die Leihsache dem Dritten gegeben hat. Der Verleiher ist der Eigentümer der Sache, so kann er auch Anspruch aus § 985 erheben.
Palandt
Eine Konkurrenz besteht zwischen vertraglichen Ansprüchen und Ansprüchen aus unerlaubter Handlung. Verletzungen der Vertragspflichte werden nicht als unerlaubte Handlung angesehen. Wenn aber die Tatbestände der §§ 823ff erfüllt sind, so sind sie als unerlaubte Handlung zu betrachten und die für die Haftung geltende Schadensersatzgrundsätze kommen in Anwendung. Denn der Vertrag verstärkt nur die allgemeine Rechtspflichten, deren Verletzung eine unerlaubte Handlung ist, kann diese jedoch nicht beseitigen.
Z.B. Ein Arzt begeht einen Behandlungsfehler. Er verletzt seine Vertragspflichten gegenüber dem Patienten und begeht gleichzeitig eine unerlaubte Handlung.
Der Patient kann sich entscheiden, welchen Anspruch er gegen den Arzt erheben will, aus Vertrag oder aus unerlaubter Handlung.
Mü-Ko
Grundsätzlich sind vertragliche und dingliche Ansprüche als zwei unabhängige und nebeneinander bestehende Anspruchsbereiche zu betrachten. Jedoch vertritt die hM und die ständige Rechtsprechung die Meinung bzw. das Prinzip, dass die vertraglichen Ansprüche generell die deliktischen Ansprüchen nicht beseitigen bzw. reduzieren dürfen. In diesem Sinne entsteht eine Stufenordnung, dass das Vertragsrecht das Deliktsrecht mit zusätzlichen Rechtspflichten ergänzt.
Ludwig Raiser hat sich mit der Theorie Sibers beschäftigt und fortgeführt, er vertritt der Mindermeinung, dass die Vindikation hinter vertraglichen Rückgabeansprüchen zurücktreten soll. Er hat eine theoretische Begründung gegeben:
„ Die Weggabe der Sache auf Grund eines zum Besitz berechtigenden Schuldverhältnisses durch den Eigentümer bedeutet eine Einschränkung des Eigentums.“1 Die Theorie bezieht Raiser auch auf dritte Personen, wer keinen Vertrag mit dem Eigentümer hat, jedoch gegenüber dem Eigentümer zum Besitz berechtigt ist. Die h.M. hat aber dieser These nicht gefolgt, mit der Begründung:
Die Weggabe der Sache an eine besitzberechtigte Person schränkt das Eigentum ein, dass der Eigentümer sich seines Rechtes zum Besitz begibt. Es muss nicht folgen, dass das Besitzrecht des anderen bestehen bleibt. Denn dies entspricht nicht dem Inhalt irgendeiner gesetzlichen Vorschrift, auch nicht dem Willen eines Eigentümers. Die Vindikation ist also durch ein Recht zum Besitz ausgeschlossen. Sie konkurriert mit vertraglichen Rückgabeansprüchen, die nach der Beendigung des Besitzrechts entstehen.
Der obligatorische Anspruch aus § 605 Abs. 1-3 nach Beendigung des Vertrags steht neben dem Herausgabeanspruch gemäß § 985. Im Fall, dass der Verleiher nicht der Eigentümer der Sache ist, und der Entleiher erfährt dies vor der Rückgabe, so entsteht die Frage, ob der Entleiher die Sache dem Verleiher zurückgeben könnte auf Grund des Anspruchskonkurrenz zwischen Eigentümer und Verleiher.
Die Reihenfolge der Prüfung von Anspruchsnormen:
Eine bestimmte Reihenfolge für die Prüfung von Anspruchsnormen dient der Zweckmäßigkeit, denn bei der Prüfung soll möglichst vermieden werden, wieder zu den Vorfragen zurückzukommen. Eine sinnvolle Reihenfolge wäre folgende:
1) Vertragliche Ansprüche: Der Vertrag ist die Grundlage und hat Wirkung auf die anderen Anspruchsnormen.
2) Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag: Die Geschäftsführung hat eine ähnliche Wirkungsweise wie der Vertrag, sie kann ein Rechtfertigungsgrund sein.
3) Dingliche Ansprüche: z.B. §§ 985 ff haben eine Spezialregelung für Schadensersatz, deshalb können sie die allgemeinen Regeln aus §§ 823, 812 ausschließen.
4) Ansprüche aus unerlaubten Handlungen/ aus ungerechtfertigter Bereicherung:
Die beiden Anspruchsnormen haben keinen Einfluss aufeinander, deshalb ist hier auch keine Vorrangigkeit festzustellen.
In jedem einzelnen Punkt der vier Gruppen können noch Anspruchsnormen festgestellt werden, sie sollen auch in eine zwecksmäßige Reihenfolge gestellt werden. Wichtig ist ebenfalls, dass bei der Subsumtion die Tatbestandmerkmale auch in einer logischen Reihenfolge geprüft werden.
Die einzelnen Anspruchsbereichen werden in dem folgendem Abschnitt mit Sachverhalte bzw. Beispiel erläutert.
Sachverhalt:
A ist Inhaber einer Mietwagenfirma. Er vermietet am 12.06.1989 einen PKW Marke Golf (Zeitwert: DM 18.500,-) an B gegen Vorlage eines Führerscheins. Vereinbarte Mietzeit sind zwei Wochen. Nach dieser Frist bringt B das Fahrzeug aber nicht zu A zurück, sondern veräußert es für DM 12.000,- an C, der allerdings weiß, dass dies nicht das Fahrzeug des B sein kann
Vertragliche Ansprüche:
A könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von DM 18.500,- gemäß §§ 556, 325 haben. Erste Anspruchsvoraussetzung wäre ein Mietvertrag gemäß § 535.
Gemäß § 556 ist der Mieter verpflichtet, die vermietete Sache nach der Beendigung der Mietzeit zurückzugeben. Sachen gemäß § 90 sind körperliche Gegenstände, laut SV ist dies das Auto. B ist also grundsätzlich verpflichtet, das Auto in ordnungsgemäßem Zustand und unverzüglich A zurückzugeben. Weitere Voraussetzung ist eine Beendigung der Mietzeit. Laut SV haben A und B einen Mietvertrag für zwei Wochen geschlossen, also ist die Beendigung des Mietverhältnisses nach zwei Wochen. Jedoch hat B den Wagen aber an C weiterverkauft, und konnte das Auto A nicht zurückgeben, also muss der Fall gemäß §325 geprüft werden, ob die Rückgabe unmöglich geworden wäre bzw. ob A einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haben könnte.
Es gibt zwei Theorien bei dem Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung: die Differenztheorie und Austausch- oder Surrogationstheorie. Die Differenztheorie besagt, dass der Gläubiger einen Anspruch auf die Differenz zwischen dem Wert der unmöglich gewordenen Leistung und seiner eigenen Gegenleistung haben könnte.
Nach der Austausch- oder Surrogationstheorie kann der Gläubiger ein Surrogat (Ersatz) für seine nicht mehr mögliche Leistung verlangen. Da die Herstellung des ursprünglichen Zustandes (Naturalrestitution) meistens unmöglich ist ( wegen der Unmöglichkeit), richtet sich der Schadensersatzanspruch in der Regel auf Geld. Naturalrestitution wird nur dann gefordert, wenn der Schuldner die Leistung in gleicher Art und Weise bzw. in gleichem Wert beschaffen kann.
Die Rechtsprechung verfolgt hier aber die abgeschwächte Differenztheorie, nach dieser Theorie wird meistens der Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach der Differenzmethode ermittelt. Es gibt hierbei jedoch zwei Qualifikationen: a) Der Gläubiger kann ebenfalls Schadensersatz nach der Austauschmethode verlangen. b) Falls der Gläubiger die Gegenleistung bereits erbracht hat, kann er nach der Austauschmethode Ersatz für die unmöglich gewordene Leistung fordern.
Erste TBM dieser Vorschrift setzt voraus, dass ein gegenseitiger Vertrag vorliegen muss.
Laut SV wurde am 12.6.1989 ein Mietvertrag über den PKW Golf zwischen A und B geschlossen, also liegt dieses Merkmal vor. Weiterhin wird gefordert, dass es einen Vertragsteil gibt, dem eine Leistung obliegt. Dieser Vertragsteil ist hier B und die obliegende Leistung besteht in dem Gebrauch des Wagens, Nächstes TBM ist, dass die Leistung unmöglich wird. Da der PKW verkauft ist, kann B ihn A nicht mehr zurückgeben. Nächste Voraussetzung ist, dass die Unmöglichkeit im Umstand beruht, der von ihm zu vertreten ist. Zu vertreten bedeutet verschulden. Verschulden meint gemäß § 276 der Vorsatz und die Fahrlässigkeit. Laut SV beruht der Umstand auf einen Kaufvertrag, den er vorsätzlich mit C geschlossen hat. Es liegt hier also ein schuldhaftes Handeln vor. Hier tritt die Frage ein, ob der Kaufvertrag zwischen B und C, der gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, wirksam ist. Im Fall, dass der Kaufvertrag zwischen B und C wirksam wäre, wäre die Rückgabe des Autos unmöglich geworden und A hätte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz wegen NE. B müsste gemäß §§ 325, 249 den Zustand wiederherstellen, der bestehen würde, wenn der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt werden wäre (Naturalrestitution). Somit könnte A die Rückgabe des Autos bzw. den Wert DM 18.500,- von B verlangen gemäß § 556, 325, 249.
Dingliche Ansprüche:
Bei der Bestimmung der Wirksamkeit des Kaufvertrags zwischen B und C ist das Abstraktionsprinzip gemäß §§ 433,929 zu überprüfen. Das Abstraktionsprinzip besteht aus dem Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft. Nach dem Verpflichtungsgeschäft ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer den Besitz und das Eigentum der Sache zu verschaffen. Eigentumsverschaffung bedeutet Übertragung des Eigentums auf den Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. Abnahme ist ein Vorgang, durch den der Verkäufer sich vom Besitz der Sache befreit. Laut SV hat C den vereinbarten Kaufpreis bezahlt und den Wagen abgeholt, B hat C das Auto gegeben. Jedoch haben sie einen Vertrag über einen Gegenstand geschlossen, der einem Dritten gehört. Also verstößt der Vertrag gegen ein gesetzliches Verbot. Gemäß § 134 ist ein solches Rechtsgeschäft nichtig, somit liegt das Verpflichtungsgeschäft nicht vor. Laut Erfüllungsgeschäft gemäß § 929 müssen bei der Übertragung des Eigentums sowohl der Eigentümer, als auch der Erwerber damit einig sein, dass die Sache übergeben wird. Die Einigung ist „ein auf Eigentumsübergang gerichteter abstrakter dinglicher Vertrag“. Sie kann formlos erfolgen. Im obliegenden Fall ist B nicht der Eigentümer, nur der Besitzer während der Mietzeit, also ist das Übertragungsgeschäft nicht erfüllt.
Der Paragraph § 932 zeigt jedoch eine Ausnahme, dass der Übergang des Eigentums auch erfolgen könnte, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Die Übergangsvoraussetzung ist, dass der Erwerber zu der Zeit des Erwerbens in gutem Glauben ist. Im guten Glauben bedeutet gemäß § 932 Absatz II, dass dem Erwerber nicht bekannt ist , dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Laut SV ist C jedoch bekannt, dass das Fahrzeug B nicht gehört, also ist C nicht im bösen Glauben. Die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, deshalb bleibt A der Eigentümer.
Gemäß § 985 „ Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.“ hätte A einen Anspruch auf die Rückgabe des Wagens gegen C. A ist der Eigentümer des Autos, als ist er anspruchsberechtigt. Die Herausgabe bedeutet, dass der Besitzer dem Eigentümer den unmittelbaren Besitz verschafft.
Schadensersatzanspruch aus unerlaubter Handlung:
Die Frage wäre noch zu überprüfen, ob der Kaufvertrag zwischen B und C wirksam ist. B könnte sich wegen Unterschlagung gemäß § 246 StgB strafbar gemacht haben.
„(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwerer Strafe bedroht ist.
(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
(3) Der Versuch ist strafbar.“
Nach der ständigen Rechtsprechung ist „Unterschlagung Eigentumsverletzung durch Eigentumsanmaßung, im Unterschied zum Diebstahl, ohne Gewahrsamsbruch.“2
Gewahrsam ist ein tatsächliches, von einem Herrschaftswillen getragenes Herrschaftsverhältnis ( es ist mehr als Besitz). Objektiv setzt Gewahrsam nach den Anschauen des täglichen Lebens voraus, dass der Verwirklichung des Willens zur unmittelbaren Einwirkung auf die Sache keine Hindernisse entgegenstehen. Subjektiv setzt Gewahrsam Herrschaftswillen voraus. Das Rechtsgut ist das Eigentum und der Verletzer der Eigentümer, wenn die Sache einem Dritten anvertraut ist.
Die Vorschrift fordert als erste TBM einen Täter, es ist hier B. Weiterhin verlangt die Vorschrift eine fremde bewegliche Sache. Fremd ist eine Sache, wenn sie in fremdem Eigentum steht. Laut SV ist der Wagen im Besitz des B während der Mietzeit, B ist kein Eigentümer, also ist der Wagen eine fremde bewegliche Sache. Nächstes TBM wird verlangt, dass der Täter die Sache sich selbst oder einem Dritten zueignet.
Zugeeignet kann hier die Sache selbst bzw. der in ihr verkörperte Sachwert sein. Bei der Handlung der Zueignung des Täters soll sowohl der subjektive Zueignungswille, als auch eine Betätigung des Zueignungswillens in objektiv erkennbarer Weise vorhanden sein. In vorliegendem Fall hat B den Wagen sich zu eigen gemacht und an C weiterverkauft, dadurch erlangt er eine Geldsumme von 12.000,-, also den Wert des Wagens, der ihm gar nicht gehört. Dadurch ist diese Voraussetzung auch erfüllt.
Wesentliche Voraussetzung für die Strafbarkeit des Täters ist, dass zwischen seinem Handeln und dem eintretenden Erfolg Kausalität besteht. Nach der sog.
Äquivalenztheorie sind alle Handlungen, die nicht hinweggedacht werden können, ohne das nicht auch der Erfolg entfiele, kausal. ( condicio sine qua non-Formel) Im vorliegenden Sachverhalt können die Handlungen des Täters nicht hinweggedacht werden, ohne das nicht auch der Erfolg entfällt. Also sind die Bedingungen ursächlich, kausal.
Durch die Erfüllung des TB wird grundsätzlich Rechtswidrigkeit indiziert. Keine Rechtswidrigkeit liegt nur dann vor, wenn das Handeln des Täters durch bestimmte Gründe gerechtfertigt wird. Es liegen jedoch keine rechtfertigenden Gründe vor, gemäß § 34, also handelt B rechtswidrig. Für den subjektiven Tatbestand wird gefordert, dass der Vorsatz vorliegt. Im SV liegt der Vorsatz des Täters in Form dolus directus. Täter kennt TB und will ihn verwirklichen. Die Voraussetzungen sind alle erfüllt und B hat sich gemäß § 246 StgB strafbar gemacht. Als weiteres muss geprüft werden, wofür B haften muss. Es kommt ein Schadensersatzanspruch aus unerlaubter Handlung nach § 823 Abs. 1 wegen Verletzung eines Eigentum eines anderen in Betracht. Die Erfüllung aller TBM im Strafrecht zeigt die Erfüllung der objektiven Tatbestände aus § 823. Grundsätzlich gilt in diesem Bereich wie im Strafrecht die Äquivalenztheorie. Anders als im Strafrecht kommt aber hier nicht das korrigierende Element der Schuld. Um aber unerträgliche Weitungen der Haftung auszuschließen, kommt hier eine Adäquanztheorie hinzu, nach der alle Schadensfolgen von der Haftung ausgenommen sind, die außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit liegen. Die Kausalität besteht also zwischen Handlung und Erfolg (haftungsbegründend) und zwischen Erfolg und Schaden (haftungsausfüllend). Die Kausalität zwischen Handlung und Erfolg besteht bereits nach der Äquivalenztheorie. Die Kausalität besteht ebenfalls zwischen Erfolg und Schaden, denn der Erfolg kann nicht hinweggedacht werden, ohne den Erfolg wird auch kein Schaden für A entstehen. Im Zivilrecht gelten alle Rechtfertigungsgründe des Strafrechts, ergänzt durch die §§ 227-231 BGB, die aber inhaltlich nichts Neues bringen. Also liegen hier keine Rechtfertigungsgründe wie im Strafrecht vor. Die Vorschrift des § 823 geht davon aus, dass der Schaden vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wird. Im Bereich Vorsatz kann auf die Darstellung Strafrechts zurückgegriffen werden, ohne das es auf eine Differenzierung ankommt. B handelt also vorsätzlich ( dolus directus). Alle Voraussetzungen dieser Vorschrift sind erfüllt, also muss B für den Schaden ersetzen.
Wer zu einem solchem Schadensersatz verpflichtet ist, muss nach dem Grundsatz der „Naturalrestitution“ (§ 249) grundsätzlich den Zustand wiederherstellen, der vor dem Schadenereignis bestanden hat. Der Geschädigte kann aber auch auf Geldersatz bestehen. Ob und wie er den Schaden repariert, liegen allein in seinem Ermessen. Jedoch hat er die Pflicht, den Schaden so gering wie möglich zu halten. (Schadenminderungspflicht). Hiermit hat A gegen B einen Anspruch auf die Rückgabe des Autos oder das Geldersatz in Höhe DM 18.500,-.
Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung:
Gemäß § 812 hätte A einen Anspruch gegenüber B auf die Herausgabe des Geldes in Höhe von DM 12.000,-. Laut der Vorschrift kann die Bereicherung auf zwei Weisen erfolgen:
a) durch rechtsgrundlose Leistungen (Leistungskondition)
b) in sonstiger Weise ( Eingriffskondition)
Unter Leistungskondition ist zu verstehen, dass der Besitzer einer Sache zweckbewusst die Sache an einen Dritten verkauft o.ä. und dadurch sich um eine Geldsumme aus der Sache bereichert, die ihm nicht gehört. Leistung im Sinne des § 812 bedeutet jede zielgerichtete, zweckbewusste Vermehrung fremden Vermögens. In sonstiger Weise ist die Sache erlangt, wenn die Leistung nicht zweckbewusst und zielgerichtet erfolgt. Eine Bereicherung in sonstiger Weise basiert oft auf die Handlung des Bereicherten ( z.B. Besitzentziehung, Verbrauch, Gebrauch oder Nutzung einer fremden Sache...) oder des Dritten (z.B. durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung), die einen Eingriff in die Rechtsposition des Entreicherten darstellt. Die nur für die Leistungskondiktion geltenden Vorschrift sind hier grundsätzlich unanwendbar.
„ Etwas erlangt“ bedeutet in dieser Vorschrift eine Verbesserung der Vermögenslage.
„ Auf dessen Kosten“: hiermit versteht man, dass ein Vermögensvorteil des Bereicherten gegenüber einem Vermögensnachteil des Entreicherten bestehen muss. Dieses Tatbestandsmerkmal ist vor allem für einen Bereicherungsanspruch aus Eingriffskondiktion von Bedeutung.
„Ohne rechtlichen Grund“: Der Gesetzestext nennt keine ausdrückliche Bestimmung, wann eine Bereicherung ungerechtfertigt ist, es lässt sich keine einheitliche Formel für das Vorliegen oder Fehlen des die Vermögensverschiebung rechtfertigenden Grundes aufstellen. Es ist in jedem Einzelfall gesondert zu entscheiden, ob ein die Vermögensverschiebung rechtfertigender Grund vorhanden ist.
B hat die Voraussetzung aus Leistungskondiktion erfüllt, so hat A gegen ihn einen Anspruch auf Herausgabe des Erlangten. B muss gemäß §812 die Geldsumme in Höhe von DM 12.000,-, die er durch den Wagen des A’s erzielt hatte, herauszugeben.
Die Vorschrift § 816 kommt in Anwendung, wenn C gutgläubig bei dem Vertragsschluß gewesen wäre. B muss in dem Fall auch DM 12.000,- A zurückgeben.
A hat vier Ansprüche gegen B: Anspruch aus Vertrag, dinglicher Anspruch (Rückgabe des Autos §985), deliktischer Anspruch ( Naturalrestitution § 249), und Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ( Herausgabe des Erlangten: DM 12.000,-, § 812).
Vertragsähnliche Ansprüche:
Beispiel:
Hausfrau H betritt Kaufhaus K uns sich ein paar Rollen Nähgarn zu kaufen. Als sie die Stoffabteilung betritt, rutscht sie auf der glatten , soeben geputzten Bodenfläche aus. Bei dem Sturz verletzt sie sich am Handgelenk und zerreißt ihr Kleid. Welche Ansprüche hat H gegen K?
H könnte einen Anspruch nach dem Grundsatz culpa in contrahendo (Verschulden vor dem Vertragsschluß) gegen K verlangen.
Eine Haftung für c.i.c. besteht in der Erfüllung folgender Voraussetzungen:
- ein gesetzliches Schuldverhältnis entsteht durch unmittelbaren geschäftlichen Kontakt
- der Haftpflichtiger verletzt eine der sich daraus ergebender Verhaltenspflicht
- Schaden sind entstanden
- Verschulden des Haftpflichtigen oder Dritter, deren sich der Haftpflichtige im
Rahmen des geschäftlichen Kontakts bedient
a) Gesetzliches Schuldverhältnis:
Ein gesetzliches Schuldverhältnis entsteht bereits schon durch den vorbereitenden Kontakt zwischen den Beteiligten, nicht erst durch den Beginn der Vertragsverhandlungen, dadurch haben die Beteiligten bestimmte Verhaltenspflichten zu berücksichtigen. Z.B. beim Betreten eines Kaufhauses wird ein geschäftlicher Kontakt hergestellt, auch wenn diese Person keinen bestimmten Kaufentschluß hat. Ein geschäftlicher Kontakt wird nicht hergestellt, wenn man sich bei Regen z.B. im Eingangsbereich des Kaufhauses aufhält.
b) Verhaltenspflichten:
Die Verhaltenspflichten werden je nach Situationen bzw. nach Beziehungen des Beteiligten in verschiedene Gruppen aufgeteilt:
1) Schutz- und Fürsorgepflichten für Leben, Gesundheit und Eigentum des anderen. Jedem Beteiligten an einem geschäftlichen Kontakt obliegen diese Pflichten, er soll sich so verhalten, dass andere Beteiligte keine Schäden erleiden müssen.
2) Informations-, Hinweis- und Aufklärungspflichten Jeder Vertragspartner bei Vertragsverhandlungen ist verpflichte, den anderen auf besonderen Umstände hinzuweisen, die für das Entstehen des Vertrags und die Durchführung des Vertrags wichtig sind.
3) Pflicht zur Vermeidung von Schäden infolge des Abbruchs von Vertragsverhandlungen
Nach der herrschende Meinung soll vermieden werden, dass einer der Vertragspartner Schäden erleiden müsste, wenn der andere grundlos die Vertragsverhandlungen abbricht.
Alle die oben genannten Fällen, in denen eine Haftung für c.i.c. vorliegt, führen zu einem gleichem Grundsatz, dass der Geschädigte dem Schädiger berechtigtes Vertrauen entgegenbrachte, das dieser enttäuscht hat, so dass ein Schaden entstanden ist ( Vertrauensschaden, negatives Interesse). Wer zum Ersatz des Vertrauensschadens verpflichtet ist, muss den Schaden ersetzen, den der andere dadurch erleidet, dass er auf Gültigkeit und Fortbestand des Rechtsgeschäfts vertraut. Der Haftpflichtige ist gemäß § 249 verpflichtet, den Zustand wieder herzustellen, der bestehen würde, wenn er nicht schuldhaft die ihm obliegende Verhaltenspflicht verletzt hätte.
Geschäftsunfähige haften nach den Grundsätzen der c.i.c. überhaupt nicht, für Erfüllungsgehilfen bestehen die Haftungspflicht.
Der Anspruch mit c.i.c als Grundlage kann ebenfalls neben anderen Ansprüchen bestehen, z.B. neben vertraglichen Ansprüchen bzw. neben Ansprüchen aus unerlaubter Handlung. Er kann aber nicht als Grundlage für Forderung nach Schmerzensgeld angewendet werden.
Lösung zum Beispiel:
H als Kundin beim K genießt eine Sicherheit. Es besteht zwischen H und K ein geschäftlicher Kontakt, also ist K verpflichtet, die obliegende Verhaltenspflichten zu erfüllen. Jedoch hat die Putzfrau Schäden verursacht, so ist K grundsätzlich zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Da für den Erfüllungsgehilfen aber eine Haftungspflicht besteht, so haftet die Putzfrau für den Schaden der H.
Positive Vertragsverletzung (p.V.V.)
Beispiel:
Hausfrau H kauft sich ein paar Rollen Nähgarn bei Kaufhaus K. Als sie gerade die Abteilung verlassen will, stürzt eine Teppichrolle um und fügt ihr eine Gehirnerschütterung hinzu.
Positive Vertragsverletzung ist ein in der Praxis häufig auftretender Fall der Leitungsstörung, die aber nicht im Gesetz geregelt ist. Wenn innerhalb der Schuldverhältnissen Haupt- und Nebenpflichten verletzt werden, die nicht durch andere gesetzliche Regelungen wie z.B. Gewährleistung, Unmöglichkeit oder Verzug abgedeckt werden und zu Schadensersatzansprüchen führen, kommt p.V.V in Anwendung.
Die Voraussetzung für p.V.V:
- ein Schuldverhältnis zwischen Schädiger und Geschädigten muss vorhanden sein (meisten ein Vertrag).
- Es greifen keine Spezialregelungen wie Unmöglichkeit §§ 280, 325, Verzug §§ 286, 326, Gewährleistung § 459, ein.
- Verletzung der Pflichten: Verletzung der Nebenpflichten (Beispiel: Verkehrssicherungspflicht) oder vertragswidriges Verhalten, das den Vertragszweck gefährdet.
- Entstehung von Schaden
- Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden
- Rechtswidrigkeit ( entfällt bei Notwehr § 228 und Notstand § 229)
- Verschulden nach §§ 276, 278 ( schuldhaftes Handeln, Vorsatz oder Fahrlässigkeit)
Die Rechtsfolge ist in der Regel Schadensersatz gemäß § 249, bei gegenseitigen Verträgen ausnahmsweise auch Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung (positives Interesse): Wer zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würden, wenn der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden wäre. Dazu gehören üblicherweise entgangener Gewinn (lucrum), Verdienstausfall, nicht aber Fahrt- und Transportkosten, weil diese ja auch bei ordnungsgemäßer Erfüllung entstanden wären.
Der Anspruch aus p.V.V unterliegt der 30-jährigen Verjährung.
Im BGB sind zwei wichtige Konstellationen unbeachtet geblieben, bei denen eine Haftung aus verschuldeter Pflichtverletzung Not tut. Um diese zwei Lücken zu füllen, hat die Rechtsprechung gewohnheitsrechtlich die vorgeführten Analogien „ c.i.c.“ und „ p.V.V.“ entwickelt. Sie werden von der Rechtsprechung anerkannt und wie die geschriebenen Paragraphen angewendet.
Lösung:
K kann einen Anspruch auf Schadensersatz nach p.V.V gegen K erheben. Zwischen H und K besteht ein Schuldverhältnis ( Vertrag = Verkäufer- Kunden- Beziehung). K bzw. sein Erfüllungsgehilfe hat fahrlässig die Teppichrollen nicht ordnungsgemäß hingestellt, so dass eine davon runtergefallen ist und dabei eine Kundin verletzt hat. Somit hat K seine Pflicht verletzt, dass er nicht die Sicherheit der Kunden vernachlässigt hat. Ein Schaden ist entstanden ( H hat Gehirnerschütterung), K ist zum Ersatz des erstandenen Schadensersatz verpflichtet.
Familiäre und erbrechtliche Ansprüche:
Der Anspruchsberechtigte kann einen Anspruch auf Unterhalt gegen den Anspruchsgegner erheben, wenn die in z.B. §§ 1601-1602 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Der Anspruchsteller ist dann unterhaltsberechtigt, wenn:
- er außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.
Diese Bedürftigkeit deutet Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit. Erwerbsunfähigkeit beruht hier auf z.B. Krankheit, Aufsichts- und Wartungsbedürftigkeit...o.ä.
- er mit dem Anspruchsgegner in gerader Linie verwandt sind.
Verwandtschaft im Sinne des BGB bedeutet Blutsverwandtschaft. Verwandtschaft in gerader Linie sind Personen, die voneinander abstammen. Man ist verwandt mit Eltern im 1. Grad, mit Großeltern im 2. Grad, mit Urgroßeltern im 3. Grad usw.
Die Höhe des Unterhaltsbetrages ist abhängig von dem Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen, da der Betrag den Eigenbedarf nicht überschreiten darf. Diese ist in der Düsseldorfer Tabelle geregelt.
Ansprüche aus BGB AT:
Literaturverzeichnis
[...]
1 Mü-Ko, Medicus,1986, 2.Auflage S. 885
Häufig gestellte Fragen zu Zivilrechtliche Anspruchskonkurrenz
Was versteht man unter zivilrechtlicher Anspruchskonkurrenz?
Zivilrechtliche Anspruchskonkurrenz liegt vor, wenn ein Geschädigter aufgrund eines Schadensereignisses mehrere Anspruchsgrundlagen gegenüber dem Schädiger hat. Der Geschädigte kann dann den für ihn günstigsten Anspruch auswählen, jedoch nicht alle Ansprüche gleichzeitig geltend machen. Diese Ansprüche können aus verschiedenen Rechtsbereichen stammen, wie z.B. Vertrag, Delikt oder Bereicherungsrecht.
Welche Anspruchsgrundlagen gibt es im Zivilrecht?
Es gibt sieben Anspruchsbereiche: 1) Vertragliche Ansprüche, 2) Vertragsähnliche Ansprüche (c.i.c.), 3) Dingliche Ansprüche, 4) Ansprüche aus unerlaubter Handlung/Gefährdungshaftung, 5) Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, 6) Familiäre und erbrechtliche Bereicherung, und 7) Ansprüche aus BGB AT.
Was sind Beispiele für vertragliche Ansprüche?
Beispiele für vertragliche Ansprüche sind solche aus §§ 556, 325, 604, 433, 611, 535 BGB, die sich auf Miet-, Kauf- und Werkverträge beziehen.
Was bedeutet c.i.c. (culpa in contrahendo) und wann kommt sie zur Anwendung?
C.i.c. bedeutet "Verschulden bei Vertragsverhandlungen" und kommt zur Anwendung, wenn bereits im Rahmen der Vertragsanbahnung Pflichten verletzt werden, die zu einem Schaden führen. Sie begründet einen vertragsähnlichen Anspruch.
Was sind dingliche Ansprüche und welche Beispiele gibt es?
Dingliche Ansprüche sind Ansprüche, die sich auf Sachen beziehen, insbesondere Eigentumsrechte. Beispiele sind Herausgabeansprüche nach § 985 BGB oder Ansprüche auf Eigentumsübertragung nach § 929 BGB.
Welche Ansprüche fallen unter unerlaubte Handlung/Gefährdungshaftung?
Ansprüche aus unerlaubter Handlung sind Schadensersatzansprüche aufgrund von vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzungen von Rechtsgütern (§ 823 BGB) oder aufgrund von Gefährdungshaftungstatbeständen (z.B. Tierhalterhaftung).
Was sind Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung?
Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) entstehen, wenn jemand ohne rechtlichen Grund einen Vermögensvorteil erlangt hat. Dies kann durch Leistung (Leistungskondiktion) oder auf sonstige Weise (Eingriffskondiktion) geschehen.
Wie verhalten sich dingliche Herausgabeansprüche zu anderen Ansprüchen?
Dingliche Herausgabeansprüche können grundsätzlich neben vertraglichen oder gesetzlichen Schadensersatzansprüchen bestehen. Allerdings ist die Schadensminderungspflicht zu berücksichtigen.
Was ist das Verhältnis zwischen Bereicherungsrecht und anderen Anspruchsbereichen?
Bereicherungsrecht ist grundsätzlich nicht subsidiär gegenüber anderen Anspruchsbereichen. Wenn jedoch ein vertraglicher Anspruch besteht, wird die Bereicherungshaftung oft ausgeschlossen, da ein rechtfertigender Grund vorliegt. Bereicherungsansprüche können aber mit Ansprüchen aus unerlaubter Handlung oder dinglichen Ansprüchen konkurrieren.
Welche Meinung vertritt Ludwig Raiser zur Anspruchskonkurrenz?
Ludwig Raiser, in Anlehnung an Siber, vertritt die Mindermeinung, dass die Vindikation (Herausgabeanspruch aus Eigentum) hinter vertraglichen Rückgabeansprüchen zurücktreten soll, da die Weggabe der Sache durch den Eigentümer auf Grund eines zum Besitz berechtigenden Schuldverhältnisses eine Einschränkung des Eigentums bedeutet.
Welche Reihenfolge ist bei der Prüfung von Anspruchsnormen empfehlenswert?
Eine zweckmäßige Reihenfolge ist: 1) Vertragliche Ansprüche, 2) Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag, 3) Dingliche Ansprüche, und 4) Ansprüche aus unerlaubten Handlungen/ungerechtfertigter Bereicherung. Innerhalb dieser Gruppen sollten die einzelnen Anspruchsnormen ebenfalls in einer zweckmäßigen Reihenfolge geprüft werden.
Was ist eine positive Vertragsverletzung (pVV)?
Die positive Vertragsverletzung (pVV) ist ein Fall der Leistungsstörung, der nicht im Gesetz geregelt ist. Sie tritt auf, wenn innerhalb eines Schuldverhältnisses Haupt- oder Nebenpflichten verletzt werden, die nicht durch andere gesetzliche Regelungen wie Gewährleistung, Unmöglichkeit oder Verzug abgedeckt sind und zu Schadensersatzansprüchen führen.
Was sind familiäre und erbrechtliche Ansprüche?
Der Anspruchsberechtigte kann einen Anspruch auf Unterhalt gegen den Anspruchsgegner erheben, wenn die in z.B. §§ 1601-1602 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
- Quote paper
- Chen-Hsuan Lee (Author), 2001, Zivilrechtliche Anspruchskonkurrenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105151