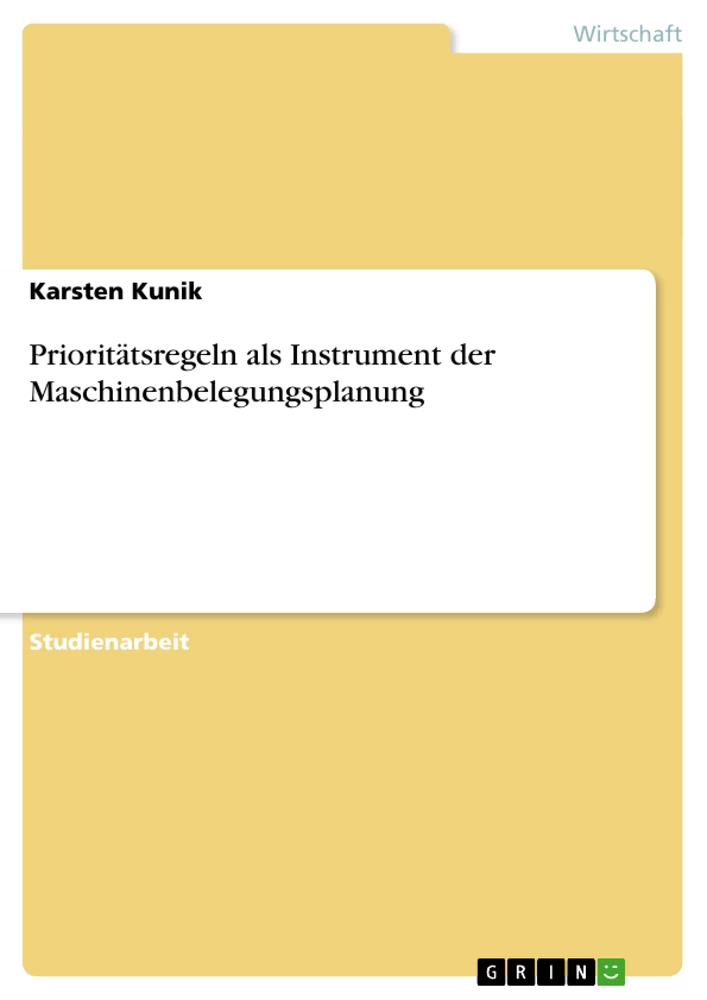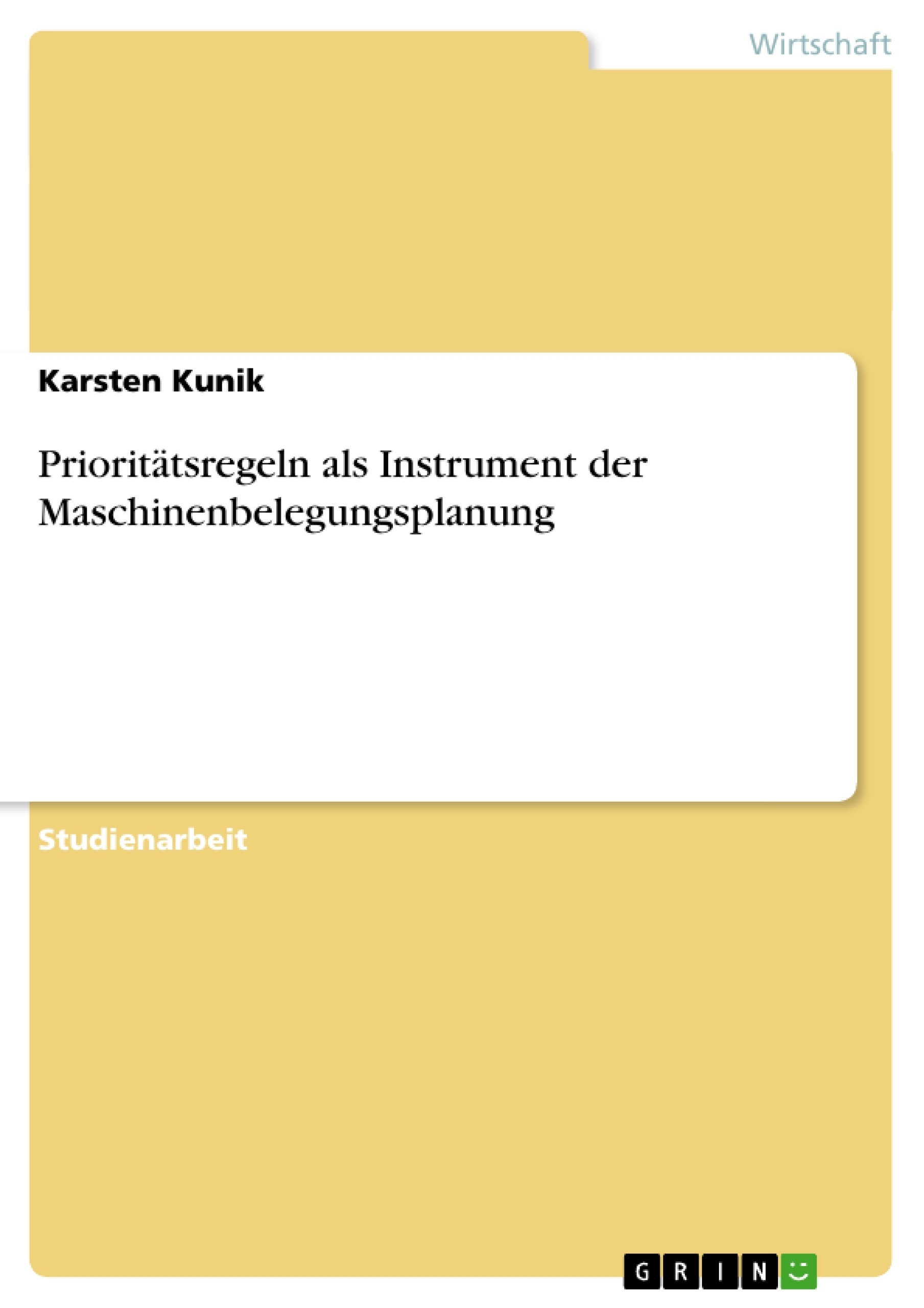Stellen Sie sich vor, Ihre Produktionslinien laufen reibungslos, Termine werden eingehalten und Ihre Maschinen sind optimal ausgelastet – ein Zustand, der in der heutigen, schnelllebigen Wirtschaftswelt essentiell ist. Dieses Buch enthüllt die Geheimnisse der effizienten Maschinenbelegungsplanung und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Fertigungsabläufe optimieren können. Im Zentrum steht die Anwendung von Prioritätsregeln, ein mächtiges Instrument zur Ablaufplanung in der Produktionsplanung und -steuerung. Entdecken Sie, wie Sie durch die richtige Wahl und Kombination von Prioritätsregeln die Durchlaufzeiten verkürzen, die Kapazitätsauslastung erhöhen und Termintreue gewährleisten. Von den Grundlagen der Maschinenbelegungsplanung über die Klassifizierung und Anwendung verschiedener Prioritätsregeln bis hin zur Beurteilung ihrer Wirksamkeit – dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Materie. Lernen Sie, wie Sie die komplexen Herausforderungen der Werkstattfertigung meistern und Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Level heben. Egal, ob Sie in der Produktionsplanung, Fertigungssteuerung oder im Logistikmanagement tätig sind, dieses Buch liefert Ihnen wertvolle Erkenntnisse und praktische Lösungsansätze, um Ihre Produktionsziele zu erreichen. Erfahren Sie, wie Sie die neuesten EDV-Programme zur Produktionsplanung und -steuerung optimal nutzen und die einfache Handhabung von Entscheidungsregeln zu Ihrem Vorteil einsetzen. Dieses Buch ist Ihr Schlüssel zur Optimierung Ihrer Produktionsprozesse und zur Steigerung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Tauchen Sie ein in die Welt der Maschinenbelegungsplanung und Prioritätsregeln und sichern Sie sich den entscheidenden Vorteil in der dynamischen Welt der Fertigung. Die detaillierte Darstellung der verschiedenen Zielsetzungen, von durchlaufzeitbezogenen bis hin zu kapazitätsorientierten und terminorientierten Zielen, ermöglicht es Ihnen, die für Ihr Unternehmen relevantesten Aspekte zu identifizieren und gezielt zu optimieren. Lassen Sie sich von diesem umfassenden Leitfaden inspirieren und transformieren Sie Ihre Produktionsabläufe in eine effiziente und zukunftsorientierte Wertschöpfungskette.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen der Maschinenbelegungsplanung
2.1 Einordnung und Aufgaben
2.2 Prämissen und Zielsetzungen
2.3 Lösungsansätze
3 Prioritätsregeln
3.1 Klassifizierungsmöglichkeiten von Prioritätsregeln
3.2 Ausgewählte elementare Prioritätsregeln
3.3 Kombinierte Prioritätsregel
3.4 Beurteilung
4 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2-1: Zusammenhänge wesentlicher Produktionsformen, Teilaufgaben und deren Methoden
Abbildung 2-2: Mögliche Zielsetzungen im Rahmen ablauforganisatorischer Probleme
Abbildung 2-3: Komponenten der Auftragsdurchlaufzeit
Abbildung 2-4: Einordnung möglicher Lösungsverfahren
Abbildung 3-1: Gliederungsmöglichkeit von Prioritätsregeln
Abbildung 3-2: Verteilung der Fertigstellungszeiten bei verschiedenen Prioritätsregeln
Abbildung 3-3: Wirksamkeit von Prioritätsregeln
Abbildung 3-4: Prozentuale Verteilung der Prioritätsregeln in der praktischen Anwendung
1 Einleitung
Die fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung fordert von vielen Unternehmen eine flexible und genaue Planung bezüglich einer termingerechten Fertigstellung bzw. das streben nach kurzen Durchlaufzeiten und hohen Kapazitätsauslastungen. Daher wird es immer wichtiger den Fertigungsablauf der Produktionsmaschinen zu optimieren (Maschinenbelegungsplanung).
Bezüglich der Maschinenbelegungsplanung existieren verschiedene Verfahren, wobei Gegenstand dieser Hausarbeit die Erörterung der Ablauf- bzw. Reihenfolgeplanung mittels Prioritätsregeln in der Durchführungsplanung ist. Es soll ein Einblick vermittelt werden, inwiefern Prioritätsregeln als Instrument der Maschinenbelegungsplanung (als Lösungsansatz) zum Einsatz kommen, da sie im Bereich der Ablaufplanung –vor allem im praktischen Einsatz– eine große Rolle spielen und Thema vieler Untersuchungen sind.1 Des weiteren werden heuristische Prioritätsregeln im in den heutigen kommerziell angebotenen EDV-Programme zur Produktionsplanung und -steuerung im allgemeinen zur Festlegung des Fertigungsablaufs verwendet.2 Dieses liegt besonders an der einfachen Handhabung solcher Entscheidungsregeln.3
Die Hausarbeit gliedert sich in drei Abschnitte (Kapitel 2 bis 4) die aufeinander aufbauen. Im 2. Kapitel werden die Grundlagen der Maschinenbelegungsplanung ausgeführt. In der u.a. die Aufgaben, Ziele sowie die allgemeinen Prämissen dargestellt werden.
Kapitel 3 behandelt die Prioritätsregeln mit den Grundlegenden Ausprägungen, sowie eine beispielhafte die praktische Anwendung. Es erfolgt die Vorstellung einer Auswahl von gebräuchlichen und weit verbreiteten elementaren Prioritätsregeln.4 Die weitergehende Betrachtung bezieht sich auf die Kombinationsmöglichkeiten der elementaren Prioritätsregeln und einer anschließenden Beurteilung. Abschließend wird kurz auf eine Untersuchung der praktischen Anwendung von Prioritätsregeln eingegangen. Zum Abschluss erfolgt eine kurze Zusammenfassung und ein Ausblick.
2 Grundlagen der Maschinenbelegungsplanung
2.1 Einordnung und Aufgaben
„Im Rahmen der Produktionsprozessplanung durchzuführenden Aufgaben werden i.d.R. innerhalb einer sukzessiv erfolgenden Planung in folgende Teilaufgaben zerlegt:“5
- Losgrößenbestimmung
- Durchlauf- und Kapazitätsterminierung
- Reihenfolgeplanung und Feinterminierung
Jede dieser Planungsbereiche wird einzeln für sich betrachtet und die dort entstehenden Optimierungsprobleme gelöst. Die Ergebnisse aus der vorhergehenden Planungsebene gehen dann jeweils als Daten in die nachfolgenden Ebenen mit ein.
Die Maschinenbelegungsplanung umfasst die eher kurzfristigen Planungsaufgaben, die der Reihenfolgeplanung und Feinterminierung6. Es werden Reihenfolgen für die Bearbeitung von Aufträgen gebildet (Reihenfolgeplanung) und es wird eine detaillierte zeitliche Verteilung der Aufträge auf einzelne Maschinen vorgenommen (Feinterminierung).7
Das Vorgehen bei der Maschinenbelegungsplanung richtet sich stark an den zugrundeliegenden Gegebenheiten im Produktionsbereich (z.B. Produktionsform) aus8, wodurch Art und Schwierigkeit der zu lösenden Probleme maßgeblich durch die Produktionsform beeinflusst wird9. Einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen den drei obengenannten Planungsbereichen und den wesentlichen Produktionsformen Repetitions- und Anordnungstyp gibt die Abbildung 2-1 nach DOMSCHKE/ SCHOLL/VOß.
Wie aus der Abbildung hervorgeht wird der Maschinenbelegungsplanung im Bereich der Werkstattfertigung eine große Bedeutung zugeteilt, die sowohl der Planung als auch zur Steuerung der eher kurzfristigen Ablaufplanung dient.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-1: Zusammenhänge wesentlicher Produktionsformen, Teilaufgaben und deren Methoden10
Dieses ist vor allem darin begründet, dass die Werkstattfertigung durch
- eine uneinheitliche Bearbeitungsfolge ohne strenge Anordnung der Maschinen und
- Aufträge mit ungleicher Bearbeitungszeit ohne festgelegten Rhythmus im Fertigungsablauf, gekennzeichnet ist.11 Aufgrund der daraus entstehenden komplexen Problematik der
Maschinenbelegungsplanung werden hohe Anforderungen an die Ablaufplanung und Fertigungssteuerung gestellt.
Im Gegensatz dazu ist bei der eigentlichen Fließfertigung12 die technologische
Arbeitsgangfolge und die ‚Bearbeitungszeiten für jeden Auftrag’ gleich, so das hier ein reines Reihenfolgeproblem der Auftragsveranlassung vorliegt13. Hierdurch erfolgt die Ablaufplanung einmalig vor dem Beginn der Fertigung einer Produktart und hat somit eher langfristigen Charakter.14
2.2 Prämissen und Zielsetzungen
Bei der Maschinenbelegungsplanung befasst man sich mit der Zuordnung von Aufträgen zu Arbeitsträgern bzw. Maschinen und umgekehrt unter Beachtung vorgegebener Zielsetzungen und Restriktionen.15
Als Restriktionen sind z.B. die folgenden Prämissen zu beachten:16
(a) Jeder Auftrag muß eine fest vorgegebene Maschinenfolge durchlaufen (technologische Folge).
(b) Kein Auftrag kann gleichzeitig auf mehr als einer Maschine bearbeitet werden und keine Maschine kann mehrere Aufträge synchron bearbeiten.
(c) Bearbeitungs- sowie Transportzeiten sind konstant und bekannt.
(d) Zu Beginn des Planungszeitraums stehen die Aufträge eindeutig fest.
„Aufgabe der Maschinenbelegung ist es, einen zulässigen – die Prämissen (a) bis (d) erfüllenden – Ablaufplan zu erstellen, der bezüglich mindestens einer Zielgröße optimal ist.“17
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Je nachdem, ob sich die Ziele zur Lösung der Maschinenbelegung auf Aufträge oder auf Maschinen beziehen, kann eine allgemeine Unterscheidung in auftrags- und arbeitsträgerorientierte Ziele erfolgen (siehe Abbildung 2-2).18
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-2: Mögliche Zielsetzungen im Rahmen ablauforganisatorischer Probleme19
Als Ziele können grundsätzlich Kosten- bzw. Erfolgsgrößen in Betracht gezogen werden.20 Jedoch aufgrund von Bewertungsproblemen21 und der schweren Quantifizierbarkeit dieser Zielgrößen, werden in der Literatur vielfach abgeleitete
Zeitziele formuliert22. Es wird angenommen, dass diese Ersatzziele die Kosten- und Erlösziele positiv beeinflussen.23
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Verständnis über die vorwiegend relevanten Zeitgrößen innerhalb eines Auftragsdurchlaufs gibt beispielhaft die folgende Abbildung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-3: Komponenten der Auftragsdurchlaufzeit24
Die wesentlichen Zielsetzungen im Rahmen der Maschinenbelegungsplanung lassen sich in Anlehnung an ZÄPFEL in drei Gruppen unterteilen:25
- Durchlaufzeitbezogene Ziele
- Kapazitätsorientierte Ziele
- Terminorientierte Ziele
Die Durchlaufzeitbezogenen Ziele verfolgen im allgemeinen die Zielsetzung, durch einen schnellen Produktionsfluss, die Kapitalbindungskosten der Aufträge gering zu halten.26 Wie aus der Abbildung 2-3 hervorgeht ist die Durchlaufzeit eines Auftrags die Summe der Belegungszeiten auf allen Maschinen, den jeweiligen Transportzeiten und den entsprechenden Wartezeiten. Aufgrund der Prämisse (c) ist die Durchlaufzeit nur von den Wartezeiten abhängig, denn diese werden durch die Reihenfolge in der die Aufträge abgearbeitet werden beeinflusst. Demnach gehört zu den durchlaufbezogenen Zielen u.a. das Optimierungsziel ‚Minimierung der Summe der Wartezeiten aller Aufträge über alle Maschinen’.
Kapazitätsorientierte Ziele verfolgen im allgemeinen eine möglichst hohe produktive Ausnutzung der vorhandenen betrieblichen Maschinen27 und gehören zu den arbeitsträgerorientierten Zielen. Eine typische Zielsetzung ist hier die Minimierung der Summe der Leerzeiten aller Maschinen, d.h. Zeiten in denen Maschinen stillstehen sollen vermieden werden.
Zu den Terminorientierte Zielen gehören beispielsweise „Minimierung der maximalen Verspätung“ oder „Minimierung der Summe aller Verspätungen“.28 Hierdurch wird z.B. versucht, mögliche Kosten an Konventionalstrafen und verspätete Rückflüsse der Erlöse zu vermeiden.29 Des weiteren sind auch Zielsetzungen bezüglich Termin- unterschreitungen denkbar.30
Eine noch nicht behandelte, in der Literatur häufig genannte Zielsetzung, ist die Minimierung der Zykluszeit bzw. Minimierung der maximalen Durchlaufzeit. Die Zykluszeit ist diejenige Zeitspanne, die vom Beginn der Bearbeitung des ersten Auftrags bis zur endgültigen Fertigstellung des letzten der zu bearbeitenden Aufträge vergeht.31 Dieser Begriff ist vor allem von Bedeutung, da nach Ablauf der Zykluszeit der Fertigungsbereich für neue Auftragsfolgen frei ist.32
ZÄPFEL gliedert diese Zielsetzung in die Durchlaufzeitbezogenen Ziele, zeigt aber gleichzeitig die Kontroverse vieler Autoren auf, die durch diese Zielsetzung verfolgten Kostenziele entstehen:33
Die Durchlaufzeitbezogenen Ziele sind primär an den Kapitalbindungskosten ausgerichtet. Wobei diese Kosten vom Wert der gelagerten Erzeugnisse, ihrer Lagerdauer und dem angenommenen kalkulatorischen Zinssatz abhängig sind.34 Doch werden in dieser Zielsetzung z.B. die Fertigstellungszeitpunkte aller Aufträge, die vor der längsten Durchlaufzeit beendet werden, als gleichgültig angesehen. Hierdurch hat diese Zielsetzung eher Bedeutung in Bezug auf die Fragestellung „ob ein vorgegebenes Produktionsprogramm innerhalb des Planungszeitraums abzuwickeln ist?“. DOMSCHKE/SCHOLL/VOß ordnet diese Zielsetzung eher in die Kapazitätsorientierte Ziele ein.35
[...]
1 Vgl. Daub, A., Ablaufplanung, 1994, S. 136.
2 Vgl. Petersen, U., Produktionsplanung und Belegung von Montageflächen, 1992, S. 74.
3 Vgl. Kistner, K.; Steven, M., Produktionsplanung, 1990, S. 147.
4 Vgl. Schafft, E., Modellbildung und Modellbewertung dargestellt an einem Beispiel der Produktionsplanung bei Sortenfertigung, 1992, S. 162.
5 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 16 ff.
6 Vgl. Ebenda, S. 17.
7 Vgl. Ebenda, S. 20.
8 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung in die Produktion, 1993, S. 267.
9 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 17.
10 Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 17.
11 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung..., a.a.O., S. 240.
12 Abgesehen von Sonder- oder Mischformen wie z.B. die Reihenfertigung.
13 Vgl. Vahrenkamp, R., Produktions- und Logistikmanagement, 1996, S. 170.
14 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung..., a.a.O., S. 268.
15 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 249.
16 Vgl. Zäpfel, G., Produktionswirtschaft, 1982, S. 248.
17 Ebenda, S. 248.
18 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 26.
19 Vgl. Ebenda, S. 27.
20 Vgl. Zäpfel, G., Produktionswirtschaft, 1982, S. 248.
21 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 267.
22 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung..., a.a.O., S. 268.
23 Vgl. Vahrenkamp, R., Produktions- und Logistikmanagement, 1996, S. 159.
24 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung ..., a.a.O., S. 269.
25 Vgl. Zäpfel, G., Produktionswirtschaft, 1982, S. 249.
26 Vgl. Ebenda, S. 250.
27 Vgl. Ebenda, S. 250.
28 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 263.
29 Vgl. Vahrenkamp, R., Produktions- und Logistikmanagement, 1996, S. 159.
30 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung..., a.a.O., S. 270.
31 Vgl. Domschke, W.; Scholl, A.; Voß, S., Produktionsplanung, 1993, S. 262.
32 Vgl. Vahrenkamp, R., Produktions- und Logistikmanagement, 1996, S. 162.
33 Vgl. Zäpfel, G., Produktionswirtschaft, 1982, S. 249 f.
34 Vgl. Bloech, J.; Bogaschewsky, R.; Götze, U.; Roland, F., Einführung..., a.a.O., S. 246.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit zum Thema Maschinenbelegungsplanung?
Der Fokus liegt auf der Erörterung der Ablauf- bzw. Reihenfolgeplanung mittels Prioritätsregeln in der Durchführungsplanung. Es wird untersucht, inwiefern Prioritätsregeln als Instrument der Maschinenbelegungsplanung zum Einsatz kommen.
Welche Kapitel umfasst diese Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der Maschinenbelegungsplanung, Kapitel 3 behandelt die Prioritätsregeln und Kapitel 4 enthält eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Aufgaben umfasst die Maschinenbelegungsplanung?
Die Maschinenbelegungsplanung umfasst die kurzfristigen Planungsaufgaben der Reihenfolgeplanung und Feinterminierung, wobei Reihenfolgen für die Bearbeitung von Aufträgen gebildet und eine detaillierte zeitliche Verteilung der Aufträge auf einzelne Maschinen vorgenommen wird.
Welche Prämissen sind bei der Maschinenbelegungsplanung zu beachten?
Zu den Prämissen gehören: Jeder Auftrag muss eine fest vorgegebene Maschinenfolge durchlaufen, kein Auftrag kann gleichzeitig auf mehr als einer Maschine bearbeitet werden, Bearbeitungs- und Transportzeiten sind konstant und bekannt, und zu Beginn des Planungszeitraums stehen die Aufträge eindeutig fest.
Welche Zielsetzungen gibt es im Rahmen der Maschinenbelegungsplanung?
Die wesentlichen Zielsetzungen lassen sich in drei Gruppen unterteilen: durchlaufzeitbezogene Ziele, kapazitätsorientierte Ziele und terminorientierte Ziele.
Was sind durchlaufzeitbezogene Ziele?
Durchlaufzeitbezogene Ziele verfolgen die Zielsetzung, durch einen schnellen Produktionsfluss die Kapitalbindungskosten der Aufträge gering zu halten, meist durch Minimierung der Wartezeiten.
Was sind kapazitätsorientierte Ziele?
Kapazitätsorientierte Ziele verfolgen eine möglichst hohe produktive Ausnutzung der vorhandenen betrieblichen Maschinen, oft durch Minimierung der Leerzeiten der Maschinen.
Was sind terminorientierte Ziele?
Terminorientierte Ziele umfassen beispielsweise die Minimierung der maximalen Verspätung oder die Minimierung der Summe aller Verspätungen, um Kosten durch Konventionalstrafen und verspätete Rückflüsse der Erlöse zu vermeiden.
Was ist die Zykluszeit und warum ist sie von Bedeutung?
Die Zykluszeit ist die Zeitspanne, die vom Beginn der Bearbeitung des ersten Auftrags bis zur endgültigen Fertigstellung des letzten der zu bearbeitenden Aufträge vergeht. Sie ist von Bedeutung, da nach Ablauf der Zykluszeit der Fertigungsbereich für neue Auftragsfolgen frei ist.
Welche Rolle spielen Prioritätsregeln in der Maschinenbelegungsplanung?
Prioritätsregeln werden als Instrument zur Festlegung des Fertigungsablaufs eingesetzt, insbesondere aufgrund ihrer einfachen Handhabung in EDV-Programmen zur Produktionsplanung und -steuerung.
- Quote paper
- Karsten Kunik (Author), 2001, Prioritätsregeln als Instrument der Maschinenbelegungsplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105147