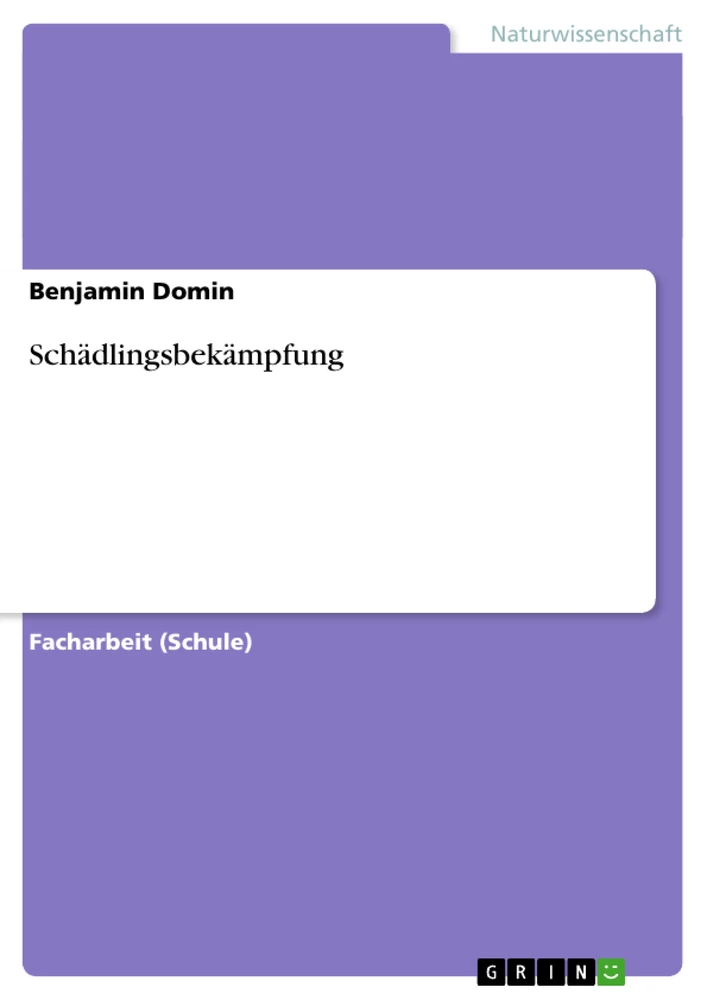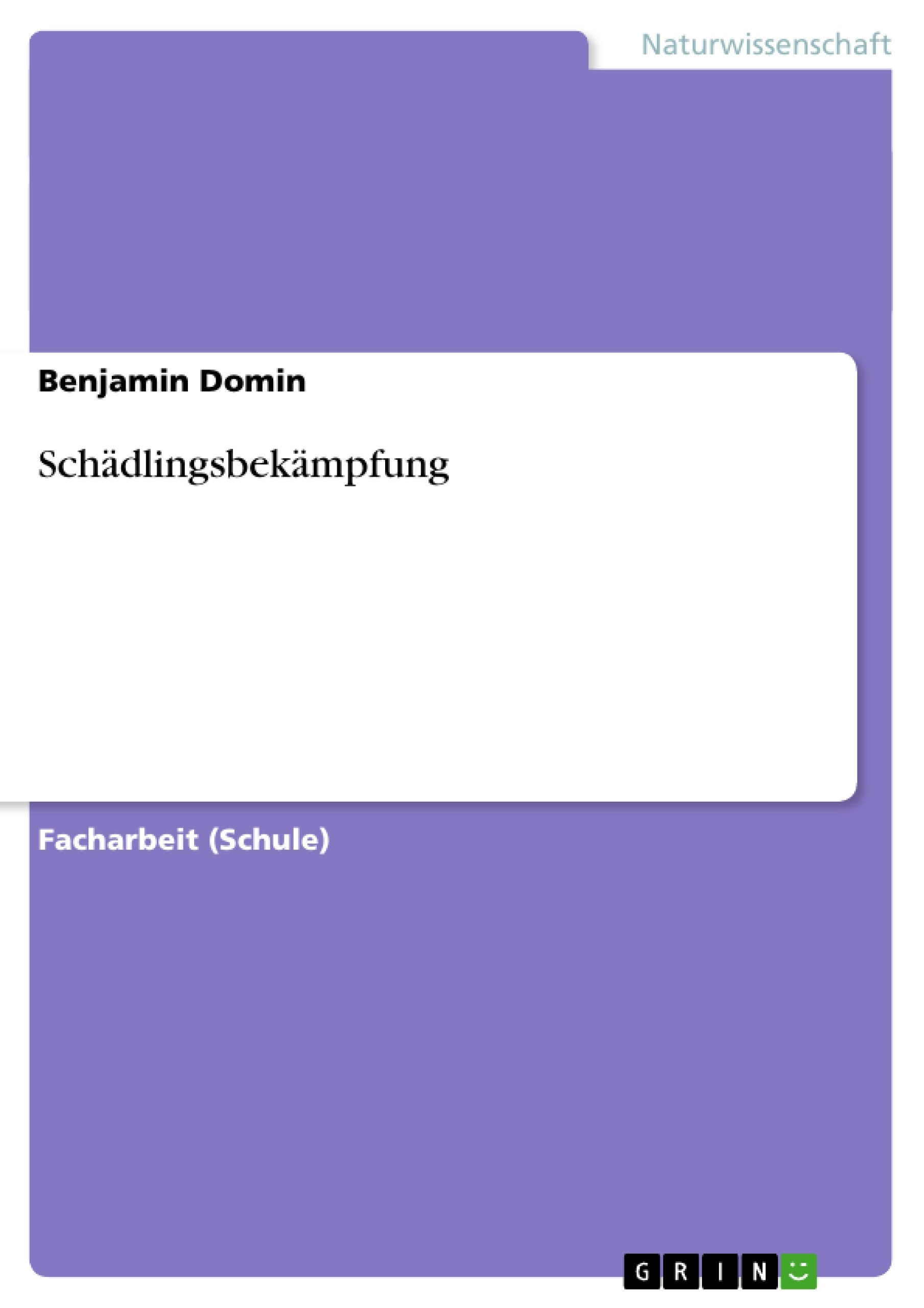Stellen Sie sich eine Welt vor, in der ein Drittel unserer Ernten jedes Jahr durch unsichtbare Feinde vernichtet wird – Pflanzenkrankheiten und Schädlinge, die unsere Nahrungsgrundlage bedrohen. Angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung wird die Suche nach wirksamen Methoden zur Schädlingsbekämpfung immer dringlicher. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine fesselnde Reise durch die Geschichte der Schädlingsbekämpfung, von den verzweifelten Versuchen unserer Vorfahren mit Opfergaben und bizarren Mixturen bis hin zu den bahnbrechenden Fortschritten der modernen Chemie und Biotechnologie. Entdecken Sie, wie der Einsatz von Pestiziden wie DDT zwar Millionen Menschen vor Krankheiten rettete, aber auch verheerende ökologische Folgen hatte, die bis heute nachwirken. Erfahren Sie mehr über die Entstehung resistenter Schädlingsstämme und die Notwendigkeit, nachhaltigere Alternativen zu entwickeln. Tauchen Sie ein in die Welt der biologischen Schädlingsbekämpfung, von den indirekten Maßnahmen zur Förderung von Nützlingen bis hin zum gezielten Einsatz von Parasiten und Mikroorganismen. Erkunden Sie das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes, das verschiedene Verfahren kombiniert, um die Umweltbelastung zu minimieren und gleichzeitig die Erträge zu sichern. Wagen Sie einen Blick in die Zukunft mit transgenen Pflanzen, deren Genom so verändert wurde, dass sie selbst Insektizide produzieren – eine vielversprechende, aber auch ethisch umstrittene Technologie. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Landwirtschaft, Umweltschutz und die Herausforderungen der globalen Ernährungssicherheit interessieren. Es bietet einen umfassenden Überblick über die komplexen Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Technologie und regt zum Nachdenken über die Zukunft unserer Landwirtschaft an. Begleiten Sie uns auf einer spannenden Entdeckungsreise und erfahren Sie, wie wir unsere Ernten schützen und gleichzeitig unseren Planeten bewahren können. Das Buch beleuchtet die Vor- und Nachteile chemischer Schädlingsbekämpfungsmittel, wie Insektizide und Herbizide, und untersucht die Auswirkungen von DDT auf die Umwelt und die Entstehung resistenter Schädlingsstämme. Es werden biologische Alternativen wie der Einsatz von Marienkäfern, Schlupfwespen und Bacillus thuringiensis detailliert beschrieben, sowie innovative Methoden wie Pheromonfallen und die Verwirrungsmethode. Der integrierte Pflanzenschutz, der verschiedene Verfahren kombiniert, wird als zukunftsweisender Ansatz vorgestellt. Abschließend wird auf die Chancen und Risiken transgener Pflanzen eingegangen, die gentechnisch verändert wurden, um resistent gegen Schädlinge zu sein, wobei die ethischen Aspekte und potenziellen Umweltauswirkungen nicht außer Acht gelassen werden.
1. Einleitung
Zur Zeit geht jährlich ungefähr dreißig Prozent der Welternte durch Pflanzenkrankheiten und tierische Schädlinge verloren.
Angesichts der sehr schnell wachsenden Weltbevölkerung, die von den heutigen sechs Milliarden Menschen in 50 Jahren auf schätzungsweise zehn Milliarden Menschen gewachsen sein wird, wird es früher oder später zwingend notwendig sein, diese dreißig Prozent retten.
Schädlingsbekämpfung wird schon betrieben, seitdem die Menschen gezielt eine bestimmte Pflanzenart auf einer Nutzfläche anbauen; durch diesen Massenhaften Anbau einer Pflanzenart vermehren sich auch die Organismen massenhaft, die sich von diesen Pflanzen ernähren und dem Menschen zum Nahrungskonkurrenten werden. Dadurch werden sie für den Menschen zu Schädlingen.
Ein solcher Nahrungskonkurrent ist zum Beispiel die Heuschre: So kann ein mittelgroßer Schwarm Heuschrecken an einem einzigen Tag bis zu 3000 Tonnen Pflanzen vertilgen und das ist der Jahresbedarf eines Dorfes mit mehreren tausend Einwohnern!
2. Geschichte der Schädlingsbekämpfung
Schon in der Bibel ließt man von Schädlingen und deren Bekämpfung:
,,(...) was die Raupen lassen, das fressen die Heuschrecken, und was die Käfer lassen, daßfrißt das Geschmeiß.(...) und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder an allen Orten, so sehr viel, daßzuvor desgleichen nie gewesen ist noch hinfort sein wird. Denn sie bedeckten das Land und verfinsterten es. Und sie fraßen alles Kraut im Lande und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übriggelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde in ganz Ägyptenland."
(Zitat übernommen aus Bayer AG, Pflanzenschutz auf neuen Wegen, 1992, o.O. S.6)
Diese Milliardenschwärme von Heuschrecken traten sogar in Mitteleuropa bis in das 19. Jahrhundert auf und noch heute fallen sie aus ihren afrikanischen Brutgebieten über Obstplantagen her.
Deshalb versuchen die Menschen auch seit eh und je ein Mittel gegen diese und andere Schädlinge zu finden. Vor 10000 Jahren versuchte man es mit Opfergaben und Zaubersprüchen, später dann auch mit handfesten Mitteln wie zum Beispiel mit einem Gemisch aus Asche, gestoßenen Zypressenblättern und Urin als Pflanzenschutzmittel (ca. 23 - 79 n. Chr.). Im Mittelalter versuchte man die Weinberge gegen den Heu- und Sauerwurm zu schützen indem man Rindermist, alte Schuhsohlen Hirschhorn und Frauenhaar verbrannte. Gemische aus Bocksblut und Bärenschmalz oder aus Knoblauchsaft und Kröten waren auch sehr beliebt.
All diese teilweise verzweifelten Versuche, den Nahrungsbestand zu retten brachten natürlich keinen Erfolg. So kam es aufgrund von Schädlingen immer wieder zu Hungersnöten.
Im 19. Jahrhundert setzte man dann organische und anorganische Substanzen wie zum Beispiel Nikotin und Arsen, Schwefelpulver und Schwefelkalkbrühe, sowie Kupferlösungen und Ätzkalk zur Bekämpfung von Schädlingen ein. Doch auch diese Mittel brachten nicht den erhofften Erfolg.
Erst im späten 19. Jahrhundert brachte die Chemie Abhilfe:
1892 wütete die Nonnenraupe in Deutschlands Wäldern und ein ihr verwandter Schädling fraßgleichzeitig die Felder leer. Zu der Zeit brachte Bayer das erste chemisch synthetische Insektizid der Welt auf den Markt, es war das vielversprechende Antinonnin.
Doch vorerst blieb der Erfolg aus; Im Labor funktionierte es zwar gut, aber in der Realität richtete es fast gar nichts aus, da das Insektizid nicht die Baumkronen erreichte, wo die meisten Nonnenraupen lebten. Erst mehrere Jahre später, als Antinonnin mit dem Flugzeug versprüht wurde, brachte es den versprochenen Erfolg.
Heute werden Schädlinge hauptsächlich mit chemischen Mitteln bekämpft.
Der biologische und genetische Pflanzenschutz steck noch in den Kinderschuhen.
3. Chemische Schädlingsbekämpfung
3.1 Merkmale der chemischen Schädlingsbekämpfung
Die Mittel der chemischen Schädlingsbekämpfung nennen sich Pestizide1: Insektizide gegen Insekten, Nematizide gegen Fadenwürmer, Fungizide gegen Pilze, Herbizide gegen Unkräuter, Rodentizide gegen Nagetiere, Akarizide gegen Milben und Bakterizide gegen Bakterien.
Die Vorteile von Pestiziden gegenüber alternativen Schädlingsbekämpfungsmethoden liegen auf der Hand: Chemische Mittel wirken sehr schnell und zuverlässig und sind leicht zu handhaben. Sie wirken auf unterschiedliche Weise: Entweder das Gift wird über die Nahrung, durch Kontakt, oder über die Atemwege aufgenommen. Einige Pestizide stören die Informationsübertragung im Nervensystem. Es wird zum Beispiel das Enzym Acetylcholinesterase blockiert, dadurch entstehen Krampfzustände, die zum Tode führen.
3.2 Nachteile und Gefahren der chemischen Schädlingsbekämpfung
Trotz der oben genannten Vorteile ist es an der Zeit sich nach anderen Maßnahmen zum Pflanzenschutz umzusehen, da die diese Pestizide auf Dauer eine zu große Belastung für unsere Umwelt darstellen:
Pestizide wirken in der Regel nicht speziell auf einen bestimmten Organismus; sie töten also nicht nur den Schädling, sondern gefährden auch andere Lebewesen. Die Mittel, die über längere Zeit wirken, geraten früher oder Später auch in den Boden. Das gefährdet unschädliche und auch nützliche Tiere wie zum Beispiel den Regenwurm oder die Bodenfauna, die wichtig für die Humusbildung und die Bodenlockerung ist.
3.3 Das bekannteste Pestizid: DDT
Früher wurde das sogenannte DDT2, was von dem Chemiker P. H. Müller3 als wirksam gegen Insekten entdeckt wurde, zur Begiftung von Ulmen gegen den Ulmensplintkäfer verwendet. Dieses DDT ist persistent4 und kann daher nicht vom Organismus zersetzt und ausgeschieden werden; es ist fettlöslich und lagert sich daher im Fettgewebe des Konsumenten an. Dadurch gelangt es in die Nahrungskette. So starb nach dem Einsatz von DDT in Nordamerika eine Vielzahl von Rotbrustdrosseln, die sich hauptsächlich von Regenwürmern ernähren. Die Regenwürmer haben das Pestizid über ihre Nahrung aufgenommen und es so an die Rotbrustdrosseln weitergegeben.
Spuren von DDT kann man heutzutage in fast allen Organismen wiederfinden, es wurde sogar schon in der Muttermilch des Menschen nachgewiesen.
Dazu muss aber gesagt werden, dass durch den Einsatz von DDT allein in Indien zwischen 1946 und 1962, ungefähr 15 Millionen Menschen vor dem Malariatod und über 100 Millionen Menschen vor Malariaerkrankungen gerettet wurden, indem es gegen die Malariaübertragenden Mücken eingesetzt wurde. Andererseits hat der unbedachte Einsatz von DDT zur Entstehung von DDT-resistenten5 Mücken geführt und die Anzahl der Malariaerkrankungen wieder stark ansteigen lassen.
3.4 Entstehung resistenter Schädlingsstämme
Durch ein dauerhaft angewendetes Pestizid kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Schädlingsstämmen, die gegen bestimmte Pestizide resistent
wurden. Da die Empfindlichkeit gegen Pestizide bei den Schädlingen individuell sehr unterschiedlich ist, werden die Nachkommen überlebender Stämme nach und nach unempfindlicher gegen dieses Pestizid. Das hat zur Folge, dass die Dosis des Pestizides ständig erhöht werden muss, wenn kein vergleichbares Mittel zu Verfügung steht. Dadurch wird natürlich die Umwelt wiederum stärker belastet. Nur um noch einmal aufzuzeigen, dass es an der Zeit ist, Alternativen zur chemischen Schädlingsbekämpfung weiter zu entwickeln.
4. Biologische Schädlingsbekämpfung
4.1 Merkmale der biologischen Schädlingsbekämpfung
Die biologische Schädlingsbekämpfung ist Pflanzenschutz, unter Verwendung von Lebewesen. Dabei werden entweder die natürlichen Gegner der schädlichen Organismen benutzt (meistens Fressfeinde oder Parasiten) oder die Schädlinge selber werden von Menschenhand so verändert, dass sie ihren Artgenossen schaden.
Die bekanntesten Nützlinge sind u.a. Marienkäfer, Raubwanzen, Spinnen, Eidechsen, Singvögel, Spitzmäuse und Igel.
4.2 Indirekte Maßnahmen zur biologischen Schädlingsbekämpfung
Bei der indirekten biologischen Schädlingsbekämpfung werden die Lebensräume von Nützlingen geschont und die Vermehrung erleichtert oder besser gesagt gefördert, indem zum Beispiel Nistkästen für Höhlenbrüter in der Nähe der Pflanzenkulturen angebracht werden, oder indem die Nesthügel der kleinen roten Waldameise mit Schutzhauben versehen werden. Außerdem erhält oder errichtet man Biotope und Hecken um ökologische Nischen zu erhalten.
4.3 Direkte Maßnahmen zur biologischen Schädlingsbekämpfung
Bei der direkten biologischen Schädlingsbekämpfung werden gezielt Nützlinge ausgebracht. Dabei werden Feinde der Schädlinge im Labor gezüchtet und dann in die Gebiete der Schädlinge ausgesetzt. Hierfür werden hauptsächlich Schlupfwespenarten und Zehrwespenarten gezüchtet. Diese Arten setzen ihre Eier in die Puppen, Larven oder Eier der Schädlinge; die geschlüpften Larven (des Nützlings) sind (unechte6 ) Schmarotzer und ernähren sich von dem Fettgewebe des Wirts. Sie höhlen den Wirt quasi aus bis der Schädling stirbt.
Die Zehrwespe, die nur 0,8mm großist, wird heute massenhaft eingesetzt. Gezüchtet wird sie auf der San - José Schildlaus, die wiederum auf Kürbissen oder Melonen sitzt und sich davon ernährt. Später werden die mit Zehrwespenlarven vollbesetzten Kürbisse oder Melonen dann zum Beispiel an Obstbäume gehängt. Jedes geschlüpfte Weibchen kann bis zu 40 Schildläuse vernichten.
Die Gefahr bei dieser Art der Schädlingsbekämpfung ist, dass die Parasiten sich auf andere, eventuell nützliche Arten, verbreiten und diese damit schädigen oder gar ausrotten könnten.
4.4 Mikrobiologische Schädlingsbekämpfung
Eine Möglichkeit der mikrobiologischen Schädlingsbekämpfung ist, Schädlinge mit Infektionskrankheiten zu versehen. Dabei werden Viren oder Bakterien benutzt, die nur bei dem zu bekämpfendem Schädling eine Infektion hervorrufen. Das hat den großen Vorteil, dass eben nur eine Bestimmte Schädlingsart betroffen wird und keine Nützlinge gefährdet werden. Beispielsweise setzt man die Bakterienart Bacillus thuringiensis gegen Obst-, Gemüse-, und Forstschädlinge, wie Gespinstmotten, Frostspanner, Schwammspinner, den Kohlweißling und den Lärchenwickler ein. Dieser Bacillus befällt die Larve von bestimmten Schädlingen und vernichtet sie.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Schädlinge mit Pheromonen7 anzulocken und mit physikalischen Mitteln, wie zum Beispiel Kleb- oder Giftfallen, zu fangen und zu töten.
Des weiteren gibt es noch die sogenannte Verwirrungsmethode: Ein Pheromon wird in größeren Mengen ausgesprüht um die Schädlinge, wie der Name schon sagt, zu verwirren. Die Männchen finden so die Weibchen nicht mehr und es kann keine Paarung stattfinden.
Nachteil dieser Methoden ist, dass die Wirkung nur kurzfristig anhält und der Vorgang daher häufig wiederholt werden muss, was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist.
4.5 Integrierter Pflanzenschutz
Integrierter Pflanzenschutz ist: ,,eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maßbeschränkt wird." (Def.: Pflanzenschutzgesetz 1986, Zitat übernommen aus C.C. Buchner, Vita nova Biologie für die Sekundarstufe 2, Bamberg 2000, S.438).
Das heißt, dass bei der integrierten Schädlingsbekämpfung mehrere Verfahren vereint werden um den größtmöglichsten Nutzen aus diesen Verfahren zu ziehen und gleichzeitig die Umwelt so weit wie möglich zu schonen. So werden hierbei zum Beispiel Pestizide erst dann eingesetzt, wenn eine bestimmte Schwelle des Schädlingsbefalls überschritten ist. Man versucht also nicht ein Schädlingsfreies Feld zu schaffen, sondern man versucht eine Waage zwischen Verlust der Erträge und Bekämpfung der Schädlinge zu finden. Man beginnt dabei schon bei dem Anbau der Pflanzen, indem man biologisch düngt und auf schonende Bodenbehandlung, sowie auf standortgerechte Nutzpflanzen achtet. Dabei steht der wirtschaftliche Faktor im Vordergrund, was aber gleichzeitig der Umwelt zu gute kommt.
5. Transgene Pflanzen
Mittlerweile ist es gelungen, Gene für die Produktion eines Insektizids in das Genom von Pflanzen einzubauen.
Am Beispiel wird das Toxin8 des Bakteriums Bacillus thuringensis in das Genom der Kartoffel eingebaut. Sobald ein Schädling die Blätter der Pflanze frisst, stirbt er. Die Kartoffel ist jetzt gegen alle blattfressenden Insekten resistent, für andere Organismen ist dieses Toxin aber absolut unschädlich.
Die Genmanipulation von Pflanzen ist moralisch umstritten und verbirgt eventuell unerforschte Risiken. Deshalb wird diese Art von Schädlingsbekämpfung heutzutage zumindest öffentlich kaum betrieben. Aber vielleicht oder sogar wahrscheinlich, ist das die Zukunft des Pflanzenschutzes.
6. Schlusswort
Die Schädlingsbekämpfung ist ein breites Thema. Zu den Pflanzenschädlingen gehören natürlich auch Krankheitserreger der Pflanzen, Wildkräuter, und Pilze. Außerdem wird Schädlingsbekämpfung nicht nur direkt ,,am Feld" betrieben, sondern überall wo es für den Menschen schädliche oder störende Einflüsse der Natur gibt: Es fängt an in Wohnungen bei der störenden Mücke, geht über den K äfer in der Küche bis zu den Ratten in Speisekammern. Gegen Viruserkrankungen geht man zum Beispiel schon mit Genmanipulation vor, indem man in Tomaten, Zuckerrüben, und Bananen die Erbanlagen für das Hüllprotein des Erregers einpflanzt und so eine Infektion vortäuscht, um einer Infektion vorzubeugen.
Ich habe mich hauptsächlich auf die schädlichen Insekten beim Nutzpflanzenanbau beschränkt, weil mir dieser Bereich am interessantesten und am besten ,,einzukreisen" erschien.
7. Literaturverzeichnis
- Schroedel, Materialien für den Sekundarbereich 2 Biologie Ökologie, Hannover 2000
- J.M.Franz/A.Krieg, Biologische Schädlingsbekämpfung 2. Auflage, o.O. 1976
- Schroedel, Linder Biologie 20. Auflage, Hannover 1989
- C.C.Buchner, Vita nova Biologie für die Sekundarstufe 2, Bamberg 2000
- Bayer AG, Pflanzenschutz auf neuen Wegen, o.O. 1992
- H. Pape, Krankheiten und Schädlinge der Zierpflanzen und Ihre Bekämpfung 5. Auflage, o.O. 1964
- N. A. Campbell, Spektrum Lehrbuch Biologie, Heidelberg, Berlin, Oxford 1997
www.wissen.de
www.uni-giessen.de
[...]
1,,Von engl. ,,pest" = Schadorganismus, also giftige Stoffe zur Abtötung von schädlichen Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen." (Franz J./Krieg A., Biologische Schädlingsbekämpfung, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1976, 2. Auflage, S.23)
2 Dichlor-Diphenyl-Trichloräthan. Berührungsgift, das durch die Körperoberfläche der Insekten eindringt. Wirkt anfangs schwach, hat aber eine große Dauerwirkung. Hauptsächlich wirksam gegen Raupen, Blattwespenlarven, Erdflohkäfer, Blattkäfer, Blattwanzen, Fliegen, Motten und Asseln.
3,,Paul Hermann Müller, Schweizer Chemiker, erhielt 1948 einen Nobelpreis für seine Entdeckung der Wirksamkeit von DDT auf Insekten." (C.C. Buchner, Vita Nova Biologie für die Sekundarstufe 2, Bamberg 2000, S.436)
4 Lat.: langanhaltend, dauernd
5 siehe Punkt 3.4
6 unechte Schmarotzer töten ihren Wirt im Gegensatz zu echten Schmarotzern.
7,,Duftstoffe, die im Tierreich u.a. zur Revierkennzeichnung oder zur Anlockung des Geschlechtspartners eingesetzt werden" (Schroedel, Materialien für den Sekundarbereich 2 Biologie Ökologie, Hannover 1998, S.149)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Schädlingsbekämpfung, insbesondere in Bezug auf Pflanzenkrankheiten und tierische Schädlinge, die jährlich einen erheblichen Teil der Welternte vernichten.
Wie hat sich die Schädlingsbekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt?
Die Schädlingsbekämpfung hat eine lange Geschichte, die von Opfergaben und Zaubersprüchen in der Antike bis hin zu chemisch-synthetischen Insektiziden im 19. Jahrhundert reicht. Frühe Versuche umfassten den Einsatz von Asche, Zypressenblättern, Urin und verschiedenen Tiermischungen. Erst mit der Entwicklung der Chemie kamen wirksame Mittel auf den Markt.
Was sind die Merkmale der chemischen Schädlingsbekämpfung?
Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel, auch Pestizide genannt, wirken schnell und zuverlässig. Es gibt verschiedene Arten von Pestiziden wie Insektizide, Nematizide, Fungizide, Herbizide, Rodentizide, Akarizide und Bakterizide. Sie können über die Nahrung, durch Kontakt oder über die Atemwege aufgenommen werden und stören oft die Informationsübertragung im Nervensystem der Schädlinge.
Welche Nachteile und Gefahren birgt die chemische Schädlingsbekämpfung?
Pestizide wirken oft nicht spezifisch auf einen bestimmten Organismus und können daher auch nützliche Lebewesen gefährden. Sie können in den Boden gelangen und dort unschädliche Tiere wie Regenwürmer schädigen. Das bekannteste Beispiel ist DDT, das sich in der Nahrungskette anreichert und in fast allen Organismen nachweisbar ist.
Was ist DDT und welche Auswirkungen hat es?
DDT (Dichlor-Diphenyl-Trichloräthan) ist ein persistentes Pestizid, das sich im Fettgewebe anreichert und in die Nahrungskette gelangt. Obwohl es in der Vergangenheit zur Malariabekämpfung eingesetzt wurde und Millionen von Menschenleben rettete, führte es auch zur Entstehung von DDT-resistenten Mücken und zur Gefährdung von Wildtieren.
Wie entstehen resistente Schädlingsstämme?
Durch den dauerhaften Einsatz von Pestiziden können sich Schädlingsstämme entwickeln, die gegen diese Mittel resistent werden. Da die Empfindlichkeit gegen Pestizide individuell unterschiedlich ist, werden die Nachkommen überlebender Stämme nach und nach unempfindlicher, was zu einer ständigen Erhöhung der Dosis oder zur Suche nach alternativen Mitteln führt.
Was sind die Merkmale der biologischen Schädlingsbekämpfung?
Die biologische Schädlingsbekämpfung nutzt Lebewesen zur Schädlingsbekämpfung. Dabei werden entweder die natürlichen Gegner der Schädlinge (Fressfeinde oder Parasiten) eingesetzt oder die Schädlinge selbst werden so verändert, dass sie ihren Artgenossen schaden. Bekannte Nützlinge sind Marienkäfer, Raubwanzen, Spinnen, Eidechsen, Singvögel, Spitzmäuse und Igel.
Welche indirekten Maßnahmen gibt es zur biologischen Schädlingsbekämpfung?
Indirekte Maßnahmen umfassen die Schonung und Förderung der Lebensräume von Nützlingen, z.B. durch das Anbringen von Nistkästen, den Schutz von Ameisenhügeln, die Erhaltung von Biotopen und Hecken.
Welche direkten Maßnahmen gibt es zur biologischen Schädlingsbekämpfung?
Direkte Maßnahmen umfassen das gezielte Ausbringen von Nützlingen, die im Labor gezüchtet werden. Hierfür werden hauptsächlich Schlupfwespen- und Zehrwespenarten eingesetzt, die ihre Eier in die Puppen, Larven oder Eier der Schädlinge setzen und diese auslaugen.
Was versteht man unter mikrobiologischer Schädlingsbekämpfung?
Bei der mikrobiologischen Schädlingsbekämpfung werden Schädlinge mit Infektionskrankheiten versehen, indem Viren oder Bakterien eingesetzt werden, die nur bei dem zu bekämpfenden Schädling eine Infektion hervorrufen. Ein Beispiel ist der Einsatz von Bacillus thuringiensis gegen verschiedene Obst-, Gemüse- und Forstschädlinge. Auch der Einsatz von Pheromonen zur Anlockung und Fang von Schädlingen gehört dazu.
Was ist integrierter Pflanzenschutz?
Integrierter Pflanzenschutz ist eine Kombination von Verfahren, bei denen unter Berücksichtigung biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird. Dabei werden Pestizide erst eingesetzt, wenn eine bestimmte Schwelle des Schädlingsbefalls überschritten ist. Man beginnt schon bei dem Anbau der Pflanzen, indem man biologisch düngt und auf schonende Bodenbehandlung achtet.
Was sind transgene Pflanzen?
Transgene Pflanzen sind Pflanzen, in deren Genom Gene für die Produktion eines Insektizids eingebaut wurden. Ein Beispiel ist die Kartoffel, in deren Genom das Toxin des Bakteriums Bacillus thuringiensis eingebaut wurde, wodurch sie gegen blattfressende Insekten resistent ist. Diese Art der Schädlingsbekämpfung ist moralisch umstritten und birgt eventuell unerforschte Risiken.
- Quote paper
- Benjamin Domin (Author), 2001, Schädlingsbekämpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105142