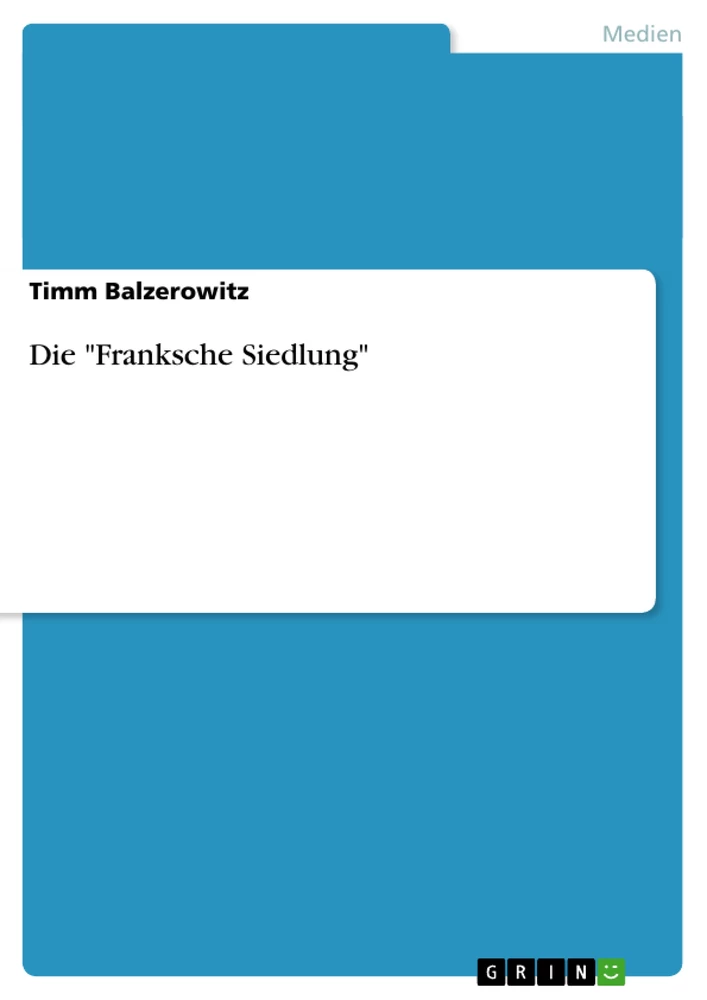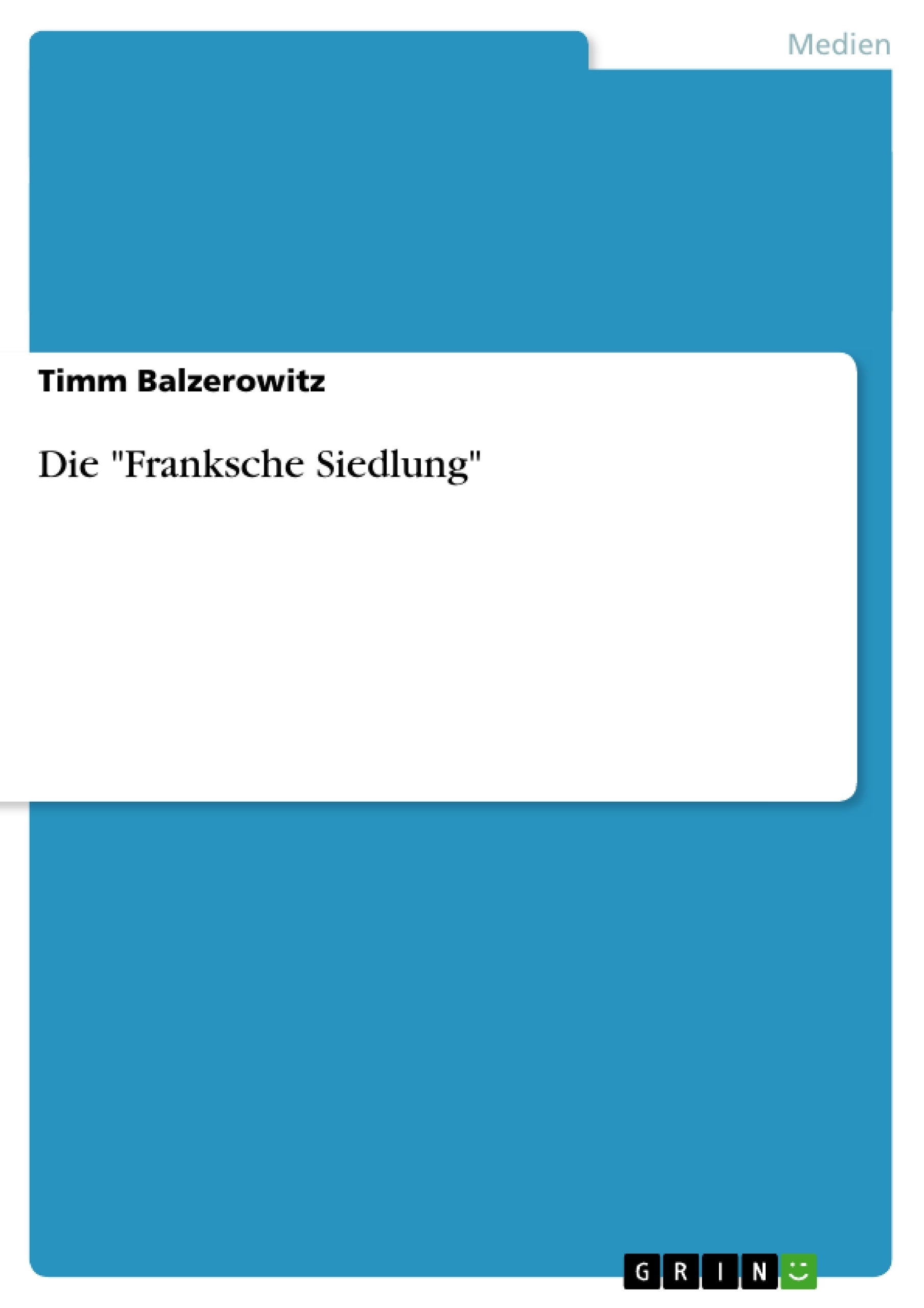Inhaltsverzeichnis
1.Geschichtlicher Rückblick
2.Städtebauliches und rechtliches Konzept
3.Das Einfamilien-Reihenhaus
4. Die "Grüne Stube"
5. Abschlussbemerkung / Quellennachweis Vorwort
Am Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts wurde die Idee der Gartenstadt in Deutschland begeistert aufgenommen. Aus Groß-Britannien kommend wird der Gedanke einer menschen- würdigen und lichtdurchfluteten Bauweise mit hohem Grünanteil von Architekten wie Hermann Muthesius umgesetzt.
"Jeder Arbeiterfamilie ihr (Einzel-) Haus mit Garten zuzuteilen, die ganze Anlage auf volkswirtschaftlich richtige Grundlage zu stellen, d.h. auf Rentabilität auszurichten, und die neue Siedlung nach den besten städtebaulichen, d.h. künstlerischen, technischen, wirtschaftlichen und hygienischen Gesichtspunkten zu gestalten, das ist das Neue, was gegenüber den früheren Arbeiterkolonien die heutige Gartenstadt kennzeichnet."
(H. Muthesius, 1912)
Was H. Muthesius bereits 1912 so treffend und ausführlich beschreibt, ist bei der Gartenstadt (Kleinhäuser) in Hellerau bei Dresden
vorbildlich umgesetzt worden. Mehr noch gilt dies für die ebenfalls von Muthesius geplante Arbeiter-Siedlung ÿZum Lith" in Duisburg.
Bauherr war die Duisburger Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft.
Die Kombinierung der Häuser zu Doppel- und Reihenhäusern in Längs- und Querrichtung, die erstaunlich durchdachten Grundrisse, können daher durchaus als ein Urtyp oder auch Vorläufer dessen gesehen werden, was später in Klein-Borstel in weiterentwickelter und typisierter Weise entstand.
Als die Planung Paul A. R. Franks weitgehend abgeschlossen war, und 1935-38 die ÿFranksche Siedlung" erbaut wurde, war die Situation natürlich eine ganz andere als zu Muthesius' Zeiten. Der ökonomische Druck war durch die seit Jahren von Rezession geprägte wirtschaftliche Lage erheblich höher. Auch die politische Lage war sicher nicht als ideal zu bezeichnen. Für die Realisierung eines Projektes dieser Art jedoch sicher von Vorteil, wenn man es geschickt zu verkaufen wusste. In dem Heft ÿDie volkspolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung des vorstädtischen Kleinhauses" (1938, H. Frank) beweist Hermann Frank, dass er eben dazu in der Lage war. Trotz antisemitischer Bemerkungen und fragwürdiger politischer Phrasen, die man wohl als zeitüblich betrachten muss, gelangt es in diesem Heft die Grundidee der Siedlung der interessierten Leserschaft nahe zu bringen. Allen Anfeindungen und politisch fragwürdigen Vorwürfen der Nachbarn zum trotze setzten sich die Bauherren, die Gebrüder Frank, durch.
Typisierung und Gleichwertigkeit der einzelnen Wohneinheiten waren daher auch das prägende Thema in Klein-Borstel. Das Auflösen einer architektonischen Hierarchie innerhalb der Siedlung zugunsten eines einheitlichen Erscheinungsbildes wurde, unter Berücksichtigung der später sich verändernden und wachsenden Grünelemente, betrieben. Die Kostenersparnisse, die durch die Typisierung der Bauteile erreicht wurde, trugen erheblich zum späteren Erfolg des Bauvorhabens bei. Doch vielleicht ist es auch gerade die Sorgfalt mit der die Freiflächenplanung der öffentlichen Bereiche bis ins Detail festgelegt wurde.
Dies unter Berücksichtigung des individuellen Gestaltens
der jeweiligen Garteneinheit, was dazu führt, dass die ÿFranksche Siedlung" bis heute einen nicht nur für die Bewohner ersichtlichen Charme und großen Identifikationswert hat.
Geschichtlicher Rückblick
Geologisch ist Klein-Borstel auf einer Anhöhe, einem Geestrücken der letzten Eiszeit, gelegen. Diese Erhebung wird im Norden durch den
Alsterlauf natürlich durchbrochen. Eine land-schaftlich interessante, sanft abfallende Bewegung des Geländes zur Alster ist die Folge.
Das sich stetig ausweitende Hamburger Besiedlungsgebiet erreichte die Gegend von Klein-Borstel erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das bis dahin rein ländlich geprägte Gebiet bestand aus Feldern mit Knickbegrenzung, kleinen Eichenwäldern, Einzelgehöften und dem landschaftlich reizvollen Alsterlauf. Ein typisches, ländliches Idyll der Walddörfer, die bis dahin einen Teil der Nahrung der innerstädtischen Bevölkerung produzierten. Lediglich die von Ohlsdorf kommende, in Richtung des Gutes führende, Wellingsbüttler Landstrasse durchzog das Gebiet. Ansonsten waren nur Feldwege zur Erschließung der Felder vorhanden.
Die ersten ÿHamburger Aussiedler" waren meist wohlhabende Familien der Bourgosie, des Großbürgertums, die sich entlang der schon beschriebenen Wellingsbüttler Landstrasse, direkt am Alstertal, ihre meist recht großzügigen Wohnhäuser errichteten. Diese Art der Bebauung hat in diesem Bereich bis heute prägenden Charakter.
Die Anlage der S-Bahntrasse inklusive der Bahnstation ÿKornweg/Klein-Borstel" im Jahr 1916 zerschnitt die bis dahin natürlich erhaltene Topographie des Geländes. Der 1921 folgende Bau der Hochbahnlinie und des Bahnhofs ÿKlein-Borstel" erschloss dieses Gebiet nicht nur verkehrstechnisch optimal (damalige Fahrzeit zum Zentrum der Stadt: 25 Minuten), sondern besiegelte gleichfalls das Ende der ländlichen Nutzung und Strukturen. Es war absehbar, wann das Hamburger Besiedlungsgebiet Klein-Borstel endgültig überformen würde. Die großflächige Anlage des Ohlsdorfer Friedhofes stellte sich städteplanerisch als Glücksfall heraus. Neben dem Alstertal ist der parkähnlich angelegte Friedhof heute die einzige nicht komplett bebaute Fläche des Gebietes und trägt zum hohen Wohnwert Klein-Borstels bei.
Die Gebrüder Frank erwarben Anfang der 30-er Jahre das Areal der ÿBockholt- Erben", um auf diesen Feldern ihre Vorstellung einer Gartenstadt zu realisieren. Der Architekt Paul A. R. Frank plante in diesem Fall, wie schon so oft davor, für die Siedlungs-gesellschaft Hermann und Paul Frank. Das zu bebauende Gebiet wurde in drei Teilbereiche aufgeteilt, welche die späteren Bauabschnitte darstellten. Es wurden 203 Wohneinheiten für den ersten Bauabschnitt (Straße: Stübenkamp) vorgesehen. Der zweite Bauabschnitt wurde mit 163 Wohneinheiten (Straße: Am Stein) geplant. Der dritte und damit letzte Bauabschnitt beinhaltete den Bau von 179 Wohneinheiten (Straße: Overn Barg) und beendete die Planung.
Insgesamt wurden also 545 Kleinhäuser auf einer Fläche von insgesamt 10,8 Hektar errichtet. Nach bekannt werden der Planung entrüsten sich die Nachbarn über die beabsichtigte Bebau-ungsdichte und ÿArt und Weise" der Bauten. Das Gebiet der Walddörfer sei ungeeignet für eine solche Bauform; ein neues Gängeviertel werde errichtet...
Nach Ansicht vieler Villenbesitzer war der soziale Absturz Klein-Borstels nur eine Frage der Zeit, da die "Negersiedlung", geplant von "bolschewistischen Spekulanten", kinderreiche Kleinverdiener anzöge. Die Streitigkeiten gingen immer weiter und endeten letztlich vor dem Hamburger Landgericht, welches feststellte, dass "niemand einen Anspruch darauf hat, dass im schönen Alstertal nur bessergestellte Volksgenossen sich ansiedeln".
Es wurde gebaut und am 30.September 1935 konnte das Richtfest des ersten Bauabschnittes gefeiert werden. Kaum jemand der damaligen Nachbarn war wohl in der Lage zu erkennen, was für ein durchdachtes architektonisches und rechtlich durchaus demokratisches Grundkonzept die Gebrüder Frank mit der Kleinhaussiedlung realisierten.
Bis 1939 waren alle drei Bauabschnitte abgeschlossen und 52 verschieden lange Baukörper auf dem Areal verteilt. Es ergab sich eine Wohndichte von 224 Personen pro Hektar, welche bis zum Jahre 2000 jedoch auf ca.
158 Personen pro Hektar abgesunken ist. Erst in den 50ern wird die Siedlung in Klein-Borstel architektonisch und städtebaulich in vollem Umfang von Fachleuten und der Öffentlichkeit begriffen. Nicht nur die Bewohner haben die Vorzüge und Annehmlichkeiten ihrer Häuser schätzen und lieben gelernt, auch Außenstehende erkennen nun immer mehr den ästhetischen und sozialpolitischen Wert der "Frankschen Siedlung".
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Überblick über eine Siedlung (Kleinhäuser), wahrscheinlich die "Franksche Siedlung" in Klein-Borstel bei Hamburg. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, ein Vorwort und Abschnitte über den historischen Hintergrund, städtebauliche und rechtliche Aspekte, das Einfamilien-Reihenhaus und einen Abschnitt, der als "Grüne Stube" bezeichnet wird.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis erwähnt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Themen: Geschichtlicher Rückblick, Städtebauliches und rechtliches Konzept, Das Einfamilien-Reihenhaus, Die "Grüne Stube" und Abschlussbemerkung / Quellennachweis Vorwort.
Was wird im Vorwort angesprochen?
Das Vorwort erwähnt die Gartenstadtidee, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland aufkam, inspiriert von Großbritannien. Es zitiert Hermann Muthesius und beschreibt, wie die Gartenstadtidee in Hellerau bei Dresden und in der Arbeiter-Siedlung "Zum Lith" in Duisburg umgesetzt wurde. Es vergleicht diese früheren Siedlungen mit der "Frankschen Siedlung" und betont die Typisierung und Gleichwertigkeit der Wohneinheiten in Klein-Borstel.
Was wird über den historischen Hintergrund von Klein-Borstel gesagt?
Klein-Borstel liegt auf einem Geestrücken und wurde erst spät im 19. Jahrhundert von Hamburg aus besiedelt. Vorher war es ländlich geprägt. Der Bau der S-Bahn- und Hochbahnlinien erschloss das Gebiet und beendete die ländliche Nutzung. Die Gebrüder Frank erwarben das Areal der "Bockholt-Erben", um dort ihre Gartenstadt zu realisieren. Es gab anfängliche Widerstände von Nachbarn gegen die Bebauungsdichte.
Was war das architektonische Konzept der "Frankschen Siedlung"?
Das Konzept umfasste Typisierung und Gleichwertigkeit der Wohneinheiten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen und Kosten zu sparen. Die Freiflächenplanung wurde detailliert festgelegt, unter Berücksichtigung der individuellen Gestaltung der Gärten.
Wie wurde die Siedlung von der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Anfangs gab es Widerstand und Vorurteile gegenüber der Siedlung. Später wurde sie jedoch von Fachleuten und der Öffentlichkeit als architektonisch und städtebaulich wertvoll anerkannt. Heute gehört sie zu den schönsten erhaltenen Wohnensembles Norddeutschlands und steht unter Milieuschutz.
Wer waren die Gebrüder Frank und Paul A. R. Frank?
Die Gebrüder Frank waren Bauherren und Initiatoren der Siedlung. Der Architekt Paul A. R. Frank plante die Siedlung für die Siedlungsgesellschaft Hermann und Paul Frank.
Wie viele Wohneinheiten wurden in der Siedlung errichtet?
Insgesamt wurden 545 Kleinhäuser in drei Bauabschnitten auf einer Fläche von 10,8 Hektar errichtet.
Was wird über die "Grüne Stube" erwähnt?
Das Dokument enthält einen Abschnitt mit dem Titel "Die 'Grüne Stube'", aber es werden keine Details über deren Inhalt gegeben. Es ist anzunehmen, dass dieser Abschnitt sich mit der Gestaltung und Bedeutung der Grünflächen in der Siedlung befasst.
- Quote paper
- Timm Balzerowitz (Author), 2000, Die "Franksche Siedlung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105127